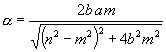
Die Erörterungen des 30. Kapitels haben uns mehrseitig Veranlassung gegeben, das psychophysische Verhältnis zwischen Tönen und Farben in Betracht zu ziehen, und die Aufgabe nahe gelegt, wo möglich in den tatsächlichen Verhältnissen der physischen Übereinstimmung und Verschiedenheit, die bei ihnen obwalten, den Grund der psychischen zu entdecken.
Schicken wir der folgenden Untersuchung, die in dieser Beziehung geführt ist, die Betrachtung einiger Verhältnisse, welche die Farben insbesondere angehen, voran, auf welche sich die Untersuchung teils mit zu beziehen, teils zu stützen haben wird.
a) Über die Grenzen der Sichtbarkeit der Farben und die Ursachen der Beschränkung dieser Sichtbarkeit.
Als im Allgemeinen bekannt wird vorausgesetzt, daß in einem aus homogenen Farben gebildeten prismatischen Spektrum sich dunkle Linien zeigen, welche für jede Lichtart bestimmten Ursprunges stets zwischen Strahlen von derselben Brechbarkeit liegen, daher zur Charakteristik von Strahlen gegebener Brechbarkeit dienen können. Die am meisten charakteristischen dieser Linien werden nach der Reihe vom Rot nach dem Violett und ins Ultraviolett hinein mit großen, von Stokes jedoch und früherhin auch von Helmholtz im Ultraviolett mit kleinen, lateinischen Buchstaben bezeichnet.
Davon liegen1) A, B, C im Rot, D im Orange, E im Grün, F im Blau, G im Indig2), H im Violet. I wird von Fraunhofer als violette Grenze des Spektrum bezeichnet.
1) Herschel, über
d. Licht. §. 419.
2) Diese Angabe nach Herschel.
Nach Vergleich der beiden folgenden Tabellen schiene G vielmehr
noch zum Violett zu gehören, und in Fraunhoferís Spektrumzeichnung
liegt G mitten zwischen den mit Indig und Violett bezeichneten Stellen.
Wegen des allmäligen Überganges der Farben und der mit der Stärke
des Lichtes variierenden Nuance des brechbaren Spektrumteiles (Pogg. XCIV,
13) wird hier keine scharfe Bestimmung möglich sein.
Abbildungen des Spektrum nach Fraunhofer
vom roten Ende bis zur Linie I finden sich u. a. in Gilb. Ann. LVI. Taf.
IV; Biotís Lehrb. Bd. V. Taf. XXI; Herschel über das Licht, Taf. VI
u. a. a. 0. ó Eine Abbildung des äußersten violetten und des
ultravioletten Spektrumteiles mit den festen Linien gibt Stokes in Pogg.
Ann. 4. Ergänz.-B. Taf. I. Fig. 1 (Erläuterung S. 200), eine
Abbildung des gesamten Spektrum von Rot bis zum letzten Ultraviolett Esselbach
in Pogg. XCVIII. Taf. V. Fig. 6 (Erläuterung S. 514 ff.). Obschon
im Stokesíschen Spectrum die Linien des ultravioletten Teiles mit kleinen,
im Esselbachíschen mit großen Buchstaben bezeichnet sind, so entsprechen
doch dieselben Buchstaben denselben Linien, wie nicht nur aus dem Vergleiche
der Spektra hervorgeht, sondern auch aus einer Angabe Esselbachís in Berl.
Ber. 1855. S. 788 zu schließen ist.
In mehrfacher Beziehung von nützlichem Anhalt für das Folgende werden nachstehende zwei Tabellen sein, deren erste, von Esselbach 3), die vom gewöhnlich sichtbaren Spektrum auf das Ultraviolett mit ausgedehnten Bestimmungen desselben über die, den festen dunklen Linien im Spektrum entsprechenden Wellenlängen, zusammengestellt mit den Fraunhoferíschen Bestimmungen, welche nur bis zum Violett reichen, enthält, die zweite, von Helmholtz 4) die, auf Esselbachís Bestimmungen mit Zuziehung einiger eigenen Bestimmungen über die Grenzen des Spektrum gegründete, Zusammenstellung der Farben mit Tonhöhen, wenn die Linie A dem Tone G entsprechend und die Wellenlänge des Tons c = 1 gesetzt wird, indes die Wellenlängen der Farben in Millimetern, wie in Esselbachís Tabelle ausgedrückt sind.
|
des Spektrum |
|
|
|
|
|
|
| A | 0,00076175) | × × × × × × × × |
| B | 6874 | 0,0006878 |
| C | 6564 | |
| D | 5886 | 5888 |
| E | 5260 | 5260 |
| F | 4845 | 4843 |
| G | 4287 | 4291 |
| H | 3929 | |
| L | 3791 | |
| M | 3657 | |
| N | 3498 | |
| 0 | 3360 | |
| P | 3290 | |
| Q | 3232 | |
| R | 3091 | |
3) Pogg. XCVIII, 524.
4) Berichte der Berl. Akad. 1855. 761.
5) Diese Bestimmung für A ist hier nach Helmholtz zugefügt, da sie in den Esselbachíschen Bestimmungen nicht enthalten ist.
Tabelle nach Helmholtz.
|
|
des Tons der Farbe |
der Farben |
|
| Fis | 64/45 | 0,0008124 | Ende des Rot |
| G | 4/3 | 7617 | Rot |
| Gis | 32/25 | 7312 | Rot |
| A | 6/5 | 6721 | Rot |
| B | 10/9 | 6347 | Rotorange |
| H | 16/15 | 6094 | Orange |
| c | 1 | 5713 | Gelb |
| cis | 24/25 | 5217 | Grün |
| d | 8/9 | 5078 | Grünblau |
| es | 5/6 | 4761 | Cyanblau |
| e | 4/5 | 4570 | Indigblau |
| f | 3/4 | 4285 | Violett |
| fis | 32/45 | 4062 | Violett |
| g | 2/3 | 3808 | Überviolett |
| gis | 16/25 | 3656 | Überviolett |
| a | 3/5 | 3385 | Überviolett |
| b | 5/9 | 3173 | Überviolett |
| h | 8/15 | 3047 | Ende des Sonnenspektrum |
Das von Newton gekannte und ohne eigentümliche Vorsichten sichtbare prismatische Farbenspektrum umfaßt nur etwa 1 Quinte.
J. Herschel 6) gibt die Undulationslänge des äußersten Rot zu 0,0000266, die des äußersten Violett zu 0,0000167 engl. Zoll in Luft (respektiv 0,0004242 und 0,0006756 Mill.), die Anzahl der Vibrationen in 1 Sek. bei ersterem zu 458 Billionen, bei letzterem zu 727 Billionen an. Indessen sind diese Grenzen schon durch Fraunhofer erweitert worden, der mindestens eine Oktave beobachtet hat, wie aus dem Vergleiche folgender Angabe desselben mit den Bestimmungen der Wellenlänge und der Ansicht des von ihm verzeichneten Spektrum, das von der Linie I als Grenze des Violett bis ein wenig über die Linie A hinaus reicht, hervorgeht.
6) Über das Licht. §. 575.
"Ungefähr bei A ist das rote, bei I das violette Ende des Farbenbildes, eine bestimmte Grenze ist aber auf keiner Seite mit Sicherheit anzugeben, leichter noch bei Rot, als bei Violett. Ist alles unmittelbar oder durch einen Spiegel reflektierte Sonnenlicht ausgeschlossen, so scheint auf der einen Seite die Grenze ungefähr zwischen G und H zu fallen, auf der anderen Seite in B zu sein. Mit Sonnenlichte von sehr großer Dichtigkeit wird das Farbenbild fast noch um die Hälfte länger 7), um aber diese größere Ausdehnung desselben sehen zu können, muß das Licht von dem Raume zwischen C und G verhindert werden, in das Auge zu kommen, weil der Eindruck, den das Licht von den Grenzen des Farbenbildes auf das Auge macht, sehr schwach ist und von dem übrigen verdrängt wird. In A ist eine scharf begrenzte Linie gut zu erkennen; doch ist hier nicht die Grenze der roten Farbe, sondern sie geht noch merklich darüber weg."
7) Wenn ich dies recht verstehe, so bedeutet dies eine Verlängerung noch über I hinaus.
Daß das Sonnenlicht über die rote und violette Grenze des ohne besondere Vorsicht sichtbaren Spektrums hinaus noch Strahlen von geringerer und größerer Brechbarkeit enthält, war schon längst durch die wärmenden Wirkungen der jenseits des Rot und die chemischen Wirkungen der jenseits des Violett liegenden Strahlen bekannt. Von diesen, in gewöhnlichen Spektris unsichtbaren, Strahlen werden die ersten heutzutage nicht selten ultrarote, die letzten ultraviolette oder überviolette genannt.8) Auch kann die Sichtbarkeit der ultravioletten Strahlen durch Fluoreszenz vermöge Verwandlung in minder brechbare erleichtert werden.
8) Helmholtz, von welchem der Name überviolette Strahlen herrührt (Pogg. XCIV, 13), erklärt nicht bestimmt, von wo an er dieselben rechnet, und unstreitig könnte eine Grenze nur konventionell bestimmt werden, da die Nuancen ohne solche in einander übergehen. Nach der (s.o.) gegebenen Tabelle rechnet er eine Wellenlänge 0,0004062, welche nach (s. o.) zwischen G und H liegt, noch zum Violett, und 0,0003808, was sehr nahe der Linie L entspricht, zum Überviolett. Indem nun Fraunhofer das Ende des Violett bei I setzt, würde der Anfang des Überviolett etwa von I oder K an zu rechnen sein, deren Wellenlänge bis jetzt noch nicht bestimmt ist.
Des Näheren nun geht aus den neuen Untersuchungen Folgendes hervor:
1) Die ultravioletten Strahlen können bis zu der Grenze der Brechbarkeit, in der sie überhaupt im Sonnenspektrum vorhanden und durch Fluoreszenz zur Wahrnehmung zu bringen sind, nach den übereinstimmenden Versuchen von Helmholtz 9) und Esselbach 10) auch ohne dieses Hilfsmittel (also ohne Verminderung der Brechbarkeit) mit den Augen wahrgenommen werden, wenn man derartige Maßregeln trifft, daß die ultravioletten Strahlen möglichst vollständig durch die zur Erzeugung und Betrachtung des Spektrums gebrauchten Medien durchgehen, was mit Quarz (Bergkristall) besser als mit Glas der Fall ist 11), und wenn teils die Nachbarschaft des helleren Spektrumteils, wodurch das Auge geblendet wird, teils Beimischung unregelmäßig zerstreuten Lichts zum ultravioletten durch das Prisma regelmäßig gebrochenen Lichte ausgeschlossen wird, ein Zweck, den man im Allgemeinen erreicht 12), wenn man den ultravioletten Teil aus dem mittelst eines Quarzprisma entworfenen Spektrum durch einen Schirm mit Spalte isoliert und durch ein Fernrohr aus Quarzlinsen mit vorgesetztem zweiten Quarzprisma betrachtet.
9) Pogg.XClV, 12. 208.
10) Pogg. XCVIII, 513.
11) Doch ist es Helmholtz auch mit bloßen Glasprismen gelungen (Pogg. XCIV, 1 ff.).
12) Vergl. Helmholtz in Pogg. LXXXVI, 501. XCIV, 1. 205. Berichte d. Berl. Akad. 1855. 757. Esselbach in Pogg. XCVIII, 515.
Hinsichtlich der äußersten ultravioletten Grenze bemerkt Esselbach Pogg. XCVIII, 523); "hinter R ward nur einmal im Laufe des Sommers sehr schwach noch eine Linie S gesehen."
Wenn demnach keine Farben über einen gewissen Grad der Brechbarkeit im Sonnenspektrum vom Auge mehr wahrgenommen werden, so ist der Grund der, daß keine in diesem Spektrum mehr vorhanden sind; und also auf eine an sich für das Auge nach dieser Seite bestehende Grenze der Sichtbarkeit aus Beobachtungen am Sonnenspektrum direkt nicht zu schließen.
Nun hat Stokes 13) die Beobachtung gemacht, daß das elektrische Kohlenlicht ein Spektrum gibt, welches noch viel brechbarere Strahlen enthält, als das Sonnenspektrum, so daß diesem 14) ungefähr noch eine Oktave in der Höhe zugefügt wird. Bis jetzt scheint indes dieses Spektrum nur unter Zuziehung fluoreszierender Substanzen, wodurch sich die Brechbarkeit erniedrigt, beobachtet worden zu sein, und ich finde weder eine Angabe, daß der Teil, welcher durch dies Spektrum dem Sonnenspektrum zugefügt wird, ohne dies Hilfsmittel habe wahrgenommen werden können, noch eine Angabe, welche das Gegenteil ausspricht, so daß also noch durch den Versuch zu ermitteln wäre, ob nicht hier sich eine Grenze der Sichtbarkeit direkt zeigte.
13) Pogg. LXXXIX, 628.
14) Nach Esselbachís Bemerkung in den Ber. d. Berl. Akad. 1855. 760.
So lange man das Dasein der ultravioletten Strahlen nur aus ihren chemischen Wirkungen und durch Fluoreszenz zu erkennen vermochte, lag die Vermutung nahe, daß dieselben unsichtbar wären, weil sie von den Medien des Auges absorbiert würden, und Versuche von Brücke über die Wirkung diffusen weißen Lichts nach seinem Durchgange durch die durchsichtigen Augenmedien auf eine dünne Schicht eingetrockneter Guajaktinktur15) ließen ihn den Schluß ziehen, "daß die Linse die brechbarsten (das Guajak bläuenden) Strahlen in sehr hohem Grade absorbiert, weniger die Kornea und der Glaskörper, am meisten aber die Linse mit diesen beiden Medien zusammen", welchen Versuchen er später noch andere bestätigend zufügte 16), wonach auch die ultravioletten Strahlen eines prismatischen Spektrums nach dem Durchgange durch Linse, Glaskörper und Kornea eines Ochsenauges nicht mehr verändernd auf empfindliches photographisches Papier wirkten, indes die violetten Strahlen noch lebhaft einwirkten. Inzwischen abgesehen davon, daß die Sichtbarkeit der ultravioletten Strahlen durch die obigen Beobachtungen von Helmholtz und Esselbach jetzt direkt konstatiert ist, hat auch Donders 17) nach einer andern Methode entgegengesetzte Resultate als Brücke erhalten, wonach die ultravioletten Strahlen nicht nur überhaupt von den Augenmedien durchgelassen werden, sondern eben so leicht als die brechbareren.
15) Müllerís Arch. 1845. 263.
16) Müllerís Arch. 1846. 379.
17) Müllerís Arch. 1853. 459.
Das Prinzip des Versuches von Donders war dieses:
Wie leicht zu erachten, braucht man, um zu prüfen, ob ultraviolette Strahlen durch die Augenmedien durchgehen, nur ein Spektrum auf einem Schirme zu entwerfen, welcher mit saurer schwefelsaurer Chininlösung (was eine fluoreszierende Substanz ist) bestrichen ist, und zuzusehen, ob die durch Fluoreszenz sichtbar gewordenen ultravioletten Strahlen auch noch sichtbar bleiben, wenn man die durchsichtigen Augenmedien interponiert. Ist es der Fall, so können sie natürlich nicht von diesen Medien absorbiert sein. Donders füllte nun zuvörderst Gläschen verschiedener Größe mit Glaskörpern einiger Rindsaugen und brachte das eine oder andere zwischen den schwefels Chininschirm, zu dem man bloß die Strahlen des Spektrum jenseits des Violett gelangen ließ (damit sie für sich desto besser sichtbar wurden), und zwischen die Lichtquelle. Sie erschienen noch eben so gut und bis zur selben Grenze als ohne diese Zwischeinbringung, nur mit so viel Schwächung, als auch eintrat, wenn man die minder brechbaren Strahlen des Spektrum demselben Versuche unterwarf. Es wurden dann auch noch die andern Medien des Auges, Hornhaut, Linse, Retina, jedes für sich in einem mit Ochsenaugenglaskörper gefüllten Gläschen aufgehangen, so wie auch die ganze vordere Hälfte eines Auges; worin Hornhaut, wässerige Feuchtigkeit, Linse und Glaskörper vereinigt waren, in ähnlicher Weise angewendet, und keine wesentlich verschiedenen Resultate erhalten, nur daß bei Anwendung der Linse und des halben Auges die Erscheinung durch die Linsenwirkung in der Form etwas abgeändert wurde.
Das von Donders erhaltene Resultat ist später von Kessler 18) auch noch auf folgende Weise bestätigt worden. Es wurden prismatische Spektra im dunklen Raume mit allen zur Ausschließung fremden Lichtes erforderlichen Vorsichtsmaßregeln dargestellt, und geprüft, ob solche Individuen, welchen die Kristallinse durch Operation entzogen war, das Spektrum auf seiner brechbarsten Seite bis zu gleicher Ausdehnung wahrnehmen, wie Personen mit normalem Sehapparate. Es stellte sich kein irgend erheblicher Unterschied heraus. Eine Person, welche wegen seitlich verschobener Kristalllinse ein Doppelbild des Spektrum sehen konnte, und zwar unter Zuhilfenahme einer Linse beide Bilder in gleicher Schärfe, sah das Violett in gleicher Ausdehnung.
18) Gräfeís Arch. 1854. S. 466; hier nach Liebig und Kopp Jahresbericht für 1854. S. 188.
2) Von den ultraroten Strahlen gilt nicht dasselbe, als von den ultravioletten; sie haben sich (jenseits der durch die Tabelle (s. o.) bezeichneten Grenze) bis jetzt in keiner Weise für das Auge, sondern überhaupt nur durch ihre erwärmenden Wirkungen, wahrnehmbar machen lassen.
Bei diesen Strahlen kann es jedoch noch als zweifelhaft gelten, ob nicht ihr Mangel an Sichtbarkeit bloß durch eine starke Absorption Seitens der Augenmedien bedingt wird, oder ob eine mangelnde Perzeptionsfähigkeit der Netzhaut dafür mit Anteil hat. Gewiß ist, daß Wasser, Eiweiß und andere durchsichtige Flüssigkeiten von den dunklen Wärmestrahlen verhältnismäßig weniger als von den leuchtenden durchlassen, im Allgemeinen um so weniger, je niedriger die Temperatur der Wärmequelle ist und je dicker die Schicht ist, durch welche die Strahlen zu gehen haben. Jedoch lassen sie von den dunklen ultraroten Strahlen des Sonnenspektrum immerhin einen faktisch nicht unerheblichen Anteil durch. Nach den direkten Versuchen von Franz 19) an den ultraroten Strahlen eines mit einem Flintglasprisma erzeugten Sonnenspektrum, welches sein Wärmemaximum im Rot hatte, wurde durch Interposition einer (zwischen Glasflächen enthaltenen) Wasserschicht von 63 Mill. Dicke die Temperatur der dem Rot nächsten dunklen ultraroten Zone (jede Zone von 3 Mill. Breite) bloß von 11,81 auf 5,93, die der folgenden von 8,77 auf 1,66, die der dritten von 6,11 auf 0,83 20) erniedrigt, indes die Erniedrigung für das Rot selbst von 15,11 auf 10,00 ging. (Noch weniger betrug die Reduktion im dunklen Teile bei Kochsalzlösung oder Alkohol statt Wasser.) Wonach es schwer fällt, sich zu denken, daß die wesentlich wässerigen und eiweißartigen Augenmedien bei ihrer viel geringeren Dicke nichts Erhebliches von den ultraroten Strahlen durchlassen sollten, da zumal nach Melloniís Angabe 21) Eiweiß von Wasser in der Dia-thermanität nicht wesentlich abzuweichen scheint, und in einem Flintglasspektrum die ultraroten Strahlen durch Absorption Seitens des Glases schon reduziert sind. Und hiernach würde allerdings eine mangelnde Empfindlichkeit der Netzhaut für ultrarote Strahlen als Grund ihrer Unsichtbarkeit mit in Anspruch zu nehmen sein; jedoch wird es erst noch direkter Versuche über die Durchgängigkeit der Augenmedien für ultrarotes Licht bedürfen, um in dieser Beziehung ein sicheres Urteil fällen zu können.
19) Pogg. Cl, 51.
20) Die Zahlen sind Grade des Thermomultiplikators.
21) Pogg. XXXV, 282.
Allerdings hat Brücke 22) direkte Versuche angestellt, nach welchen durch Hornhaut und Linse eines frischen Ochsenauges, einzeln oder in Verbindung angewandt, nichts für den Thermomulti-plikator Merkliches von der dunklen Wärme durchstrahlte, welche von einem durch eine Öllampe ziemlich hoch, doch bei Weitem nicht zum Glühen erhitzten schwarzen Eisenblechzylinder herrührte, indes das freie Licht der Lampe durch die Hornhaut allein 8° bis 9°, durch die Linse allein 11/2° (durch beide zusammen Nichts) gab, und indes eine Wasserschicht von 18 Mill. Dicke zwischen Glimmerplatten von der Linse gleichem Querschnitte und ein Kalkspatkristall von 3,7 Mill. Dicke mit einander kombiniert 2° bei Durchstrahlung der dunklen Wärme gaben. Allein von dunkler Lampenwärme läßt sich kein bindender Schluß auf Sonnenwärme machen, als welche in anderen Verhältnissen aus wärmenden und leuchtenden Strahlen zusammengesetzt ist. Und ein späterer Versuch von Brücke 23) mit Sonnenlicht kann ohne genauere Untersuchung der Wirkungsweise der dabei mit zugezogenen dünnen Rußchicht, durch welche die Strahlen zu dringen hatten, ebenfalls nicht als hinreichend beweisend gelten.
22) Müllerís Arch. 1845. 271.
23) Müllerís Arch. 1846. 382.
3) Nach der Bestimmung von Helmholtz 24) beträgt der ganze, ohne Hilfe von Fluoreszenz sichtbare, Teil des Sonnenspektrum vom äußersten Rot bis zum äußersten Violett, bei Anwendung aller Maßregeln, welche die direkte Sichtbarkeit erleichtern können, etwa eine Oktave plus einer Quarte (s. o.); und zwar ist nach Helmholz die Wellenlänge des äußersten sichtbaren Rot (bei einem Spektrum, von dem alles Licht mit Ausnahme des äußersten Rot durch Anwendung von zwei Prismen und zwei Schirmen abgeblendet war) 0,0008124 Mill., die des äußersten Ultravioletts 0,0003047; wo zwischen sich die von Esselbach bestimmten Wellenlängen der dunklen Linien in der (s. o.) angegebenen Weise einreihen.
24) Berl. Ber. 1855. 760.
4) Die neuesten Versuche von J. Müller 25) führten denselben zuerst zu dem Resultate, daß die Wellenlänge der äußersten ultraroten Strahlen des Sonnenspektrum 0,00183 Mill. sei, später nach einer anderen Berechnungsweise, daß sie 0,0048 Mill. sei. Und sofern die Wellenlänge der äußersten ultravioletten Strahlen 0,0003047 Mill. ist, würde ersteres etwas über 21/2, letzteres gar 4 Oktaven für die Ausdehnung des ganzen Sonnenspektrum, den sichtbaren und unsichtbaren Teil zusammengenommen, geben. Indes teils die mangelnde Homogeneität des zu den Versuchen dienenden Spektrum, teils der Zweifel über die Triftigkeit des zur Berechnung angewandten Princips 26) lassen beide Angaben noch zweifelhaft erscheinen.
25) Pogg. CV, 337. 543.
26) Vgl. hierüber die Bemerkungen von E. Eisenlohr in Pogg. CIX, 340.
5) Man konnte fragen, ob die Sichtbarkeit des ultravioletten Spektrumteiles ohne künstliche Zuhilfenahme der Fluoreszenz nicht vielleicht bloß darauf beruhe, daß die Netzhaut selbst durch eine fluoreszierende Eigenschaft solche in minder brechbare Strahlen verwandele, da zumal die ultravioletten Strahlen eine blaue Farbe zeigen?
Helmholtz 27) hat diese Frage zuerst an der Netzhaut eines vor 18 Stunden gestorbenen Mannes untersucht, und gefunden, daß die Netzhaut allerdings durch eine ihr zukommende schwache Fluoreszenz das auf sie fallende ultraviolette Licht in ein Strahlengemisch von nicht ganz reiner (grünlich blauer) weißer Farbe verwandelt, welches außer einem verhältnismäßig großen Anteile unveränderten ultravioletten Lichtes auch die weniger brechbaren Strahlen des Spektrum (mit Ausnahme des Rot) enthält, daß aber diese schwache Fluoreszenz (schwächer, als bei Papier, Leinewand und Elfenbein, stärker als bei Porzellan), nicht hinreicht, die Sichtbarkeit der ultravioletten Strahlen von Fluoreszenz abhängig zu halten.
27) Pogg. XCIV, 205.
"Die ziemlich gesättigte blaue Farbe der übervioletten Strahlen für das lebende Auge und die fast ganz weiße Farbe des dispergierten Lichtes der toten Netzhaut waren, sagt er, zu verschieden. als daß die Ansicht haltbar wäre, daß die Netzhaut die übervioletten Strahlen nur nach ihrer Verwandlung in minder brechbares Licht empfinde."
Setschenow 28) hat an der frischen Netzhaut von Kaninchen- und Ochsenaugen die von Helmholtz erhaltenen Resultate bestätigt gefunden. Außerdem untersuchte derselbe auch die durchsichtigen Medien derselben Tieraugen auf ihre Fluoreszenz im ultravioletten Lichte. Der Glaskörper zeigte nur Spuren Fluoreszenz, die Linse dagegen fluoreszierte stark weißblau, die Cornea viel schwächer, aber in derselben Weise, die wässerige Feuchtigkeit gar nicht. Auch am Auge des lebenden Menschen läßt sich diese Fluoreszenz nachweisen, wenn man das Auge in den Brennpunkt der ultravioletten Strahlen des vom Verf. angewandten Apparates bringt. Cornea und Linse fangen dann an, mit weißblauem Lichte zu schimmern, und zwar die Cornea viel stärker, als im ausgeschnittenen Zustande.
28) Gräfe Arch. 1859. V, 206.
Inzwischen kann diese Fluoreszenz der durchsichtigen Augenmedien nichts beitragen, den ultravioletten Teil des Spektrum sichtbar zu machen, sondern eher, diese Sichtbarkeit zu hindern, weil die durchsichtigen Medien das Licht, welches die Fluoreszenz in ihnen erleidet, nach allen Seiten zerstreuen, dispergieren, als wenn sie selbstleuchtend wären; so daß mittelst dieses dispergierten Lichtes kein Bild des ultravioletten Spektrumteils im Auge erzeugt werden könnte.
Nach Vorstehendem kann es noch nicht als durch Erfahrung direkt entschieden gelten, daß überhaupt Grenzen der Perzeptionsfähigkeit der Netzhaut für Farben mit zu schnellen und zu langsamen Schwingungen statt finden, indem sich nach dem, was (s. o.) mitgeteilt ist, die brechbarsten (ultravioletten) Strahlen des Sonnenspektrums noch haben direkt wahrnehmen lassen, und nach der Erörterung (s. o.) die Möglichkeit noch nicht ganz ausgeschlossen ist, daß die mindest brechbaren (ultraroten) Strahlen bloß deshalb unsichtbar sind, weil sie nicht in hinreichender Menge durch die Augenmedien durchzudringen vermögen, um sichtbar zu sein.
Dessen ungeachtet bleibt eine verschiedene Perzeptionsfähigkeit der Netzhaut der Art, daß Farbestrahlen von gleicher lebendiger Kraft bei verschiedener Schwingungszahl oder Wellenlänge mit ungleicher Leichtigkeit oder Stärke empfunden werden, und über gewisse Grenzen hinaus gar nicht perzipiert werden, überwiegend wahrscheinlich, einmal, weil die Wirkung der Fluoreszenz unter keiner anderen Voraussetzung erklärbar scheint, zweitens, weil man zur Erklärung der abweichenden Verteilung der Wärme und Helligkeit im prismatischen Spektrum nur die Wahl hat, eine wesentliche Verschiedenheit zwischen dem Prinzipe des Lichts und der Wärme oder eine verschiedene Empfindlichkeit der Netzhaut für Strahlen von verschiedener Brechbarkeit zu statuieren; wovon erstere durch die neueren Untersuchungen mehr und mehr unwahrscheinlich geworden ist, wogegen letztere nach allgemeinen Gesetzen der Schwingungsmitteilung vielmehr die Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Über diese Punkte soll noch in etwas nähere Erörterung eingegangen werden.
Was den ersten anlangt, so ist Tatsache, daß die ultravioletten Strahlen, wenn auch der Vermittlung der Fluoreszenz zur Sichtbarkeit nicht notwendig bedürfend, doch leichter gesehen werden, wenn sie durch Fluoreszenz aus brechbareren in minder brechbare Strahlen verwandelt werden, ungeachtet sich nicht annehmen läßt, daß die lebendige Kraft durch Fluoreszenz vergrößert wird.
So faßt es auch Helmholtz 29), indem er von den ultravioletten Strahlen bemerkt, ihre "objektive Helligkeit" sei nicht so gering, als man nach ihrer geringen Wirkung auf das Auge schließen möchte; dies beweise sich durch die Fluoreszenz, "und obgleich die lebendige Kraft der Lichtschwingungen durch den Prozess der Fluoreszenz gewiß nicht vermehrt werde, affiziere das durch sie erzeugte Licht von längerer Schwingungsdauer die Netzhaut lebhaft genug, um gesehen zu werden."
29) Pogg. XCIV, 13.
Nun ließ sich allerdings denken, die Erleichterung der Sichtbarkeit durch Fluoreszenz beruhe darauf, daß die Strahlen innerhalb des gewöhnlich sichtbaren Spektrum leichter durch die Augenmedien durchgingen, als die ultravioletten, und die Versuche Brückeís (s. o.) schienen dies sogar direkt zu beweisen, indes widersprechen ihnen sehr bestimmt die (s. o.) mitgeteilten Beobachtungen von Donders und Kessler.
Um den zweiten Punkt zu erörtern, wird es zuvörderst gelten, die nach mehreren Beziehungen für uns wichtige Verschiedenheit in der Verteilung von Licht und Wärme im Spektrum zu konstatieren und, so weit es nach bisherigen Untersuchungen möglich ist, näher zu bestimmen.
Das Maximum der Leuchtkraft des Sonnenspektrum,
was durch ein Prisma aus irgend einer farblosen durchsichtigen Substanz
erzeugt ist, liegt bekanntlich im Gelb zwischen den Linien D und
E 30), und die Verteilung
der Intensität ist von Fraunhofer 31)
an einem mit einem Flintglasprisma erzeugten Spektrum aus homogenen Strahlen
bestimmt worden. Die von ihm angegebenen Zahlen drücken jedoch nicht
das wahre Intensitätsverhältnis der im Sonnenlichte enthaltenen
Farbenstrahlen aus, weil dieselben im brechbareren Teile des prismatischen
Spektrum verhältnismäßig mehr auseinandergezogen und dadurch
mehr verdünnt sind, als im minder brechbaren, was sich anders in dem
durch Interferenz erzeugten Fraunhoferíschen Gitterspektrum 32)
verhält, wo der Abstand jeder Farbe von dem mittleren weißen
Streifen proportional der zugehörigen Wellenlänge ist. Um die
wahren Intensitätsverhältnisse der Farben im Sonnenlichte zu
haben; müssen daher die Intensitäten des prismatischen Spektrum
erst auf diejenigen reduziert werden, welche im Gitterspektrum dafür
eintreten würden. Diese Reduktion ist von A. Seebeck 33)
mit Hilfe einer Interpolation nach den relativen Abständen
der dunklen Linien in beiden Spektris vorgenommen. Hiernach stellen sich
die Lichtintensitäten des prismatischen Spektrum nach Fraunhofer und
die danach von Seebeck berechneten des Gitterspektrum für die den
dunklen Linien entsprechenden Stellen des Sonnenspektrum wie folgt: 34)
|
Linien |
|
in Mill. |
|
|
|
|
||
| B | 0,032 | 0,02 | 0,0006878 |
| C | 0,094 | 0,06 | 6564 |
| D | 0,64 | 0,57 | 5888 |
| Maxim. | 1,00 | 1,00 | |
| E | 0,48 | 0,56 | 5260 |
| F | 0,17 | 0,28 | 4843 |
| G | 0,031 | 0,08 | 4291 |
| H | 0,0056 | 0,02 | 3929 |
30) "Der hellste Ort ó sagt Fraunhofer
ó Siegt um ungefähr 1/3 oder 1/4 der Länge
DE von D nach E zu. Genau ist die Lage des Ortes nicht
anzugeben."
31) Gilb. LVI, 301.
32) Denkschr. d. Münch. Akad. VIII.
33) Pogg. LXII, 374.
34) Die Intensitätskurve des prismatischen Spektrum nach Fraunhofer findet man bei den Abbildungen desselben (vgl. S. 239) mit verzeichnet; die des daraus abgeleiteten Gitterspektrum nach Seebeck in Pogg. LXII, Taf. III, Fig. 4.
Wohl zu merken bedeuten die Zahlen für die Intensitäten in dieser Tabelle nicht Intensitäten der Empfindung, welche von den verschiedenen Spektrumfarben hervorgerufen werden, sondern objektiv gemessene Intensitäten weißen Lampenlichtes, mit welchen die verschiedenen Stellen des Spektrum von gleich starkem Eindrucke auf das Auge gefunden wurden; ein Vergleich, der allerdings etwas schwierig ist, aber doch durch geeignete Versuchsmaßregeln und Übung, welche, wie Fraunhofer bemerkt, den Vergleich ungemein erleichtert, möglich geworden ist, und freilich nur eine mäßige Sicherheit erlangt hat, wovon sich nach dem Grade der Übereinstimmung der einzelnen Beobachtungen (Gilb. LVI, 301) urteilen läßt, und wonach für die größeren Intensitäten sich die Bestimmung verhältnismäßig sicherer findet, als für die kleineren.35)
35) Für die
Linien D, E, F mit einer Summe der Intensitäten = 1,29
findet sich die einfache Fehlersumme nach je 4 Versuchen an jeder Linie
im Ganzen 0,676, für die Linien B, C, G, H mit einer Summe
der Intensitäten 0,163 im Ganzen 0,228.
Melloni, indem er in einer Abhandlang (Pogg. LXII, 24) ebenfalls der Notwendigkeit gedenkt, die direkt beobachteten Lichtintensitäten des Newtoníschen Spektrum erst auf die des Gitterspektrum zu reduzieren, um die richtigen Verhältnisse der Leuchtkraft der verschiedenen Farbenstrahlen im Sonnenlichte zu erhalten, macht dabei folgende Mittheilung.
"Um diese Verhältnisse zu erhalten, hat Hr. Prof. Masotti die Data berechnet, die beitragen zur Bildung der Gitterspektra, worin die Elementarfarben sich vermöge einer bloßen Interferenz neben einander ausbreiten, und sonach Räume einnehmen, die alleinig von ihrer Vibrationsperiode oder Unduationslänge abhängen. Für diese, von dem angedeuteten Mangel freien, Spektra hat Hr. Masotti den hellsten Punkt genau in der Mitte des Gelb gefunden, und diese wiederum in gleichem Abstande von beiden Enden, so daß die rote und die violette Grenze die mindest hellen Punkte des Spektrum sind und beide gleiche Lichtstärke haben. Herr Masotti hat endlich bewiesen, daß die Farben dieser beiden Grenzen aus Ätherwellen bestehen, deren Lange in dem Verhältnisse 2 : 1 stehen."
Leider ist weder angegeben, wo sich die Masottiísche Arbeit findet, noch auf welche Data sich dieselbe stützt. Ihr Resultat weicht insofern etwas von dem Seebeckíschen nach Fraunhoferíschen Datis ab, als dieser eine gleiche Intensität für Farben findet, deren Wellenlänge im Verhältnisse 1: 1,75 stehen, indes Masotti dafür das Verhältnis 1 : 2 gibt.
Was die Verteilung der Wärme im prismatischen Spektrum anlangt, so ist die Lage des Wärmemaximum veränderlich teils nach der Substanz der Prismen, durch welche man das Spektrum erzeugt, teils nach der Dicke des Prisma, durch welche die Strahlen hindurchgehen, teils nach der Homogeneität oder Nichthomogeneität des Spektrum, teils endlich nach der Natur der etwa auf dem Wege der Strahlen noch interponierten durchsichtigen Substanzen. Bei Anwendung eines mit Wasser, Alkohol oder Terpentinöl gefüllten Hohlprisma hat man es im Gelb gefunden, bei Glasprismen je nach der Glasart und anderen Umständen im Orange, Rot oder jenseits des sichtbaren Rot (im Ultrarot), mit einem Steinsalzprisma stets jenseits des Rot. Diese Veränderlichkeit hängt wesentlich davon ab, daß die ultraroten dunklen Wärmestrahlen von den durchsichtigen Substanzen, aus denen die Prismen bestehen, in anderem und zwar stärkerem Verhältnisse absorbiert werden, als die sichtbaren, daß sich dies Verhältnis nach der Verschiedenheit der durchsichtigen Substanzen und der Dicke, durch welche die Strahlen durchzugehen haben, ändert, und daß bei einem nicht homogenen Spektrum (erzeugt durch einen Spalt von irgends erheblicher Breite) dunkle Wärmestrahlen, welche eigentlich dem Ultrarot angehören, mit in den sichtbaren Teil des Spektrum übergreifen, welche dann je nach der Verschiedenheit der Substanz des Prisma mehr oder weniger absorbiert werden.
Nach Melloniís Versuchen ist aber das Steinsalz eine Substanz, welche die dunklen und sichtbaren Wärmestrahlen gleich leicht durchläßt; und um maßgebende Bestimmungen über die Wärmeintensität des ganzen Spektrum zu haben, sowohl seinem dunklen als hellen Teile nach, muß man daher ein Steinsalzprisma zur Entwerfung des Spektrum anwenden, was nicht so wesentlich ist, wenn es sich bloß darum handelt, die Wärmeintensität im sichtbaren Teile des Spektrum vom Violett zum Rot zu erhalten, da nach den unten mitzuteilenden Daten die verschiedensten durchsichtigen Substanzen eine gleiche Durchgängigkeit für alle Strahlen dieses Spektrumteils zeigen. Außerdem müßte, streng genommen, eine Homogeneität des Spektrum statt finden, für welche das Dasein der dunklen Linien als charakteristisch gilt. Da man aber hierzu ein sehr schmales Lichtbündel anwenden muß, so sind die Wärmewirkungen eines solchen Spektrum bisher zu schwach ausgefallen, um Messungen zugänglich zu sein 36), so daß man noch keine reinen und auf bestimmte dunkle Linien bezogene Intensitätsbestimmungen der Wärme des Spektrum hat.
36) Vergl. Franz in Pogg. CI, 50. J. Müller in Pogg. CV, 339.
Wenn man sich aus Helmholtzís gegen Brewster geführter Untersuchung (Pogg. LXXXVI, 501) erinnert, welche wichtige Irrungen das von Unreinigkeiten der Substanz, unvollkommener Politur des Prisma, und mehrfachen Reflexionen zwischen den Flächen des Prisma abhängige diffuse Licht in die Beurteilung der Farbenverhältnisse des Spektrum bringen kann, und in Betracht zieht, daß dasselbe bei einem, mit bloß einem Spalt und bloß einem Prisma erzeugten Spektrum, wie es den bisherigen Untersuchungen über die Wärmeverhältnisse des prismatischen Spektrum untergelegen hat, gar nicht ausschließbar ist, am wenigsten bei einem Steinsalzprisma, welches nicht leicht von so vollkommener Politur, und so rein als ein Glasprisma zu erhalten ist, so kann auch hierin eine beachtenswerte Ursache der Unreinheit des Spektrum und der daran erhaltenen Resultate gesucht werden, indessen scheint doch, so viel ich übersehen kann, hieraus nur eine nahehin gleichförmige Abänderung der Temperatur des sichtbaren Spektrumteils, aber kein Einfluß auf die Lage des Maximum hervorgehen zu können.
Indessen sind folgende Data anzuführen. Unter Anwendung eines Steinsalzprisma liegt das Maximum der Wärmeintensität jedenfalls erheblich jenseits der sichtbaren Grenze des Rot im Ultrarot.
Nach einer früheren Angabe Melloniís (Pogg. XXVIII, 377), "liegt es so weit vom roten Ende entfernt, daß der Abstand zwischen ihm und dem Rot eben so groß war, als der Abstand zwischen dem Rot und dem Violett als die ganze Länge des Spektrum." Nach einer späteren Angabe desselben (Pogg. XXXV, 307) ist der Abstand des Wärmemaximum vom roten Ende wenigstens so groß, wie der des Grünblau vom Rot, darauf nimmt die Intensität rasch ab, und in einer Entfernung von dieser Stelle, welche einem Drittheile der Länge des Farbenspektrum gleich ist, hört alle merkliche Wärmewirkung auf. Nach einer dritten Angabe endlich (Pogg. LXII, 22) findet Melloni das Wärmemaximum "ganz abgesondert von den Farben in einer mittleren Entfernung gleich derjenigen, die, nach entgegengesetzter Seite, zwischen dem Rot und Gelb vorhanden ist." Die neuen Beobachtungen von J. Müller 37) ergaben ein, mit der zweiten dieser Angaben hinsichtlich der Maximumlage übereinstimmendes Resultat, d. i. "den Abstand des Maximum von der Grenze des Rot ungefähr eben so groß wie den Abstand des Überganges von Grün zu Blau von der roten Grenze des Spektrum die thermische Verlängerung des Sonnenspektrum über das Rot aber einen Raum einnehmend, welcher nahezu eben so lang war, als das ganze gewöhnlich sichtbare Spektrum zum Violett. Außerdem fand er, daß ein Crownglasprisma in dieser thermischen Verlängerung mit dem Steinsalzprisma übereinstimmte, aber ein näher an Rot liegendes Maximum gab. Die Linie B lag bei dem Crownglasspektrum ungefähr in der Mitte zwischen dem violetten Ende des Spektrum und den äußersten dunklen Wärmestrahlen desselben
Maßbestimmungen über die
Intensität in den einzelnen Teilen des (freilich nicht homogenen)
Spektrum haben Franz 38) und
J. Müller 39) gegeben, der erstere
unter Anwendung eines Flintglasprisma und Interposition einer Glasflasche,
um vergleichende Versuche mit und ohne Transmission der Strahlen durch
Flüssigkeiten anzustellen, der zweite unter vergleichender Anwendung
eines Crownglas- und eines Steinsalzprisma. Unter Anwendung des Steinsalz-prisma
fand der Letztere folgende Intensitäten der Wärme (Kräfte,
womit sie auf den Thermomultiplikator wirkt), wobei die Angabe 1"', 2'"
u. s. w. für das Ultrarot den Abstand von dem sichtbaren roten Ende
bezeichnet.
37) Pogg. CV, 352.38) Pogg. CI, 46.
39) Pogg. CV, 337. 543.
Mitte von
Ultrarot
--------------------- ----------------------------------------
Blau Gelb Rot
1''' 3''' 4'''
6'''
3,7 7,9
10,0 13,2 15,9
13,2 1,7
Mit dem Crownglasprisma wurden (wegen größerer Reinheit dieses Prisma) im sichtbaren Teile des Spektrum absolut stärkere, aber merklich gleiche, Verhältnisse für die verschiedene Farben zeigenden Zahlen erhalten, nämlich (bei Reduktion auf den gleichen Wert bei Rot)
Mitte von
Ultrarot
------------------ -------------------------------------
Blau Gelb Rot
1'" 2"'40)
4"' 6"'
4 7
10 12
11 7
2
indes, wie man sieht, die Verhältnisse im unsichtbaren Ultrarot sehr von denen des Steinsalzprisma abwichen. 41)
40) Beim Steinsalzprisma steht hier 3'". Wahrscheinlich ist 2'" verdruckt.
41) Die vergleichenden Kurven des Steinsalz- und Crownglasprisma s. Pogg. CV, Taf. III, Fig. 1.
Auch bei diesen, an einem prismatischen Spektrum gemachten, Bestimmungen ist nun aber in Rücksicht zu ziehen, daß die Wärmestrahlen im brechbareren Teile des Spektrum mehr verdünnt sind, und also, um ihr wahres Intensitätsverhältnis, in dem sie im Sonnenstrahle enthalten sind, zu haben, erst eine Reduktion auf das Gitterspektrum nötig, wie sie von Seebeck bezüglich der Helligkeit statt gefunden hat. Nach einer solchen Reduktion eines prismatischen Steinsalzspektrum findet J. Müller das Maximum der Intensität der Wärme, eben so wie es für das Licht gilt, im Gelb liegend, und diese Bestimmung erhält um so mehr Gewicht dadurch, daß Draper 42) schon früher dasselbe durch direkte Versuche an einem ohne Zuziehung dioptrischer Medien durch Reflexion erzeugten Gitterspektrum gefunden. Jedoch wird damit die Verteilung der Wärme im Spektrum keineswegs übereinstimmend mit der Verteilung der Helligkeit (wie Draper annimmt), wie schon von selbst daraus folgt, daß die Helligkeit, aber nicht die Wärme jenseits des Rot verschwindet; und auch aus dem Vergleiche von Seebeckís Helligkeitskurve (s. o.) mit Müllerís Wärmekurve für das Gitterspektrum 43) hervorgebt, worauf unten zurückzukommen.
42) Philos. mag. 1857. XIII, 153.
43) Pogg. CV, Taf. III, Fig. 4.
Fragt man nun nach dem Grunde dieser verschiedenen Verteilung von Licht und Wärme im Spektrum, so liegt es auf der Hand, daß, wenn man Licht und Wärme als wesentlich verschiedene Agentien ansieht, nichts hindert, zu denken, daß die Intensitäten des Lichtes und der Wärme von gleicher Brechbarkeit im Spektrum einander nicht proportional gehen. Inzwischen kann die Ansicht der wesentlichen Identität von Licht und Wärme, wenn auch noch nicht als schlechthin erwiesen gelten, doch nur noch schwachen Zweifeln begegnen, und jene Verschiedenheit der Verteilung von Licht und Wärme im Spektrum eben deshalb keinen bindenden Gegengrund dagegen geben, weil sie teils von verschiedener Durchgängigkeit der Strahlen verschiedener Brechbarkeit durch die Augenmedien, teils verschiedener Empfindlichkeit der Netzhaut dafür abhängig gemacht werden kann.
Melloni, der die ausgedehntesten Untersuchungen in diesem Felde angestellt hat, nachdem er sieh früher gegen die Identität von Licht und Wärme erklärt 44) und mehrere Tatsachen als entschiedene Beweise dagegen angeführt hatte, ist durch spätere Untersuchungen selbst dahin gelangt, alle von ihm beobachteten Tatsachen mit der Identitätsansicht vereinbar zu halten, und hat sich eben so entschieden für diese Ansicht erklärt.45) Nicht minder pflichten Masson und Jamin 46) nach ihren Versuchen dieser Ansicht bei.
44) Pogg. XXXVII, 486.
45) Pogg. LVII, 300. LXII, 18, so wie sein Werk: "La thermochrose 1850. 327."
46) Compt. rend. XXXI, 14.
Alle neueren Tatsachen zusammengefaßt, scheint sich in der Tat der ganze Unterschied der dunkeln, durch kein Mittel sichtbar zu machenden, Wärmestrahlen von sichtbaren Strahlen darauf zu reduzieren, daß jene eine geringere Brechbarkeit und mithin Vibrationsschnelligkeit, größere Undulationslänge, besitzen, womit eine geringere Durchgängigkeit durch die meisten Medien in Beziehung steht; und es scheint nicht, daß Strahlen von identischer Brechbarkeit noch als Licht- und Wärmestrahlen unterschieden werden können. Nicht nur befolgen die dunklen Wärmestrahlen die allgemeinen Gesetze der Fortpflanzung, Reflexion, einfachen und Doppelbrechung, Polarisation, Interferenz, Absorption des Lichts, sondern Melloni 47) findet auch neuerdings, "daß die Farben des Spektrum so innig an ihre Temperatur geknüpft seien, daß sie beim Durchgange durch nicht ganz klare Substanzen eben so viel Wärme als Licht verlieren, so daß das Verhältnis dieser beiden Agentien immer ungestört dasselbe bleibt."
47) Pogg. LXII, 28.
Auf dasselbe führen die neuen Untersuchungen von Franz 48) über die Diathermansie gefärbter Flüssigkeiten. "Überall, wo eine Absorption des Lichtes erkennbar ist, ist auch eine Abnahme der Wärmeintensität nachweisbar. .... Das Minimum des Lichtverlustes bei Strahlung des Spektrum durch eine Flüssigkeit muß ó so schließt er seine Abhandlung ó mit dem Minimum des Wärmeverlustes in derselben Zone beobachtet werden, sonst ist die Identität von Wärme und Licht unmöglich. In der Tat zeigen die blauen Lösungen von schwefelsaurem Kupferoxyd das Minimum des Warmeverlustes nach der Strahlung eines Spektrum durch dieselben in der blauen Zone, die grünen Lösungen von schwefelsaurem Eisenoxydul in der grünen Zone. Bei Anwendung von roten Lösungen zeigt sich, daß von allen durch rote Lösungen dringenden farbigen Strahlen die roten Strahlen am wenigsten Licht und Wärme verlieren, zum Teil sind aber rote Lösungen für dunkle Wärme von geringerer Brechbarkeit als das Rot diathermaner als das Wasser."
48) Pogg. CI, 46.
Was für den ersten Anblick der Identitätsansicht gänzlich entgegen scheint, und von Melloni früher (Pogg. XXXVII, 486) als schlagend dagegen geltend gemacht wurde, ist der oben berührte Umstand, daß, je nachdem man ein Prisma aus Steinsalz, Flintglas, Crownglas, Wasser anwendet, oder auch das durch ein Steinsalzprisma erzeugte Spektrum durch dieses oder jenes durchsichtige Medium oder verschieden dicke Schichten desselben Medium hindurchstrahlen läßt, sich die Lage des Wärmemaximum und die Wärmeverteilung überhaupt, mithin das Intensitätsverhältnis der Wärmestrahlen des Spektrum ändert, während das Intensitätsverhältnis der Farbenstrahlen ungeändert bleibt; widrigenfalls diese Substanzen farbig im durchgehenden Lichte erscheinen müßten. Aber nach den späteren Versuchen Melloniís49) gilt dies bloß für nichthomogene Spektra, in denen sich dunkle Wärmestrahlen noch den farbigen Strahlen am roten Ende beigemischt finden; wogegen er "bei möglichster Vermeidung aller Fehlerquellen .... die Temperaturen der prismatischen Farben beständig die höchste Temperatur am roten Ende behaupten sah, von welcher Beschaffenheit die farblose Substanz auch sein mochte, die man anwendete, entweder in Prismenform, um das Sonnenlicht in seine Elementarstrahlen zu zerlegen, oder in Plattenform, um die absorbierenden Wirkungen des Körpers auf diese Strahlen zu erforschen."
49) Pogg. LVII, 302. LXII, 28.
Nicht minder ziehen Masson und Jamin 50) aus ihren Untersuchungen den Schluß, daß durch Steinsalz, Bergkristall, Alaun, Glas und Wasser alle Wärmestrahlen zwischen Rot und Violett gleichmäßig hindurchgehen, also die beträchtlichen Unterschiede in der Diathermanität dieser Substanzen nur in der verschiedenen Absorption der dunklen Strahlen ihren Grund haben. Endlich sind auch die obigen Resultate der vergleichenden Versuche von J. Müller mit einem Crownglas- und Steinsalzprisma 51) in demselben Sinne. Wonach diese Verhältnisse anstatt Gegenbeweise gegen die Identitätsansicht zu liefern, vielmehr zu den wichtigsten Beweisen für dieselbe zu zählen sind.
50) Compt. rend. XXXI, 14.
51) Pogg. CV, 349. 351.
So viel ich übersehe, liegt nur noch eine Klasse von Tatsachen vor, welche schwierig mit der Identitätsansicht vereinbar scheint, daß es nämlich Licht von erheblicher Leuchtkraft gibt, oder durch besondere Verfahrungsweisen hergestellt werden kann, was eine kaum merkliche oder gar keine merkliche Wärmewirkung zeigt. Schon das Mondlicht ist Licht, dessen Wärme nur durch die empfindlichsten Apparate nachgewiesen werden kann. Besonders frappant aber ist folgender Versuch, welchen Melloni 52) früherhin als einen Kardinalversuch gegen die Identitätsansicht angeführt hat, bezüglich auf den Durchgang von Sonnenlicht, so wie irdischem Feuerlicht durch ein System, bestehend aus einer Wasserschicht zwischen Glasplatten, die durch Kupferoxyd grün gefärbt sind.
52) Pogg. XXXVII, 486.
"Das reine Licht, sagt Melloni, welches zu diesem Systeme ausfährt, viel Gelb enthält, aber dennoch eine blaugrüne Farbe besitzt, wirkt nicht wärmend auf die empfindlichsten Thermoskope, selbst wenn man es durch Linsen so konzentriert, daß es eben so glänzend ist, wie das dunkle Sonnenlicht."
Es ist zu bedauern, daß Melloni nach seiner Bekehrung zur Identitätsansicht nicht auf die Diskussion dieses, von ihm überhaupt nur kurz angeführten Versuches zurückgekommen ist, eben so wenig ist er meines Wissens bis jetzt von Anderen wiederholt worden, wenn schon er überall als ein Haupteinwand gegen die Identitätsansicht angeführt wird; nur muß man eben daraus, daß er Melloni nicht gehindert hat, sich später zur Identitätsansicht zu wenden, schließen, daß ihm dieser Versuch später nicht mehr so beweisend erschienen ist, wie früher.
Durchschlagend gegen die Identitätsansicht könnten derartige Tatsachen überhaupt nur sein, wenn sie von, auf die Frage besonders gerichteten, Maßbestimmungen begleitet wären, wie solche aber bis jetzt nicht vorliegen. Denn hinreichend erwiesen ist jedenfalls, daß die Wärme des Sonnenlichtes so wie der irdischen Feuer zum bei Weitem größten Teile aus dunkler Wärme besteht, welche durch durchsichtige Medien leichter absorbierbar ist, als durch sichtbare, so daß, wenn man alle dunklen Strahlen und noch überdies einen großen Teil der leuchtenden absorbiert hat, wie es in Melloniís Kardinalversuche geschah, der Rest nur noch eine sehr geringe Wärmewirkung überhaupt äußern kann; wenn schon es immer unerwartet bleibt, daß sie auch nach Konzentrierung durch eine Linse bis zu starker Leuchtkraft nicht sollte haben bemerklich werden können. Jedenfalls ist bei dem übrigen Genügen der Identitätsansicht auf einzelne widersprechende, nicht gehörig konstatierte und aus Mangel an Maßbestimmungen nicht gehörig diskutierbare Tatsachen um so weniger großes oder gar entscheidendes Gewicht zu legen, als der Urheber derselben selbst später ein solches nicht mehr darauf gelegt hat.
Kann nun Vorstehendem zufolge die ungleiche Verteilung des Lichtes und der Wärme im Spektrum nicht mit Wahrscheinlichkeit von einer Nichtidentität des Lichtes und der Wärme abhängig gemacht werden, so ließe sich von anderer Seite denken, daß durch die ungleiche Absorption der Strahlen verschiedener Brechbarkeit Seitens der Augenmedien ein anderes Intensitätsverhältnis der im Auge als leuchtend wahrgenommenen als der außerhalb des Auges thermometrisch gemessenen Teile des Spektrum entstände. Eine solche ungleiche Absorption findet nun auch unstreitig statt, wenn man die sichtbaren und unsichtbaren Wärmestrahlen vergleicht, und ist in Rücksicht zu ziehen. Allein nach den oben erwähnten Versuchen von Melloni, Masson, Jamin und J. Müller findet innerhalb des sichtbaren Teiles des Spektrum vom Violett zum Rot keine ungleichförmige Absorption verschiedener Farbestrahlen durch farblos durchsichtige Medien statt; oder wenigstens ist eine solche insofern ganz unwahrscheinlich, als die verschiedensten durchsichtigen Medien bei sehr ungleicher absoluter Absorptionsfähigkeit für die Wärme doch gleiche Wärmeverhältnisse der hindurchgehenden Spektrumstrahlen finden lassen.
Auch ist schon oben bemerkt worden, daß nach den vorliegenden Tatsachen sehr unwahrscheinlich die ultraroten Strahlen des Sonnenlichtes ganz von den Augenmedien absorbiert werden.
Hiernach scheint nur die Annahme übrig zu bleiben, daß, wenn die Farben des Spektrum nicht in denselben Verhältnissen hell im Auge erscheinen, als sie draußen warm sind, dies von einer ungleichförmigen Empfindlichkeit der Netzhaut für die Farben abhängt, der Art, daß nach den Grenzen des Spektrum zu Farbenschwingungen bei gleicher lebendiger Kraft, mit der die Netzhaut von ihnen getroffen wird, doch minder leicht und stark empfunden werden, als um die Mitte, und über gewisse Grenzen hinaus gar nicht mehr merklich empfunden werden.
Die Identitätsansicht von Licht und Wärme vorausgesetzt, kann man nämlich die objektive Intensität, d. i. lebendige Kraft, der Strahlen in den verschiedenen Teilen des Spektrum durch ihre Wärme gemessen halten, und bei der farblosen Durchsichtigkeit der Augenmedien, welche das Verhältnis der sichtbaren Farbenstrahlen nicht abändert, auch annehmen, daß die Strahlen mit derselben verhältnismäßigen Intensität, welche sie auswendig haben, zur Netzhaut gelangen; wo wir nicht mehr im Stande sind, ihre Wärme zu messen, wohl aber ihre Leuchtkraft, d. i. die Intensität weißen Lichtes, welche einen gleich starken Eindruck auf das Auge macht (s. o.). Beide müßten einander proportional bleiben, wenn nicht die ungleiche Empfindlichkeit der Netzhaut für die verschiedenen Farben dies Verhältnis änderte.
Hätten wir nun eine eben so genaue Kurve der Wärme als der Leuchtkraft des Spektrum, so würden sich aus der Abweichung beider Kurven bestimmtere Schlüsse über die Empfindlichkeitsverhältnisse der Netzhaut ziehen lassen; insofern man diese Abweichungen dann eben bloß auf Rechnung der abweichenden Empfindlichkeit der Netzhaut für die verschiedenen Farbestrahlen zu schieben hätte. Ist dies aber auch nicht der Fall, so kann doch der vergleichende Blick auf die Seebeckísche Kurve der Leuchtkraft (Pogg. LXII, Taf. III, Fig. 4) und die Müllerísche Kurve der Wärme (Pogg. CV, Taf. III, Fig. 4), wovon bereits die Rede war, einen gewissen allgemeinen Anhalt in dieser Hinsicht gewähren.
Hiernach, und wie schon oben bemerkt, fällt das Maximum der Leuchtkraft mit dem Wärmemaximum gemeinsam in das Gelb woraus man schließen muß, daß auch das Maximum der Empfindlichkeit der Netzhaut mit dem Maximum der Intensität der zu ihr gelangenden Strahlen merklich zusammenfällt, oder daß die gelben Strahlen aus dem doppelten Grunde als die leuchtendsten erscheinen, weil sie die intensivsten sind und weil sie mit der größten Empfindlichkeit perzipiert werden. Von der gemeinsamen Maximumordinate an fällt die Seebeckísche Kurve der Leuchtkraft alsbald konvex gegen die Abszissenachse der Wellenlängen nach beiden Seiten fast symmetrisch ab, die Müllerísche Kurve der Wärme konkav gegen die Abszissenachse, nach beiden Seiten ganz unsymmetrisch, langsam zum Rot und Ultrarot, viel rascher zum Violett ab, und die Wärmeordinate an der roten Grenze des sichtbaren Spektrum ist gleich einer Ordinate etwas diesseits der Linie F (also im Blau), so daß indigfarbene, violette, ultraviolette Strahlen, welche jenseits der Linie F liegen, mit ihren Ordinaten ultraroten Strahlen entsprechen, mithin jene bei einer lebendigen Kraft noch sichtbar sind, bei welcher diese unsichtbar sind; was dahin auszulegen, daß die Empfindlichkeit von ihrem Maximumwerte für das Gelb viel rascher nach Seiten des Rot als nach Seiten des Violett abnimmt.
Dies Resultat scheint mir gezogen werden zu müssen, in soweit die Zusammenstellung der bisherigen Beobachtungen als maßgebend gelten kann. Aber freilich würde es zur völligen Sicherstellung und genaueren Bestimmung dieses Resultates nötig sein, daß sich erst die Untersuchung im Zusammenhange darauf richtete und manche Punkte genauer bestimmte und erledigte, die hier nur als wahrscheinlich geltend gemacht werden konnten oder auf keinen scharfen Bestimmungen ruhen.
Insofern für die Tonhöhen eine untere Grenze und wahrscheinlich auch eine obere Grenze der Perzeptionsfähigkeit besteht, kann es jedesfalls an sich nicht unwahrscheinlich erscheinen, wenn etwas Entsprechendes im Gebiete der Farben stattfindet. Nimmt man an, daß die Gesetze der Resonanz, nach welchen sich Schwingungen außerhalb des Auges zwischen elastischen Medien mitteilen, auch auf die Mitteilung der Lichtschwingungen an die Netzhaut anwendbar sind, so kann es sogar als notwendig erscheinen, daß die Netzhaut am leichtesten von der Farbe anklingt, mit der sie am meisten konsoniert, sofern elastische Körper bei der Resonanz unter sonst gleichen Umständen den Ton am stärksten wiedergeben, in dem sie selbstständig schwingend erklingen, und aus diesem Gesichtspunkte haben J. Herschel, Melloni und A. Seebeck den Gegenstand gefaßt. Nur scheint mir hiergegen die große Schwierigkeit zu bestehen, daß die Netzhaut für sich nicht in einem gewissen farbigen Lichte, sondern in weißem Lichte erklingt, sofern das Schwarz des Sehfeldes bei geschlossenem Auge, was einen geringen Grad der Lichtempfindung repräsentiert, farblos, und das gewöhnliche Lichtflackern bei krankhafter Reizbarkeit des Auges, wie ich an mir selbst konstatieren kann, weiß oder höchstens ganz zweideutig gelblich ist, was sich an flackernden Punkten nicht recht unterscheiden läßt. Nach der Voraussetzung aber müßte die Netzhaut für sich, ohne äußere Anregung, entschieden in derjenigen Farbe schwingen, für die sie am meisten empfänglich ist.
Ungeachtet ich die Resonanztheorie des Sehens nicht für zulänglich halte, könnte sie doch vielleicht bis zu gewissen Grenzen anwendbar sein, und ich halte es nützlich, zu zeigen, wie man sie bisher zu gestalten versucht hat; daher das Wesentliche der Ansicht von Herschel, Melloni und Seebeck hier folgen mag.
W. Herschel in seinem Werke über das Licht, §. 567 äußert sich wie folgt:
"Obgleich jeder Stoß und jede nach einem Gesetze geregelte Bewegung in einem elastischen Mittel von den Teilchen desselben fortgepflanzt wird, so nimmt man doch in der Theorie des Lichtes an, daß nur solche primitive Stöße, die nach regelmäßigen periodischen Gesetzen in gleichen Zeiträumen wiederkehren, und oft hinter einander wiederholt werden, unseren Organen die Empfindung von Licht mitteilen können. Um die Teilchen der Nerven unserer Netzhaut mit gehöriger Wirksamkeit in Bewegung setzen zu können, müssen die fast unendlich kleinen Stöße der anliegenden Ätherteilchen oft und regelmäßig wiederholt werden, damit sie ihre Wirkung gleichsam vervielfältigen und konzentrieren. So wie ein großes Pendel durch eine äußerst geringe Kraft, die sehr oft in Zeiträumen an demselben angebracht wird, welche der Schwingungszeit desselben genau gleich sind, in Schwingung gesetzt werden kann, oder wie ein fester elastischer Körper durch die Vibrationen eines anderen entfernteren Körpers, vermöge der Fortpflanzung derselben durch die Luft, ebenfalls in schwingende Bewegung gerät, wenn beide im Einklange sind, so können wir auch annehmen, daß die groben Nervenfasern der Netzhaut durch die unaufhörliche Wiederholung der Ätherschläge in Bewegung gesetzt werden, und bloß diejenigen werden sich bewegen, die vermöge ihrer Größe, Gestalt oder Elastizität fähig sind, in den Zeiträumen ihre Schwingungen zu vollenden, in welchen die Stöße wiederholt werden. Auf diese Art sieht man leicht ein, wie sich ein Begrenzung der sichtbaren Farben ergeben muß; denn wenn keine Nervenfasern mit Schwingungen, die mehr oder weniger häufig als gewisse feste Grenzen sind, übereinstimmen, so werden solche Schwingungen, obgleich sie die Netzhaut erreichen, doch keinen Eindruck hervorbringen. So bringt auch ein einzelner oder ein unregelmäßig wiederholter Stoß kein Licht hervor, und auf diese Art können auch die in der Netzhaut hervorgebrachten Schwingungen noch eine merkliche Zeit fortdauern, wenn auch die wirkende Ursache aufgehört hat, wodurch die Empfindung von Licht verlängert wird."
Melloni entwickelt seine Vorstellungen in einem Schreiben an Arago in den Campt. rend, T. XIV, p. 823, woraus sich eine Übersetzung in Pogg. Ann. LVI, 574 (vgl. auch LXII, 25) unter der Überschrift: "Beobachtungen über die Färbung der Netzhaut und der Kristalllinse" findet, unter Mitbezugnahme auf eine in der Akademie der Wissenschaften in Neapel gelesene Abhandlung, wo er dieselbe Ansicht ausgesprochen hat. Er sagt:
"Nach den in ebenerwähnter Abhandlung entwickelten Grundsätzen geschähe das Sehen vermöge äußerst rascher Schwingungen, welche die Nerven-Moleküle der Netzhaut unter dem Einflusse einer gewissen Reihe von Ätherundulationen erführen. Diese Vibrationen, betrachtet in Bezug auf die verschiedenen, das Sonnenspektrum zusammensetzenden Undulationen, würden nicht von der Quantität der Bewegung abhängen, sondern herrühren von der größeren oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher die Teilchen der Netzhaut dieser oder jener Ätherschwingung folgen. Es wäre, akustisch gesprochen, eine Art Resonanz der Netzhaut, erregt durch den Akkord oder die harmonische Relation, die zwischen der Spannung oder Elastizität seiner Molekulargruppen und der Periode der einfallenden Welle vorhanden ist."
"Die außerhalb der beiden Grenzen des Spektrum liegenden Undulationen könnten auf der Netzhaut keine Vibrationsbewegung erregen, und wären sonach unsichtbar, weil ihnen jede Art von Akkord mit der Molekular-Elastizität dieser Membran des Auges abginge Die zwischen Gelb und Orange liegenden, also, nach Fraunhofer, dem Maximum der Lichtstärke entsprechenden Undulationen würden dagegen die mit erwähnter Elastizität der Netzhaut homogensten Vibrationen liefern, und den Molekülen dieser Haut die ausgeprägteste Vibrationsbewegung mitteilen."
"Es versteht sich, daß nach dieser Theorie, wie nach jeder anderen, die man zur Erklärung des Sehens und der optischen Phänomene im Allgemeinen erdacht hat, die Lichtmenge abhängt von der Intensität der Strahlung, die, für uns, aus der Weite der molekularen Vibrationen entspringt; denn unter gleichen Umständen könnte z. B. der blaue Strahl des Sonnen Spektrums wegen seines schwachen Akkordes mit der Spannung der Netzhaut-Moleküle sehr wohl eine zehn Mal geringere Lichtmenge entwickeln als der gelbe Strahl; allein die leuchtende Wirkung beider Strahlen würde offenbar gleich werden, wenn die schwingenden Atome in der blauen Undulation einen zehn Mal größeren Raum durchliefen als die in der gelben Undulation."
"Die Verhältnisse zwischen den Intensitäten dieser verschiedenen Schwingungsbewegungen des Äthers würden, nach unserer Betrachtungsweise, geliefert werden durch die verschiedenen Temperaturen, welche ein wohl mit Kienruß überzogener thermoskopischer Körper unter dem Einflusse der Strahlungen annimmt."
Melloni folgert nun aus dem Umstande, daß, während Temperatur und Leuchtkraft vom Violett bis zum Gelb mit einander steigen, die Temperatur vom Gelb zum Roth aber noch wächst, während die Leuchtkraft vom Gelb zum Rot abnimmt, die Notwendigkeit, der Netzhaut eine geringere Konsonanz mit den orangefarbenen und roten, als mit den gelben Strahlen beizulegen, welche Folgerung freilich nicht mehr bindend erscheint, wenn in dem gleicherweise reduzierten Wärme- und Lichtspektrum das Maximum sowohl für Wärme als Helligkeit im Gelb liegt (vgl. oben), aber doch in etwas anderer Form nach der ungleichen Abnahme der Wärme und Helligkeit vom Maximum an sich nur in etwas anderer Form wieder herstellen läßt.
Weiter setzt Melloni den Satz, daß die Netzhaut am besten mit dem Gelb konsoniere, in Beziehung mit einer gelben Färbung der Netzhaut, welche am sog. Sömmeringíschen gelben Flecke direkt konstatierbar ist, und nach Melloni auch der übrigen Netzhaut zukommt, wenn man sie unter gewissen Vorsichten zusammenfaltet, wonach und nach anderen Umständen er schließt, daß sie am gelben Flecke bloß wegen der größeren Dicke der Nervenschicht leichter sichtbar sei.
"Ein Körper nämlich ist ó nach Melloni ó rot, grün oder blau, je nachdem die Spannung seiner Teilchen mehr konsoniert mit der Schwingungsperiode der roten, grünen oder blauen Undulationen, und daraus folgt notwendig, daß eine Substanz, deren Teilchen unter der Einwirkung dieser oder jener Licht-Undulation besser schwingen, notwendig farbig ist."
A. Seebeck führt seine Ansicht in einer brieflichen Mitteilung an Poggendorff unter der Überschrift: "Bemerkungen über Resonanz und über die Helligkeit der Farben im Spektrum" in Pogg. Ann. LXII, 571 aus, unter Bezugnahme auf eine frühere Abhandlung (in demselben Bande S. 299), worin er untersucht hat, wie sich eine in Luft schwingende elastische Platte bei der Resonanz verhält.
"Aus jener Theorie des Mittönens, sagt er, hat sich ergeben, daß eine Platte, wie ich sie dort annahm, deren eigene Schwingungsmenge n ist, getroffen von einem Wellenzuge von der Form a cos(mt + Q ) stets nach einiger Zeit in eine Bewegung übergeht, welche durch a cos(mt + Q) vorgestellt wird, wo die Schwingungsweite a um so größer im Verhältnisse zu a ist, je weniger m von n verschieden ist."
"Sehr leicht ergibt sich aus der gefundenen Formel für a folgender Satz 53); "Lässt man auf die Platte zwei gleich starke Töne wirken, so ist das Mittönen von gleicher Intensität, im Falle der höhere Ton um das gleiche Tonintervall über dem Tone der Platte liegt, wie der tiefere unter demselben, z. B. wenn jener um eine Quarte höher, dieser um eine Quarte tiefer ist, als der eigene Ton der Platte. Zeichnet man daher eine Kurve der Resonanzstärke, indem man die Wellenlängen als Abszissen und die Intensitäten des Mittönens als Ordinaten nimmt, so wird diese Kurve nicht zu beiden Seiten ihres Maximums symmetrisch, sondern fällt auf der Seite der kürzeren schneller. (Sie würde symmetrisch werden, wenn man statt der Wellenlängen deren Logarithmen als Abszissen nähme)."
Nach Hinweis auf die im Originale (Pogg. LXII, Taf. III, Fig. 3) verzeichnete Kurve dieser Intensitäten fährt Seebeck fort:
"Ich werde jetzt versuchen, diese Betrachtungen auf die sogenannte Resonanz der Netzhaut anzuwenden, unter der allerdings nicht verbürgten Annahme, daß der vorhin ausgesprochene Lehrsatz, welcher für die longitudinalen Schwingungen der Schallwellen gefunden worden, unter gewissen Beschränkungen auf die transversalen der Lichtwellen übertragen werden darf."
"Denken wir uns, die Netzhaut bestehe aus Teilchen, welche für sich, nach bloßem Anstoßen, eigene Schwingungen machen, ganz eben so wie jene Platte. Das subjektive Licht, welches wir bei der Erregung des Auges durch Stoß oder elektrische Entladung wahrnehmen, würde dann wahrscheinlich in solchen eigenen Schwingungen der Netzhaut bestehen. Nehmen wir an, daß der Wert von n für alle Teilchen der Netzhaut gleich sei, d. h. daß jenes subjektive Licht homogen sei, oder, was auf dasselbe hinauskommt, ziehen wir nur solche Teilchen in Betracht, welche einerlei n haben, und lassen wir nun auf diese Teilchen Lichtwellen von irgend einer Länge wirken, so müssen die Schwingungen der Netzhaut nach einiger Zeit denen des erregenden Wellenzuges isochronisch werden, dabei aber um so stärker sein, je weniger die Wellenlänge des einfallenden Lichtes von der des eigenen (subjektiven) Lichtes der Netzhaut verschieden ist. Lassen wir also nach einander Wellen von verschiedener Länge, aber gleicher Stärke (gleichem Werte von am) auf die Netzhaut wirken, so muß ihre Resonanz und die dadurch bedingte Lichtempfindung von ungleicher Stärke sein, und es würden sich die Wirkungen auf unser Organ durch eine Resonanzkurve darstellen lassen, jener ähnlich, welche ich für die Platte gezeichnet habe, wobei nur der Wert von n und b aus der Erfahrung bestimmt werden müßte."
53) Die von Seebeck genannte Formel (Pogg. LXII, 299. LXVIII, 459) ist
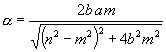
worin a die Schwingungsamplitude der resonierenden
Platte, a die Amplitude der Schwingungen, welche die Platte zur
Resonanz erregen, n die eigene Schwingungszahl der resonierenden
Platte, m die der erregenden Schwingungen, b eine von dem
Widerstande der Bewegung abhängige Konstante ist. Der obige Satz folgt
daraus, daß a denselben Wert annimmt,
wenn man für m substituiert x n und ![]() ,
welche Zahl auch x sei. Außerdem wird man leicht noch den
Satz daraus ableiten können, daß, wenn n und n'
die eigenen Schwingungszahlen zweier verschiedenen Platten sind, a
für sie gleich wird, wenn sie durch die Beziehung verknüpft sind
,
welche Zahl auch x sei. Außerdem wird man leicht noch den
Satz daraus ableiten können, daß, wenn n und n'
die eigenen Schwingungszahlen zweier verschiedenen Platten sind, a
für sie gleich wird, wenn sie durch die Beziehung verknüpft sind
n2 + n'2 = 2 m2.
"Ließe sich diese Kurve durch eine zweckmäßige Wahl von b und n identisch machen mit einer anderen, welche die beobachteten Helligkeiten des Farbenspektrum darstellt, so würde man vermuten dürfen, daß die Wellen in der ganzen Ausdehnung des Spektrum von gleicher Stärke (lebendiger Kraft) sind; auf eine ungleiche Verteilung dieser Stärke aber müßte man schließen, wenn jene beiden Kurven sich nicht in Übereinstimmung bringen lassen."
"Das Letztere ist nun in der Tat der Fall, wovon ich mich bereits vor einiger Zeit durch Vergleichung Fraunhoferíscher Messungen überzeugt habe."
Seebeck gibt nun die schon S. 281 mitgeteilte Reduktion des prismatischen Spektrum auf ein Gitterspektrum, verzeichnet hiernach ebenfalls eine Kurve (Pogg. LXII, Taf. III, Fig. 4) und fährt fort:
"Vergleicht man diese Kurve mit der vorigen (Fig. 3), so bemerkt man sogleich aus dem ganz ungleichen Gange beider, daß ó unter den im Eingange bemerkten Voraussetzungen ó die wahren Intensitäten (a2 m2) sich nicht gleichmäßig über die ganze Ausdehnung des Spektrum erstrecken können, indem das Maximum eine ganz andere Lage zwischen je zwei Stellen gleicher Helligkeit hat, als dies bei der Resonanzkurve für gleiche Wellenstärken möglich sein würde. Ist nun die Wellenstärke ungleich für verschiedene Teile des Spektrum, so muß die Helligkeitskurve eine Funktion von ihr und von der ungleichen Resonanzfähigkeit der Netzhaut werden, so daß, um über die letztere zu urteilen, man die erstere (die Wellenstärke) kennen müßte. Das Maximum der Helligkeit muß von der Natur dieser beiden Veränderlichen abhängen. Nimmt z.B. die Wellenstärke vom Rot bis zum Violett fortwährend ab ó wie das unter der Annahme des Identitätsprinzips auch dann der Fall zu sein scheint, wenn man auch hier die ungleiche Ausbreitung im prismatischen Bilde in Anschlag bringt, so müßte, bei meinen Voraussetzungen, also die eigene Schwingungsmenge n der Netzhaut schon ins Blaugrün oder Blau hineinfallen 54). Dies ist ein ganz anderes Resultat, als jenes, zu welchem Melloni, ohne Frage von ganz verschiedenen Prämissen ausgehend, gelangt ist, indem er die größte Resonanzfähigkeit dahin setzt, wo die größte Helligkeit wahrgenommen wird.
54) "Sollte vielleicht hierin der Grund liegen, warum die grüne Farbe unserem Auge so wohltätig ist? Allein dann müßte wahrscheinlich das subjektive Licht ebenfalls grün oder bläulich sein, was sich, wie ich glaube, nicht bestätigt."
"Ich habe diese Berechnung unter der einseitigen Voraussetzung ausgeführt, daß alle Teile der Netzhaut einerlei n haben, weil es mir nicht ohne Nutzen zu sein schien, die Analogie, auf welche man in diesem Gegenstande einmal gewiesen ist, an einem solchen einfachen Beispiele durchzuführen. Ich halte jedoch diese Voraussetzung selbst nicht für wahrscheinlich. Dürfen aber mehrere n beliebig angenommen werden, so wird es möglich sein, jede gegebene Helligkeitsskala mit jeder gegebenen Verteilung der Wellenstärken in Einklang zu bringen. Auf diese Weise wird es, unter der Annahme des Identitätsprinzipes, möglich sein, die Vorstellung von einer Resonanz der Netzhaut, oder vielleicht von mehreren solchen Resonanzen festzuhalten, wie man auch die Verteilung der Wärme im Spektrum oder des bis zur Netzhaut gelangenden Teiles derselben finden möge. Ob aber die Werte der n, welche angenommen werden müssen, um die Wärmeskala mit der Helligkeitsskala in Einklang zu bringen, wirklich in der Natur des Auges begründet sind, darüber dürften die subjektiven Gesichtserscheinungen einigen Aufschluß zu geben geeignet sein."
b) Punkte der Übereinstimmung und Verschiedenheit zwischen den Empfindungsgebieten von Licht und Schall.
Als Punkte der Übereinstimmung sind insbesondere folgende geltend zu machen.
1) Lichtempfindungen und Schallempfindungen sind sinnliche Empfindungen, beide, wenn auch in verschiedenem Sinne, die Hauptunterlagen unserer höheren geistigen Entwicklung, beide einer großen Mannigfaltigkeit von Modifikationen, Abwandelungen und der Zerlegung durch die Betrachtung in verschieden auffaßbare, wenn schon nicht wirklich geschiedene Seiten (Stärke und Farbe bei Licht, Stärke, Höhe und Klang bei Tönen) fähig.
2) Beide hängen von den Schwingungen eines elastischen Mediums als äußerem Reize ab, können aber auch ohne äußeren Reiz aus inneren Gründen entstehen. Wahrscheinlich liegen ihnen auch innerlich Schwingungen zu Grunde, welche durch die äußeren anregbar sind.
3) Bei beiden schiebt sich zwischen den äußeren Reiz und den Sinnesnerven ein, normalerweise doppeltseitiges, Sinnesorgan ein, wodurch die Form und Wirkungsweise des äußeren Reizes bei seiner Einwirkung auf das Nervensystem mitbestimmt wird.
4) Die Qualität der Töne wie der Farben hängt von der Schwingungsdauer oder Schwingungszahl, die Stärke derselben von der Amplitude der erregenden Schwingungen ab. Bezüglich der Amplitude und der davon abhängigen Stärke der Empfindung gilt für beide das Weberísche Gesetz.
5) Verschiedene Töne wie verschiedene Farben vermögen im Zusammentreffen einen Eindruck zu erzeugen, welcher dem eines einfachen Tones, einer einfachen Farbe entspricht. Bei Tönen beziehe ich mich hierbei auf die sog. Tartiniíschen oder Kombinationstöne.
6) Wie es Grenzen der Hörbarkeit der Töne gibt, so auch Grenzen der Sichtbarkeit der Farben, wobei es beiderseits noch der Erörterung unterliegt, in wieweit diese Grenzen auf mangelnder Perzeptionsfähigkeit der Nerven für sehr schnelle und langsame Schwingungen, oder darauf beruhen, daß nach der Einrichtung unserer äußeren Sinnesorgane Schwingungen über und unter einem gewissen Grade der Schnelligkeit gar nicht zu den Nerven zu gelangen vermögen. Von dem, was in dieser Hinsicht für Töne gilt, ist schon Th. I, S. 258 und Th. II, Kap.30, von dem, was für Farben gilt, im vorigen Abschnitte dieses Kapitels zur Genüge die Rede gewesen.
7) Die Annäherung, welche der Farbeneindruck des Violett am einen Ende des gewöhnlichen Sonnenspektrum an den des Rot am anderen zeigt, kann in gewissem (freilich eben nur in gewissem) Sinne mit der periodischen Wiederkehr eines analogen Toneindruckes nach dem Intervalle einer Oktave verglichen werden.
Zwar vermehrt sich beim Übergange von den gewöhnlich sichtbaren violetten zu den ultravioletten Strahlen keinesweges die Annäherung an den Eindruck des Rot (durch zu erwartende Purpurtinten), wie man nach der Analogie mit Tönen voraussetzen müßte, sondern das Blau kehrt zurück 55). Der ultraviolette Teil des Spektrum (jenseits Stokesí Gruppe l) erscheint bei schwacher Intensität indigblau, bei starker Intensität weißblau, doch schließt Helmholtz aus seinen Versuchen (Pogg. XCIV, 210), "daß die Umkehr in der Farbenreihe, welche beim übervioletten Lichte stattfindet, sich so erklären lasse, daß einer schwachen Empfindung violetter Farbe, welche diese Lichtstrahlen direkt erregen, sich die Wahrnehmung des in der Retina durch Fluoreszenz erzeugten grünlich weißen Lichtes (s. o.) zugeselle, und beide Farbenempfindungen vereinigt die weißlich indigblaue Färbung geben, welche die übervioletten Strahlen darbieten, wenn sie direkt gesehen werden."
55) VgL Pogg. XCIV, 14. 206. XCVIII, 514.
Helmholtz gibt (Pogg. XCIV, I3)
von dem brechbarsten Teile des Sonnenspektrum (isoliert von dem hellen
Teile des Spektrum betrachtet und von zerstreutem Lichte frei, mittelst
Glasprismas erhalten) folgende Beschreibung: "Bei geringer Lichtstärke
hat der Raum zwischen den Linien G und H eine ziemlich gleichmäßige
violette Färbung, die sich auch noch auf die Gegend von Stokesí Gruppe
l ausdehnt. Je lichtschwächer das Violett wird, desto mehr bekommt
es einen Anflug von Rosa. Steigert sich die Lichtintensität, so wird
der Farbenton dem Blau ähnlicher und entfernt sich immer mehr vom
Purpur; er geht dann in ein weißliches Graublau über. Die übervioletten
Strahlen jenseits der Gruppe l setzen die Farbenreihe keineswegs nach dem
Purpur hin fort, sondern sind wieder indigblau bei geringer Lichtstärke,
weißblau, wo es gelingt, sie in größerer Lichtstärke
zu sehen. Ich habe das überviolette Licht mehreren anderen Personen
gezeigt, um nicht durch eine Eigentümlichkeit meines Auges getäuscht
zu werden, und alle bezeichneten die Farbe in der Weise, wie ich angegeben
habe. Unter allen diesen brechbaren Farbentönen kommt also lichtschwaches
Violett, etwa aus der Gegend der Linie A56)
dem Purpur am nächsten; aber auch dieses ist durch einen weiten Zwischenraum
in der Farbenreihe von dem äußersten Rot getrennt. Man kann
in meinem Apparate durch Mischung von Violett und Rot eine sehr große
Anzahl unterscheidbarer purpurner Farbentöne bilden, welche sich alle
zwischen die Farben der beiden äußersten Enden des Spektrum
einreihen lassen."
56) Dies muß verdruckt sein (für H?), da A dem Rot angehört.
Anderorts (Pogg. XCIV, 208) sagt er (bezüglich eines, mittelst eines Bergkristallapparates erhaltenen Spektrum): "Das Auge schien für die äußersten übervioletten Strahlen des Sonnenlichtes keinen geringeren Grad von Empfindlichkeit zu haben, als für die der Gegend von m. Soweit Chininpapier das Vorhandensein von Strahlen anzeigte, konnte sie auch das Auge empfinden. Eine Änderung der Farbe konnte ich in der ganzen Ausdehnung von l an bis zum Ende nicht bemerken, außer, daß die lichtschwächeren Stellen ein dem Violett ähnlicheres Indigblau zeigten. Alle indigblauen Strahlen werden aber bei geringerer Helligkeit dem Violett ähnlicher. Bei gleicher Lichtstärke schien aber die Farbe der übervioletten Strahlen doch weißlicher zu sein, als die der gewöhnlichen indigblauen."
Esselbach (Pogg. XCVIII, 515) sagt (bezüglich eines, mit einem Bergkristallapparate entworfenen) Spektrum: "Der physiologische Eindruck ist in dem Teile des Ultraviolett von N bis R der desselben ""Lavendelgrau"", wie zwischen den Linien L und N. Meistens erscheinen die Linien sehr scharf auf mattem graublauen Grunde; bei geringerer Helligkeit erscheint der Grund glänzend indigblau und bei noch größerer Lichtschwäche bisweilen, besonders an den Grenzen des Gesichtsfeldes, in entschiedenem Violett. Dies während der Beobachtung oft gesehene Farbenspiel stimmt ganz mit Helmholtz Erklärung dieser Farbe überein, wonach ihre kurzen Wellen teils unmittelbar als wenig intensives Violett, teils durch Vermittelung einer weißen, grünlich blauen Fluoreszenz perzipiert werden."
8) Wir sehen normalerweise mit beiden Augen nur einfach und hören mit beiden Ohren nur einfach.
9) So wie es nach Kap. 30 Individuen gibt, welche für die Töne eines gewissen Teiles der normalerweise hörbaren Tonskala unempfänglich sind, so solche, welche für einen gewissen Teil der normalerweise sichtbaren Farbenskala unempfänglich sind.
Diesen Vergleich zieht schon A. Seebeck (Pogg. LXVIII, 461). Eine Zusammenstellung über die mannigfachen Formen mangelhaften Farbensinnes findet sich u. a. in Rüteís Ophthalmologie S. 179 ff.
Als Hauptpunkte der Verschiedenheit sind hingegen folgende geltend zu machen.
1) Licht- und Schallempfindungen tragen einen verschiedenen Grundcharakter.
2) Die Beschaffenheit und Verhältnisse der äußeren Schwingungen, welche als Reize zur Erweckung der Licht- und Schallempfindungen dienen, und die Sinnesorgane, durch die sie an den nervösen Apparat übertragen werden, sind bei Licht und Schall sehr verschieden, wonach auch Verschiedenheiten der dadurch erweckten inneren Vorgänge in unserem Nervensysteme, wovon die Empfindung funktionell abhängt, als wahrscheinlich gelten können.
3) Das Licht, wodurch die Lichtempfindungen in uns erweckt werden, beruht insbesondere auf sehr schnellen und schnell fortgepflanzten Schwingungen von sehr kleiner Amplitude in einem imponderabeln, sehr dünnen Medium, dem Äther; der Schall, wodurch die Schallempfindungen in uns erweckt werden, auf verhältnismäßig viel langsameren und langsamer fortgepflanzten Schwingungen von viel größerer Amplitude in einem wägbaren dichteren Medium, der Luft. Jene beruhen auf bloßer Verschiebung der Ätherteilchen gegen einander, ohne Verdichtung und Verdünnung des Äthers, diese auf Näherung und Entfernung der Teilchen mit Verdichtung und Verdünnung der Luft. Die Lichtschwingungen sind transversal, d. i. auf ihrer Fortpflanzungsrichtung, der des Lichtstrahls, senkrecht und können geradlinig, kreisförmig, elliptisch sein und die verschiedensten zusammengesetzten Formen haben; die Luftschwingungen sind longitudinal, d. h. fallen der Richtung nach mit der Fortpflanzungsrichtung des Schalles, der Richtung des Schallstrahls zusammen, und sind unstreitig in gleichförmig dichter Luft als geradlinig anzusehen.
4) Bei der Einrichtung des Auges ist Sorge getragen, daß Lichtstrahlen, die von einem Punkte ausgehen, auch wieder in einem Punkte der von den Lichtstrahlen getroffenen Nervenhaut zusammentreffen und die Lichteindrücke sich in ähnlicher Weise auf der Netzhaut juxtaponieren, als in der Außenwelt, so daß ein Bild der Außendinge auf der Netzhaut entsteht. Bei der Einrichtung des Ohres ist keine solche Einrichtung getroffen, und es kann kein Schallbild der äußeren Gegenstände im Ohre entstehen. Hingegen sind im Ohre andere eigentümliche Einrichtungen getroffen, deren Deutung bezüglich der Perzeption des Schalls zum Teil klar, zum Teil unklar ist. Besonderer Beachtung wert sind gewisse feine Tastenapparate, mit denen nach neuen anatomischen Entdeckungen die Enden der Hörnerven in Beziehung stehen, worauf unten zurückzukommen sein wird.
5) Durch die verschiedenen Gehörnervenfasern kann der Eindruck räumlicher Juxtaposition überhaupt nicht erhalten werden, wie es durch die verschiedenen Sehnervenfasern der Fall ist, indem die Gleichzeitigkeit verschiedener Töne einen anderen Eindruck macht, als den der räumlichen Koordination, ein Unterschied, der unabhängig davon besteht, daß die Schallstrahlen kein Bild der schallenden Gegenstände im Ohre erzeugen; denn wenn Lichtstrahlen, die von einem Punkte ausgegangen sind, sich über die Netzhaut zerstreuen, wie es bei mangelnder Akkommodation der Fall ist, erscheinen sie dessen ungeachtet in einer Fläche ausgebreitet, räumlich expliziert.
6) Die Lichtempfindung hat die Fähigkeit, sich räumlich gestalten zu lassen, mit der Tastempfindung gemein, indes für die Tonempfindung keine entsprechende nähere Verwandtschaft mit einer anderen Sinnesempfindung besteht.
7) Selbst ohne äußeren Lichtreiz haben wir normalerweise eine Lichtempfindung, die des schwarzen Gesichtsfeldes, als welche nach früheren Erörterungen sich in der Tat den Lichtempfindungen einreiht, wogegen wir normalerweise ohne äußeren Schallreiz keine Schallempfindung haben; wonach die psychophysische Tätigkeit des Sehens, aber nicht die des Hörens in unserem Nervenapparate ohne äußeren Reiz über der Schwelle ist.
8) Die Skala der sichtbaren Farben beträgt nach den Erörterungen des vorigen Abschnittes dieses Kapitels etwa 1 Oktave + 1 Quarte, indes die der hörbaren Töne eine ganze Anzahl Oktaven beträgt.
9) Durch den psychischen Akt der Aufmerksamkeit läßt sich unter gewissen Beschrän-kungen ein Schallgemisch in solcher Weise in seine Komponenten zerlegen, daß wir uns abwechselnd der einen vor der anderen bewußt werden können; wogegen in Bezug auf Farbengemische der Aufmerksamkeit ein solches Vermögen überhaupt nicht zusteht.
Mehrseitig hat man bezweifelt oder geleugnet, daß bei reinen Tongemischen eine wirkliche Unterscheidbarkeit der einzelnen Töne stattfinde und hierin ein wesentlicher Unterschied derselben von Farbengemischen bestehe. Wenn Musiker einen falschen Ton in einem Konzerte heraushören und selbst das Instrument bezeichnen können, was ihn gegeben, so beruhe dies nur darauf, daß sie an dem Charakter, welchen das ganze Tongemisch dadurch annehme, das Dasein des falschen Tones erkennten, ohne doch diesen besonders herauszuhören, wie man ja auch die Zumischung einer Farbennuance zum Weiß wohl erkennen und das geübte Auge des Malers sogar entscheiden kann, auf welcher Art Zumischung sie beruht, ohne doch dieselbe besonders und mit Beseitigung des Weiß ins Bewußtsein heben zu können.
Nun ist gar nicht zu leugnen, daß die Unterscheidbarkeit von Tönen in reinen Tongemischen ihre durch den Grad der Übung und Aufmerksamkeit mitbestimmte Grenze hat; wenn ich aber auch bei meinem sehr schlechten musikalischen Gehöre geneigt sein könnte, mich einer solchen Auffassung zu fügen, so widersprechen doch Musiker mit gebildetem Gehöre derselben entschieden. Der Musikdirektor Hauptmann in Leipzig hat mir auf mein Befragen in bestimmtester Weise erklärt, daß er allerdings im Stande sei, aus einem Akkorde gleichzeitig angeschlagener Töne den einen oder anderen besonders herauszuhören, und zwar nicht bloß, wenn er unrein sei, sondern auch, wenn der ganze Akkord rein sei. In demselben Sinne äußert sich Helmholtz an mehreren Orten u. a.57): "Da nun die Erfahrung lehrt, daß überall, wo die mathematisch-mechanische Untersuchung zusammengesetzte Wellenbewegungen nachweist, ein geübtes Ohr Töne unterscheiden kann, welche den darin enthaltenen einfachen Wellenbewegungen entsprechen, so u. s. w."; und anderorts 58) in Beziehung auf Klänge, in welchen ein Grundton von Obertönen begleitet ist. "In der unmittelbaren Empfindung werden allerdings die einzelnen vorhandenen einfachen Töne bei gehörig angespannter Aufmerksamkeit immer von einander getrennt, während sie in der Vorstellung zusammenfließen in den sinnlichen Eindruck, den der Ton eines bestimmten tönenden Körpers auf unser Ohr macht, und es gehört meist eine künstliche Unterstützung der Aufmerksamkeit dazu, um die einzelnen Elemente der zusammengesetzten Empfindung von einander zu scheiden, eben so wie es z. B. besondere Beobachtungsmethoden erfordert, um sich zu überzeugen, daß die Anschauung der Körperlichkeit eines betrachteten Gegenstandes auf der Verschmelzung zweier verschiedener Bilder desselben in beiden Augen beruhe." Dazu teilt Helmholtz (s. u.) die Beschreibung eines Instrumentes mit, welches auch den ganz Ungeübten in den Stand setzt, die Obertöne jedes musikalischen Tones herauszuhören, "was bisher ó sagt er ó eine Aufgabe war, die nur durch andauernde Übung und mit großer Anstrengung der Aufmerksamkeit gelöst werden konnte."
57) Pogg. XCIX, 502.
58) Pogg. CVIII, 282.
10) Indes Lichtempfindungen und Schallempfindungen in der, von gleichem physischen Umstande (der Schwingungs-Amplitude) abhängigen, Stärke eine gemeinsame psychische Seite haben, ist dagegen die, nicht minder von gleichem physischen Umstande (der Schwingungszahl) abhängige, Farbe und Tonhöhe bei beiden psychisch unvergleichbar und erteilt eben hierdurch beiden Empfindungen den qualitativ verschiedenen Grundcharakter, den wir bei denselben anzuerkennen haben. Abgesehen von dem unmittelbaren Gefühle der Verschiedenheit sind folgende Verhältnisse in dieser Hinsicht bei beiden verschieden.
11) Bei Tönen steigt mit der Schwingungszahl die Höhe kontinuierlich und nur in Beziehung zu einander zeigen sie den eigentümlichen Eindruck der Terz, Quarte, Quinte, Oktave u. s. f. Bei Farben zeigt sich mit steigender Schwingungszahl nichts der kontinuierlich wachsenden Höhenempfindung Entsprechendes, sondern ein Wechsel charakteristischer Eindrücke, Rot, Gelb, Blau, die an die Schwingungszahl selbst, nicht erst an Verhältnisse derselben geknüpft sind und wovon sich kein Analogon im Tonreiche findet, als etwa im Klange, der aber hier nur an Mitschwingungen höherer Ordnung hängt 59). Umgekehrt zeigt der Eindruck, welchen das Kontrastverhältnis der Farben zu einander macht, keine Analogie zu dem Verhältnisse der Terz, Quarte, Quinte, Oktave u. s. w. im Reiche der Töne.
59) "Die musikalische
Klangfarbe hängt nur ab von der Anwesenheit und Stärke der Nebentöne,
die in dem Klange enthalten sind, nicht von ihren Phasenunterschieden"
(Helmholtz in Pogg. CVIII, S. 289). Doch werden einige Beschränkungen
hierzu angeführt.
Moser, in einer Abhandlung "Über den Prozeß des Sehens und die Wirkung des Lichtes auf alle Körper" in Pogg. Ann. LVI, 177, worin die Wirkungen des Lichtes auf die Netzhaut mit den daguerreotypischen Lichtwirkungen, nicht sowohl identiflziert, als verglichen werden, äußert sich (p. 192) wie folgt: "die Farben machen, so zu sagen, einen vollständigen, nicht mit einander zu verwechselnden, Eindruck, die verschiedenen Töne bewirken einen solchen nicht. Allerdings verwechselt man nicht gerade sehr hohe und sehr tiefe Töne, aber desto leichter geschieht das von einem gewöhnlichen Ohre bei etwas näher liegenden Tönen, und jedesfalls gehört ein besonders feines und musikalisch gebildetes Ohr dazu, einen Ton der üblichen Bezeichnung nach angeben zu können, während das Auge bei der Bestimmung der Farben eine Schwierigkeit solcher Art gar nicht kennt. Viel eher könnte man geneigt sein, die Höhe oder Tiefe eines Tones mit der Intensität einer bestimmten Farbe, und dagegen die verschiedenen Farben mit dem Klange des Tones zusammenzustellen. Mir sind wenig Menschen vorgekommen, die auf Befragen das Letztere nicht bestätigt hätten."
12) Die periodische Wiederkehr desselben Farbeneindruckes bei steigender Schwin-gungszahl, welche durch das Violett und Rot an beiden Enden des Spektrum angedeutet wird, kann abgesehen davon, daß die Annäherung zum ersten Eindrucke schon nach dem Intervalle einer Quinte eintritt, und daß diese Annäherung sich bei dem Fortschritte zum Oktaven-intervalle vielmehr wieder vermindert als vermehrt (was den bereits angegebenen Grund haben kann), nur uneigentlich mit der periodischen Wiederkehr verglichen werden, welche das Oktavenintervall bei Tönen darbietet. Denn bei diesem liegen alle Töne mit Zwischen-zahlen der Schwingung auch für das Gefühl zwischen Grundton und Oktave; es wird also ein wirklicher Abstand zwischen Grundton und Oktave für das Gefühl dadurch begründet, wogegen die Farben zwischen den beiden Grenzen des Spektrum für das Gefühl nicht zwischen Rot und Violett zu liegen scheinen und noch weniger zwischen Rot und Rot liegen würden, falls dies die dem Intervalle der Oktave entsprechenden Farben wären. Es fehlt also bei Farben für das Intervall der Oktave das progressive Element, was bei Tönen stattfindet.
13) Für den Vergleich aller Farben liegt der Empfindung als gemeinsamer Ausgangspunkt das Weiß, die zusammengesetzteste Farbe, unter, sofern alle Farben als Abweichungen davon in verschiedener Richtung betrachtet werden können, wogegen die Empfindung als Ausgangs-punkt für den Vergleich aller Töne nur einen einfachen Ton als Grundton brauchbar findet.
14) Die Differenzen der Tonhöhen sind schon ohne Rücksicht auf ein physisches Maß auf rein psychischem Wege durch Beziehung auf eine gemeinsame Maßeinheit, das Oktaveninter-vall, unter einander vergleichbar; die Farbendifferenzen tragen keine Beziehung auf einen solchen Maßstab für die Empfindung in sich.
15) Der Unterschied von Tonhöhen erscheint bei gleichem Verhältnisse der zugehörigen Schwingungszahlen gleich groß in den höheren und niederen Teilen der Tonskala, nicht so der Unterschied der Farben in den verschiedenen Teilen der Farbenskala, wie der von Helm-holtz60) auf Esselbachís Messungen gestützte Vergleich lehrt, wovon Th. I, S. 175 die Rede war, und welchen man auch nach der Tabelle im Abschn. a) des Kapitels selbst anstellen kann. Mit anderen Worten, das Weberísche Gesetz gilt für Tonhöhen, aber nicht für Farben nach ihrer Abhängigkeit von der Schwingungszahl.
60) Berichte der Berl. Akad. 1855. S. 760.
Hierzu noch folgende Erläuterungen von Helmholtz in Pogg. XCIV, 17. "In dem breiten Raume vom Ende des Rot bis zur Linie C ändert sich der Ton des Roten kaum merklich, eben so wenig der Ton des Violetten von der Linie G bis nach l hin. Auch in Orange und Blau ändert sich der Ton langsam, aber doch schon viel merkbarer. An der Grenze von Gelb und Grün einerseits und Blau und Grün andererseits sind dagegen die Übergänge so schnell, daß sie ganz zu fehlen scheinen, wenn man ein reines Spektrum ohne starke Vergrößerung betrachtet, und hier vielmehr Grün unmittelbar an rötliches Orange und Himmelblau anzustoßen scheint. Man erstaunt über den außerordentlichen Reichtum prachtvoller Farbentöne, welchen diese Gegenden des Spektrum entfalten, wenn man durch eine der beiden Spalten des von mir konstruierten Schirmes einfaches Licht dieser Teile gehen läßt und den Spalt dann langsam verschiebt."
16) Ohne Rücksicht auf die entsprechende physische Abhängigkeit würden wir keines-wegs geneigt sein, das Rot des Spektrum den tieferen, das Blau und Violett den höheren Tönen zu vergleichen, sondern eher umgekehrt, ungeachtet das Rot wie die tiefen Töne langsameren, das Violett und Blau wie die hohen Töne schnelleren Schwingungen entspricht.
Grailich 61) glaubt den lebhaften Eindruck des Rot daher ableiten zu können, daß wegen der langsameren Schwingungen die Teilchen länger aus der Ruhelage verrückt bleiben, was eine stärkere Reizung bewirke, wogegen sich meines Erachtens doch sehr viel einwenden läßt.
61) Sitzungsber. der Wien. Akad. 1854. XIII, S. 258.
17) Der ästhetische Eindruck der Farbenzusammenstellungen richtet sich nach ganz ande-ren Verhältnissen als der der Töne. Wenn man alle Töne einer Oktave in zwei Teile teilt und jede beider Hälften zusammen anschlägt, so hat man physisch, aber keineswegs psychisch das Analogon zweier Komplementärfarben, die sich zu Weiß ergänzen. Indes die Farben jede für sich wohlgefällig sind und eine wohlgefällige Zusammensetzung geben, findet bei den Tönen Mißklang statt.
Der mehrfach gemachte Versuch, eine Farbenharmonie auf Grund einer Analogie mit der Tonhar-monie zu begründen, die nicht besteht, scheint mir daher von vorn herein vergeblich.
18) Durch Zusammensetzung einfacher Farben läßt sich eine Farbe herstellen, welche wiederum einen untrennbar einfachen Eindruck macht, in welchem die komponierenden Eindrücke aufgehoben sind. Wenn wir hingegen einfache Töne zusammensetzen, so entsteht zwar im Tartinischen Tone auch ein resultierender einfacher Eindruck, welcher dem eines einfachen Tones gleicht; aber die komponierenden Eindrücke bestehen dabei zugleich mit fort.
19) Bei Farben läßt sich ein, der Mischung aller Farben, dem Weiß, entsprechender Eindruck schon durch zwei einfache Komplementärfarben erzeugen; nicht so ein Geräusch durch Verbindung zweier einfacher Töne.
Nach Helmholtz Versuchen 62) und Grassmannís theoretischen Erörterungen 63) gibt es zu jedem einfachen homogenen Farbenstrahle einen anderen homogenen komplementären Strahl, der mit ihm gemischt reines Weiß liefert. Folgendes die von Helmholtz gegebene Tabelle über die Wellenlängen der zu einander gehörigen Komplementärfarben, in Millionteln eines Pariser Zolles.
62) Pogg.XCIV,1.
63) Pogg. 1853.Nr. 5
|
|
|
|
|
|
| Farben. | Wellenlänge. | Komplemen-tärfarben. | Wellenlänge. | Verhältnis der W. |
| Rot | 2425 | Grünblau | 1818 | 1, 334 |
| Orange | 2244 | Blau | 1809 | 1, 240 |
| Goldgelb | 2162 | Blau | 1793 | 1, 206 |
| Goldgelb | 2120 | Blau | 1781 | 1, 190 |
| Gelb | 2095 | Indigblau | 1716 | 1, 221 |
| Gelb | 2085 | Indigblau | 1706 | 1, 222 |
| Grüngelb | 2082 | Violett | von 1600 ab. | 1, 301 |
Im Violett mußten, seiner
Lichtschwäche wegen, die äußersten Strahlen von der Wellenlänge
1600 ab alle zusammengefaßt werden. Für Grün, welches in
der Tabelle nicht vorkommt, ist die Komplemen-tärfarben in den ultravioletten
Strahlen zu suchen.
Das Verhältnis der Wellenlängen komplementärer Komponenten schwankt zwischen dem der Quarte und der kleinen Terz; am kleinsten ist es für Goldgelb und Blau. ó Merkwürdig ist die Verteilung der komplementären Farben im Spektrum. Während das Goldgelb ziemlich weit vom äußersten Rot absteht, liegen ihre komplementären Farben Grünlichblau und Cyanblau dicht neben einander; während das äußerste Violett und das Indigo einen breiten Raum im Spektrum einnehmen, finden sich ihre Komplemente grünliches Gelb und reines Gelb nur in ganz schmalen Streifen; dies hängt mit den unter 15) bemerkten Verhältnissen zusammen.
Zwei komplementäre Farben geben im Allgemeinen nicht in gleicher Lichtstärke in Weiß ein. Um das Verhältnis auszumitteln, maß Helmholtz, nachdem das Weiß in möglichster Vollkommenheit hergestellt war, die Breite des Spaltes, durch welchen die hellere Farbe drang, verringerte diese Breite dann so weit, bis ein vor das Feld gehaltenes Stäbchen zwei gleich dunkle farbige Schatten entwarf und maß die Breite dann aufs Neue. Die beiden Breiten gaben annähernd das Verhältnis der Helligkeit beider Komponenten im Weiß. Die Resultate fielen übrigens, wie dies nach den (Kap.30) angeführten Tatsachen über das abgeänderte Helligkeitsverhältnis von Pigmenten bei verschieden starker Beleuchtung zu erwarten war, bei ungleicher absoluter Lichtstärke verschieden aus. Bei geringerer Lichtstärke treten die brechbareren Farben relativ ins Übergewicht. Die folgenden Zahlen haben daher nur die Bedeutung approximativer Mittelwerte.
Bei starkem Bei schwachem
Lichte.
Lichte.
Violett : Grüngelb
1 : 10
1 : 5
Indigo : Gelb
1 : 4
1 : 3
Cyanblau : Orange
1 : 1
1 : 1
Grünblau : Rot
1 : 0,44
1 : 0,44.
Bezüglich des aus den einfachen Komplementärfarben Rot und Grünblau zusammengesetzten Weiß bemerkt Helmholtz, das Auge sei sehr empfindlich für Beimischungen von sehr kleinen Mengen der einfachen Farbe zu dem Weiß. Wenn man das aus beiden gemischte Weiß nicht ziemlich lichtschwach macht, behält es immer ein fleckiges und veränderliches Ansehen. "Dann veränderte sich auch die Mischfarbe etwas mit dem Orte der Netzhaut, der ihr Bild empfing. Schon Purkinje hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Seitenteile der Netzhaut eine andere Empfindlichkeit für Farben haben, als die Stelle des direkten Sehens der gelbe Fleck. Hatte ich Ė sagt Helmholtz Ė Rot und Grünblau so verbunden, daß das von ihnen gemeinschaftlich beleuchtete Feld so gut als möglich weiß erschien, und eher das Rot überwog, so wurde es sogleich entschieden grün, wenn ich einen neben dem hellen Felde liegenden Punkt des Papiers fixierte. Dasselbe war der Fall, wenn ich das Auge so nahe heranbrachte, daß das Feld der Mischfarbe einen sehr großen Teil des Gesichtsfeldes bedeckte, also außer dem gelben Flecke auch viele andere Teile der Netzhaut das Bild aufnahmen. Bei diesem Versuche kann die Farbenzerstreuung bei der Brechung im Auge in der Mitte eines so großen Feldes keinen Einfluß haben."
20) Der charakteristische Eindruck der Farben verschwindet immer mehr und nähert sich dem Weiß, wenn man die von der Amplitude der Schwingungen abhängige Stärke derselben vermehrt, oder sie einer anhaltenden Betrachtung unterwirft, umgekehrt kann Weiß durch anhaltende Betrachtung farbig werden, wogegen der Eindruck der Tonhöhen nichts Entspre-chendes zeigt.
Auf den Einfluß der Stärke bezügliche Erfahrungen an Farben machte ich bei meinen Versuchen über die Nachbilder 64):
"Läßt man das (in ein finsteres Zimmer durch ein Loch im Laden eingelassene) Sonnenlicht durch ein farbiges Glas auf die gegenüberstehende Wand eines finsteren Zimmers fallen, so zeigt es sich bekanntlich deutlich von der Farbe des Glases. Nicht so, wenn man direkt durch ein farbiges Glas in die Sonne blickt. Welches Glas man auch anwenden mag, so erscheint doch das Sonnenbild nur wenig gefärbt, fast weiß oder gelb und höchstens in schwachem Grade nuanciert es sich durch die Farbe des Glases. Mit solchem, zwar intensiven, aber nur schwach farbigen Lichte erscheint dann auch in der Regel die erste Phase des Nachbildes, obschon sie andere Male auch gleich anfangs deutlicher die Farbe des Glases an sich trägt."
64) Pogg, L, 465.
Entsprechende Erfahrungen an Spektrumfarben, die durch ein Prisma erzeugt sind, hat Helmholtz in seiner Abhandlung gegen Brewster 65) bekannt gemacht und dabei manche nähere Bestimmungen gegeben. Er erklärt es für Tatsache, daß bei blendender Helligkeit alle Farben weiß zu werden oder sich dem zu nähern scheinen, was am leichtesten mit Violett, am schwersten mit Rot gelingt. Violett geht schon bei einem sehr erträglichen Grade von Helligkeit durch ein bläuliches Grauweiß in Weiß, Blau bei einem etwas höheren durch Blauweiß in Weiß über. Ebenso nähert sich Grau bei wachsender Helligkeit durch Grüngelb, und Gelb durch Gelbweiß einem blendenden Weiß. Rot wird bei seinem höchsten Glanze nur hellgelb. Man sieht diese Änderungen eben so an reinen, isolierten Farben des Sonnenspektrum, wie an den zusammengesetzteren der farbigen Gläser. Vergleiche auch hierzu die S. 269 mitgeteilten Angaben desselben in Pogg. XCIV, 13.
65) Pogg. Ann. LXXXVI, 501 ff.
Daß Farben durch anhaltende Betrachtung unscheinbarer werden, mithin der Farbeneindruck derselben mehr und mehr erlischt, ist bekannt. Besonders interessant und instruktiv in dieser Hinsicht ist folgende Versuchsform , welche Moser (Pogg. LVI, 194) nach Brewster 66) dafür anführt.
66) Die Originalangaben von Brewster sind mir nicht bekannt.
"Am entschiedensten dafür spricht
ein interessantes Experiment, welches man Brewster verdankt, und welches
sich leicht genug bestätigen läßt. Man betrachte das Spektrum
einer Lichtflamme durch das Prisma anhaltend, so verschwindet zuerst das
Rot und Grün und etwas vom Blau, sieht man immer weiter, ohne das
Auge zu verrücken, dann verschwindet sogar das Gelb, geht in Weiß
über, so daß man statt der prismatischen Farben nur ein gleichmäßig
weißes, längliches Bild der Flamme erblickt. Wie gesagt, dieser
merkwürdige Versuch gelingt ohne alle Schwierigkeit, und, wie ich
beobachtet habe, am schnellsten, wenn man das obere Augenlid mit der Hand
fixiert und am Herunterschlagen hindert. Hat man das weiße Bild nach
etwa 1/2 Minute erreicht und
läßt man das Augenlid fallen, indem man das Auge sogleich wieder
öffnet, so erscheint für einen Moment das Spektrum mit seinen
Farben, um dann rasch wieder dem weißen Lichte Platz zu machen."
Moser stellt diesen Versuch damit zusammen, daß auch bei den sonst von einander abweichenden daguerreotypischen Wirkungen der verschiedenen Farbenstrahlen "eine gleichmäßige Wirkung aller Farben, das Gelb und Grün mit eingeschlossen, auf das Silberjodid sicher in einem Falle stattfindet, wenn sie nämlich anhaltend wirken, indem sie dann das Jodid dahin bringen, die Quecksilberdämpfe zu kondensieren und es bei weiter fortgesetzter Einwirkung schwärzen."
Das allmälige Verblassen der Farben bei anhaltender Betrachtung ist um so merkwürdiger, als umgekehrt Weiß durch anhaltende Betrachtung farbig wird.
In dieser Beziehung erinnere ich hier an folgende, von mir selbst gemachte Beobachtungen 67):
"Der dunkle Schleier, mit dem sich ein auf schwarzem Grunde angeschautes weißes Papier allmälig überzieht, ist nicht rein grau, sondern klingt durch verschiedene Farben ab. Besonders deutlich stellt sich das Phänomen dar, wenn man den Versuch in direktem Sonnenlichte vornimmt. Richte ich, nachdem ich die Augen eine Zeit lang geschlossen gehalten, um die Nachwirkung früherer Eindrücke zu beseitigen, dieselben auf das weiße, im Sonnenscheine auf schwarzem Papiere liegende Feld, so kann ich in den ersten Momenten, vermöge einer Art Blendung, überhaupt kein sicheres Urteil über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Färbung fällen; doch scheint sich mir in der Tat eine solche erst nach einiger Zeit zu entwickeln. Bald nämlich färbt sich das Papier entschieden gelb, dann blaugrau oder blau, ohne daß ich, bei oftmaligen Versuchen, eine Übergangsstufe durch Grün hätte wahrnehmen können, endlich rotviolett oder rot. Die gelbe Phase ist die kürzeste; die blaue dauert oft ziemlich lange, ehe sie in die folgende übergeht. Nach der roten oder rotvioletten habe ich keine weitere wahrnehmen können; obschon ich den Versuch bis zu großer Anstrengung des Auges fortgesetzt habe. Auch im verbreiteten Tageslichte habe ich die angegebene Sukzession der Färbungen oft wahrgenommen, obschon einmal mit größerer Entschiedenheit, als das andere Mal; die beiden letzten Färbungen erkannte ich hier in der Regel leichter, als die erste gelbe. Die rotviolette oder rote Tinte der letzten Phase sieht man häufig, besonders im verbreiteten Tageslichte, mit Grün meliert, und bei näherer Betrachtung findet sich, daß dies die schattigen Stellen des Papiers sind, welche von den kleinen Unebenheiten desselben abhängen."
67) Pogg. L, 306.
Szokalski 68) hat eine entsprechende Beobachtung gemacht, indem er sagt: "Wir legen ein viereckiges Stück weißes Papier auf einen schwarzen Grund, erleuchten das Ganze durch ein weißes Licht und richten unsere Blicke aufmerksam auf das Viereck, indem wir eine solche Stellung einnehmen, daß das Licht nicht direkt unsere Augen trifft. Wenn wir auf diese Weise das Papier einige Sekunden unverwandten Blickes betrachtet haben, wird es eine gelbe Farbe, und wenn wir den Versuch weiter fortsetzen, nach und nach eine grünliche, hierauf eine blaue Farbe annehmen und zuletzt ganz aufhören, sichtbar zu sein."
68) Über die Empfindungen der Farben. S. 11.
Diese unabhängig von der meinigen gewonnene Erfahrung scheint mir in Betreff ihrer wesentlichen Übereinstimmung im Farbenwandel mit der meinigen um so beachtenswerter, als sich dieselbe Übereinstimmung zwischen Szokalski und mir nicht in der Weise, wie das Nachbild von Weiß abklingt, findet, worüber ich hier in kein weiteres Detail eingehe. Doch führt er eine Zwischenstufe von Grün auf, die ich nicht bemerken konnte, und die Erscheinung ist bei ihm nicht bis zur letzten, der roten, Phase gediehen.
21) Der Eindruck der Farben läßt im Auge den Eindruck der Komplementärfarben nach und führt solchen in der Nachbarschaft mit; wovon sich nichts Entsprechendes im Gebiete der Töne findet.
22) Farben, die auf korrespondierende Stellen beider Netzhäute treffen, vermögen unter geeigneten Maßnahmen den Eindruck derselben Mischfarbe zu geben (Komplementärfarben z. B. sich zu Weiß zusammenzusetzen), als wenn sie auf einer identischen Stelle zusammen-treffen, wogegen Töne, die gesondert in beide Ohren eintreten (nach Doveís Erfahrungen 69) nicht vermögen denselben Kombinationston zu geben, welcher entsteht, wenn sie vor demselben Ohre erzeugt werden.
69) Pogg. CVII, 653.
"Von zwei, eine reine Quinte gebenden, Stimmgabeln wurde die eine vor das rechte Ohr gehalten, die andere vor das linke. Der als tiefere Oktave ans der Kombination beider Schwingungssysteme entstehende Tartiniísche Ton wurde nicht gehört, aber sehr deutlich, wenn beide Gabeln vor demselben Ohre standen."
Man hat bestritten, daß sich Komplementärfarben auf korrespondierenden Netzhautstellen zum Eindrucke von Weiß kombinieren können, und in der Tat überwiegt leicht abwechselnd bald der Eindruck der einen, bald der anderen der komponierenden Farben, was die Erscheinungen des sog. Wettstreites gibt. Inzwischen ist die Kombinierbarkeit zu Weiß namentlich durch die Erfahrungen von Dove 70), Foucauld und Regnault 71) und meine eigenen unter geeigneten Maßnahmen außer Zweifel gesetzt, und eben so vermögen sich andere als Komplementärfarben auf korrespondierenden Stellen zur reinen Mischfarbe zu verbinden, wenn man den Wettstreit auszuschließen vermag oder sich derselbe beruhigt hat. 72)
70) Berl. Monatsber. 1841. S. 251 oder Pogg. LXXI, 111.
71) LíInstit. XVII, 1849. p. 4.
72) VgL Völckers in Müllerís Arch. 1838. S. 64; Prevost in Pogg. LXII, 1844. S. 566; A. Seebeck in Pogg. LXVIII, 1846. S. 455; Brücke in Pogg. XC, 1853. S. 606 ; Dove in Pogg. CI, S. 147.
23) Wir sind nicht eben so im Stande, willkürlich ein Doppelthören als ein Doppeltsehen zu erzeugen.
24) Wenn der Schall in ein Ohr allein oder stärker als in das andere dringt, so vermögen wir sehr wohl zu unterscheiden, welches beider Ohren das allein oder vorzugsweise affizierte ist; hingegen vermögen wir nicht zu unterscheiden, von welchem beider Augen ein Objekt gesehen wird.
Eine Zusammenstellung der hierher gehörigen Tatsachen und Verhältnisse habe ich in meiner Abhandlung "Über einige Verhältnisse des binokularen Sehens" in der Abhandl. der sächs. Soc. math.-phys. Cl. Bd. V, S. 548 ff. gegeben.
c) Annahmen, welche nötig scheinen, die vorigen Punkte der Übereinstimmung und Verschiedenheit zu erklären.
Es ist die Aufgabe gestellt worden, das psychisch Übereinstimmende und Verschiedene der Licht- und Schallempfindung mit dem physisch Übereinstimmenden und Verschiedenen in Beziehung zu setzen, und die Psychophysik kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen. Aber nur die äußeren physischen Verhältnisse sind unserer Beobachtung unmittelbar zugänglich und konnten demnach auch nur im Vorigen berücksichtigt werden; eine genügende psycho-physische Theorie aber wird schließlich auf die inneren Verhältnisse zurückzugehen haben, und das Prinzip dieses Rückganges wird nur das sein können, daß wir von einer Seite her nach den äußeren physischen Verhältnissen, von denen die inneren abhängen, von anderer Seite her nach den Empfindungsverhältnissen, die von den inneren physischen Verhältnissen abhängen, auf diese selbst schließen; und was von einer Seite her unbekannt und unsicher bleibt, von der anderen Seite her zu ergänzen suchen.
So lange diese Ergänzung noch Lücken oder Zweifel läßt, bleibt das, was wir so erschließen, nur Hypothese, und wir stehen in dieser Hinsicht hier überall noch mehr oder weniger auf dem Standpunkt der Hypothese; es kann aber doch nützlich sein, vor Erlangung der Gewißheit das Wahrscheinlichste aufzusuchen, indem der Weg zur Gewißheit in diesem Gebiete überall nur durch die Prüfung des Wahrscheinlichsten gehen kann, und eine scharfe Grenze zwischen wahrscheinlichster Hypothese und Gewißheit hier überall nicht zu ziehen sein wird. Diesen Weg, das Wahre zu finden, verwerfen, heißt darauf verzichten, es hier zu finden,
Auch ist es nicht das psychophysische Interesse allein, was zu gewissen Voraussetzungen über die Natur der psychophysischen Tätigkeiten hindrängt, welche unseren Empfindungen unterliegen, sondern hiermit zugleich ein physikalisches und physiologisches; und selbst die exaktesten Forscher haben sich, wie man aus unten folgenden Anführungen ersehen kann, veranlaßt gefunden, die Beobachtung in diesem Gebiete durch notwendig erscheinende Hypothesen zu ergänzen.
Aus diesem Gesichtspunkte stelle ich nun auch im Folgenden einige, teils schon früher von Anderen als notwendig erachtete, teils durch die eigene Untersuchung der Sachverhältnisse mir notwendig erscheinende Hypothesen zum Zwecke der weiteren Prüfung auf. Die Zahl derselben, es sind deren fünf, darf nicht erschrecken, denn die vier letzten sind bloß nähere Bestimmungen der ersten, der Grundhypothese, welche durch einen Nexus von Tatsachen zusammengehalten werden, so daß sie sich nicht sowohl aufeinander, als gemeinsam auf diesen Nexus stützen. Keine ist noch so sicher, daß sie Anerkennung erzwingen könnte; doch ist auch keine leichthin nach einer einzelnen Betrachtung aufgestellt.
Die erste, die fundamentale, Hypothese ist die, daß die Tätigkeiten in unserem Nervensysteme, welche durch den Licht- und Schallreiz ausgelöst werden, und von welchen die Licht- und Schallempfindung funktionell abhängt, nicht minder als der Reiz selbst auch unter der Form von Schwingungsbewegungen zu denken sind.
Zur Rechtfertigung dieser Hypothese ist zuvörderst darauf hinzuweisen, daß eine Vorstellung über die Natur der Bewegungen, an welche sich unsere Empfindungen knüpfen, als Unterlage aller weiteren Untersuchung nötig ist, so daß es sich nur darum handeln kann, die aufzustellen, welche den Tatsachen und dem Bedürfnis der Erklärung am besten entspricht. Nun sind der Licht- und Schallreiz oszillierend, und da weder ein theoretischer noch Erfahrungsgrund vorliegt, Zwischenmittel der Übertragung anzunehmen, wodurch auch wohl eine schwingende Bewegung in eine progressive umgesetzt werden kann, so wird schon von dieser Seite die oszillierende Natur der, unserer Licht- und Schallempfindung unterliegenden, Bewegungen wahrscheinlich. Selbst wenn man die durch Licht- und Schallreiz erweckten Veränderungen als chemische fassen will, was sie wohl sein könnten, oder womit sie wenigstens verbunden sein könnten, werden diese in letzter Instanz auf Veränderungen in den Molekularverhältnissen zu reduzieren sein, welche, sofern sie durch Schwingungen angeregt und unterhalten werden, kaum anders als selbst unter Form von Schwingungsbewegungen gedacht werden können; wobei es für die meisten Fragen vorerst dahin gestellt bleiben kann, in wiefern diese vielmehr auf die wägbaren oder unwägbaren Teile des Nerven zu beziehen sind. Unstreitig können nach den Kraftbeziehungen zwischen den wägbaren und unwägbaren Teilchen beider Bewegungen überhaupt nur in einem gewissen Zusammenhange erfolgen, wobei sich doch unter Umständen die wägbären Teilchen als relativ feste Zentra gegen die unwägbaren verhalten könnten.
Was von einer Seite her als wahrscheinlich erscheint, erscheint von der anderen Seite her als notwendig, sofern es überhaupt nicht möglich sein würde, mit Verhältnissen einer progressiven Bewegung die Verhältnisse der Empfindungen in funktionelle Beziehung zu setzen, wohl aber mit Verhältnissen einer oszillierenden Bewegung, wie das 32. Kapitel gezeigt hat. Übrigens ist die Hypothese mit Fleiß von vorn herein so allgemein gehalten, um nach den Bedürfnissen dessen, was es im Besonderen zu repräsentieren gilt und die Tatsachen im Besonderen fordern, noch die verschiedensten näheren Bestimmungen zuzulassen,
Auch haben die gründlichsten Forscher, soweit sie überhaupt auf die Natur der, durch den Licht- und Schallreiz in unseren Nerven auszulösenden Bewegungen Bezug genommen, was bei physikalischen und physiologischen Fragen mitunter nicht umgangen werden kann, sich stets zu derselben Hypothese bekannt, und sind zum Teil schon auf nähere Bestimmungen derselben eingegangen.
Besonders bemerkenswert ist, daß selbst Newton, ungeachtet er die ganze objektive Lichtlehre nach dem Emissionssysteme darstellte, sich veranlaßt fand, an Schwingungen in den Nerven als Unterlage der Lichtempfindung zu denken, wobei er nur den Ausdruck Frage (Quaestio) für unseren Ausdruck Hypothese braucht; indem er (Optica, lib. III) sagt:
"Quaestio 12. Annon radii luminis, incidendo in fundum oculi, excitant vibrationes quasdam in tunica retina, quae quidem vibrationes, propagatae inde per solidas nervorum opticorum fibras in cerebrum usque, sensam ibi videndi excitent? Nam, quandoquidem corpora densa conservant calorem suum diutius, et ut qaodque corpus densissimum est, ita calorem suum diutissime conservat; utique vibrationes partium suarum natura sunt durabili, adeoque propagari possunt in longinqua usque spatia per solidas materiae uniformis ac densae fibras, ad transmittendos in cerebrum videlicet motus sensuum omnium organis impressos .....
Quaestio 13. Annon radii diversorum generum vibrationes excitant diversa magnitudine; quae scilicet vibrationes, pro sua cujusque magnitudine, sensus diversorum excitent colorum; simili fere ratione, ac vibrationes aëris, pro sua itidem ipsarum diversa magnitudine, sensus sonorum excitant diversorum? Et nominatim, annon radii maxime refrangibiles, vibrationes excitant brevissimas, ad sensum movendum coloris violacei saturi; radii minime refrangibiles, vibrationes longissimas, ad sensum coloris rabri saturi; et radii generum omnium intermediorum, vibrationes comparate intermedias, ad sensum colorum diversomm intermediorum eicitandum?
Quaestio 14. Annon fleri potest, ut harmonia et discordia colorum oriatur e proportionibus vibrationum propagatarum per nervorum opticorum fibras in cerebrum; similiter ac harmonia et discordia sonorum oritur e proportionibus vibrationum aëris? Sunt enim alii colores, si juxta se invicem positi simul inspiciuntur, oculis grati, ut auri et indici, alii autem minus grati."
Grailich, in s. Abhandl. über d. Theorie der gemischten Farben XIII. sagt:
p. 247. "Jede der einzelnen Bewegungen (des Äthers) trifft endlich ein Nervenelement, dem wir mit demselben Rechte transversale Schwingungen zuschreiben dürfen, wie dem Ätherpunkte selbst; es wäre in der Tat schwer einzusehen, warum in dem Seh-Apparate die übertragenen Bewegungen anderer Art sein sollten, als in dem die Bewegung bis dahin vermittelnden Medium etc." Und p. 259: "Die Entscheidung konnte aus dem Calcul nicht gezogen werden, und ich mußte auf den Akt des Sehens zurückgehen. Es scheint aber, daß, sobald man annimmt, die Bewegung des Äthers teile sich den Nervenelementen mit und versetze diese in eine ähnliche schwingende Bewegung, es auch mit Notwendigkeit folge u. s. w."
Die Aufstellung und Gestaltung der Hypothese durch W. Herschel, Melloni und A. Seebeck ist schon voranstehend mitgeteilt worden.
Von vorn herein könnte man freilich bezweifeln, daß sich mit dieser Hypothese der Bedingung, die Verhältnisse der Empfindung physisch zu repräsentieren, überhaupt genügen lassen wird, falls man die Aufgabe in der Allgemeinheit faßt, die ihr der Natur der Sache nach zukommt. Denn man scheint von vornherein verzweifeln zu müssen, mit den Verhältnissen der Übereinstimmung zwischen den Empfindungsgebieten von Licht und Schall auch die der Verschiedenheit repräsentieren zu können, welche wir besprochen haben. Was steht uns bei Schwingungen überhaupt zu Gebote, wovon sich Verschiedenheiten der Empfindung funktionell abhängig machen ließen, als Verschiedenheiten in der Natur des schwingenden Mediums, Verschiedenheiten in der Schwingungsamplitude, Schwingungsdauer und Schwingungsform; aber können auch hiervon so fundamentale Unterschiede abhängig gemacht werden, als zwischen Gesichts- und Gehörsempfindung bestehen? Wenn Äther- und Lichtschwingungen ganz verschiedenen Medien angehören, und wenn schon denkbar wäre, daß jene sich nur dem Unwägbaren, diese dem Wägbaren im Nerv mitteilen, so würde es doch mißlich sein, Verschiedenheiten der Materie eine derartige Qualitas occulta beizulegen, daß Verschiedenheiten der Empfindung daran hängen könnten, sofern nicht verschiedene Bewegungsweisen daran hängen. Wenn die Amplitude und Schwingungsdauer der Lichtschwingungen ungeheuer viel kleiner als die der Luftschwingungen ist, und nicht unwahrscheinlich etwas Entsprechendes bei den dadurch in den Nerven angeregten Schwingungen stattfindet, fruchtet dies doch nichts, den Grund-Unterschied in der Qualität beider Empfindungen zu erklären. Denn durch Verkleinerung der Amplitude und Schwingungsdauer bei Tönen, Farben ändert sich immer nur die Stärke und Höhe der Tonempfindung, Helligkeit und Qualität der Farbenempfindung, aber es bleibt Tonempfindung, Farbenempfindung, und zeigt sich nicht die mindeste Tendenz zum Übergange zwischen beiden. Was endlich die Form anlangt, so können Lichtschwingungen äußerlich geradlinig, zirkulär, elliptisch sein, es bleiben Lichtschwingungen. Eben so können Schallschwingungen äußerlich geradlinig, kreisförmig, elliptisch sein, es bleiben Schallschwingungen, und haben wir auch kein Recht, eine unveränderte Übertragung der äußeren Schwingungsform ins Innere anzunehmen, so scheint doch von anderer Seite auch weder ein Grund vorzuliegen, gewisse Schwingungsformen auf gewisse Nerven zu beschränken, noch ein Prinzip, qualitative Empfindungsverschiedenheiten an Formverschiedenheiten der Schwingungen zu knüpfen.
Und hiermit scheinen alle Wege verschlossen, mittelst unserer Hypothese die gestellte Aufgabe in der Allgemeinheit, in der sie zu stellen ist, zu erfüllen.
Ich gestehe, daß die Schwierigkeit in dieser Hinsicht mir lange als eine fast unlösliche vorgeschwebt hat, so daß ich an deren mögliche Lösung vielmehr glaubte, weil ich an die Möglichkeit einer allgemeinen Fassung der Psychophysik glaubte, als daß ich irgend einen Weg dazu hätte zu erkennen vermocht. Auch dürfte ein solcher nicht leicht durch Betrachtungen von allgemeiner Natur zu finden sein. Indem ich aber auf die besonderen Verhältnisse der beiderlei Empfindungen und die Umstände, unter denen sie entstehen, eingehe, scheint mir, daß man dadurch mit einer gewissen Notwendigkeit zu Vorstellungen von einer so fundamentalen Verschiedenheit zwischen den Verhältnissen der ihnen gemeinsam unterliegenden Schwingungsbewegungen geführt wird, daß jene Schwierigkeit, wenn auch nicht vollständig gehoben, doch soweit vermindert erscheint, daß ihre vollständige Hebung als möglich gelten kann, Vorstellungen, die bei einer bloß allgemeinen Betrachtung der Möglichkeiten sich nicht nur nicht begründen ließen, sondern nicht einmal darbieten konnten. Solche Vorstellungsweisen treten im Folgenden als nähere Bestimmungen der vorigen Hypothese auf.
Die zweite Hypothese, die ich demgemäß, und zwar wiederum nicht als der erste, aufstelle, ist die, daß, während faktisch alle Farbenstrahlen des Spektrum durch jede Optikusfaser perzipiert werden können, die Töne verschiedener Höhe innerlich durch verschiedene Fasern des Hörnerven anklingen, so daß jede als eine Saite mit nur Einem Tone, oder vielmehr für einen so kleinen Spielraum von Tönen, daß sie vom Gehöre nicht unterschieden werden können, gelten kann.
Für den ersten Anblick zwar mag nichts unwahrscheinlicher erscheinen, als diese Hypothese, da man keinen Grund hat, den verschiedenen Hörnervenfasern eine verschiedene Spannung wie verschiedenen Saiten beizulegen, noch etwas vorzuliegen scheint, was Schwingungen jeder Tonhöhe den Zugang zu allen Akustikusfasern verwehrte. Die neuesten anatomischen Untersuchungen über das Gehörwerkzeug haben inzwischen gelehrt, daß mit den besonderen Hörnervenfasern besondere elastische Gebilde (die sog. Cortiíschen Fasern in der Schnecke, eigentümliche Borsten im Vorhofe) in Verbindung gesetzt sind, welche geeignet scheinen, nach ihren verschiedenen Dimensionen und Elastizitätsverhältnissen Schwingungen verschiedener Schnelligkeit aufzunehmen und diese den Hörnervenendigungen mitzuteilen, worüber man einige Notizen in folgender Einschaltung nachlesen kann. Ist nun auch eine derartige Deutung dieser Gehilde bis jetzt vielmehr erst eine mögliche als sichergestellte, so ist es doch von großer Wichtigkeit, diese Möglichkeit anatomischerseits begründet zu sehen, nachdem die folgends zu erörternden anderweiteren Gründe mit einer gewissen Notwendigkeit eben dahin zu weisen scheinen.
Eine Abhandlung des um die Anatomie dieses Gegenstandes hochverdienten M. Schultze (über die Endigungsweise der Hörnerven im Labyrinth in Müllerís Arch. 1858. p. 343), schließt p. 380 so:
"Die Cortiíschen Fasern mit den von mir hinzugefügten akzessorischen Gebilden gleicher Natur können als ein Stützapparat für die eingewebten und aufgelagerten zelligen Gebilde und zuleitenden Nervenfasern betrachtet werden. Aber nicht bloß als einen Stützapparat möchte ich die Cortiíschen Fasern betrachtet wissen; es dürfte denselben eine höhere Bedeutung zuzuschreiben sein. Offenbar begünstigt die eigentümlich gebogene Lage dieser Fasern, ihre Befestigung auf der Membrana basilaris mit einem Ende, ihre Steifigkeit und Elastizität, welche sie nach Allem, was man sehen kann, besitzen, das Zustandekommen von Schwingungen derselben, welche die Perzeption der Schallwellen begünstigen können, wenn die perzipierenden Elemente in möglichst nahe Verbindung mit denselben gebracht werden. Die eigentümliche Lage gewisser Nervenzellen in den Winkeln gabelförmig sich teilender Stäbchen, oder eingeklemmt zwischen Lamina spiralis und gebogener Faser dürfte eine solche Annahme noch mehr rechtfertigen, welche zunächst freilich noch, so lange die anatomischen Verhältnisse nicht genauer erforscht sind, ganz in das Gebiet der Hypothese gehört. Wo aber weder das Experiment heranreicht, noch auch, wie hier vorauszusetzen, Erfahrungen über pathologische Verhältnisse bald eine Erklärung geben dürften, mag eine solche, wenn sie das betreffende Gebilde aus dem Zustande des reinen Kuriosen heraus bebt, am Platze sein."
Es ist unmöglich, ohne ausführliche Beschreibung und Hilfe von Abbildungen oder schematischen Figuren eine zulängliche Vorstellung von der komplizierten Einrichtung zu geben, welche der mit den Schneckennervenendigungen in Beziehung gesetzte Cortiísche Apparat in der Lamina spiralis hat, und überall schwer, sich genau darin zu orientieren. Eine durch Figuren erläuterte Übersicht der Resultate der bisherigen anatomischen Untersuchungen, mit Ausnahme der neuesten Arbeit von Deiters, gewährt Funkeís Lehrb. der Physiologie. 3. Aufl. 1860. Bd. II, S. 90 ff. Die vollständigste Untersuchung aber hat (nach einer schon früheren Abhandlung in Siebold und Köllikerís Zeitschrift) Deiters in der kleinen Schrift, "Untersuchungen über die Lamina spiralis membranacea, Bonn 1860", geliefert.
Sehr instruktiv und erleichternd für das Verständnis dieser Schriften war mir ein von Rüte auf Grund der Deiteríschen Schrift im Großen ausgeführtes Modell eines Stückes der Lamina spiralis mit dem Cortiíschen Organe in Holz und Papier. Man erstaunt über die Menge der Partikularitäten, die sich hier dem Blicke auf einmal darbieten, und findet sich überzeugt, daß diese nicht umsonst da sein können.
Um nach Anleitung der Deitersíschen Schrift wenigstens die Punkte der Einrichtung, welche die wesentlichsten zu sein scheinen, zu bezeichnen, so besteht die Lamina spiralis bekanntlich aus einem knöchernen inneren, an den Modiolus der Schnecke, und einem häutigen äußeren, an die Schneckenwand sich ansetzenden, Teile. Dieser häutige Teil ist aber wesentlich doppelt, d. h. schließt zwischen zwei Platten, einer untern, oder der Grundmembran, membrana basilaris, die eine unmittelbare Fortsetzung des Periosts der Scala vestibuli ist, und einer obern, der Deckmembran oder Cortiíschen Membran, einen gegen das Labyrinthwasser abgeschlossenen Hohlraum ein, der jetzt als eine dritte Skala, Scala media, zwischen der Scala tympani und Scala vestibuli betrachtet wird. In dieser Scala media liegt der komplizierte Apparat, womit die Enden der Schneckennervenfasern in Verbindung stehen, und wovon der wichtigste Teil das sog. Cortiísche Organ ist.
Um sich das Cortiísche Organ schematisch vorzustellen, denke man sich eine Art Gewölbebogen oder Dach auf die Membrana basilaris aufgesetzt, gebildet dadurch, daß zwei von der M. basilaris an in schiefer Richtung gegen einander aufsteigende Bogenteile oder Schenkel oberhalb der M. basilaris zusammenstoßen, am Punkte des Zusammentreffens aber nicht sowohl verwachsen, als durch ein Gelenk, eine Art ginglymus (Deiters S. 39) mittelst besonderer Verbindungsteile, welche die Decke des Bogens bilden, beweglich vereinigt sind. Diese Schenkel werden die Cortiíschen Fasern genannt, und zwar der mehr nach dem Modiolus der Schnecke zu auf der M. basilaris aufstehende daselbst festgeheftete als innere oder aufsteigende Faser oder Faser 1. Reihe, der mehr nach der Schneckenwand zu sich an die M. basilaris anheftende, als äußere oder absteigende Faser, Faser 2. Reihe unterschieden. Der ganze Bogen wird durch Anheftungen und Stützmittel in seiner Lage erhalten. Solcher Bogen sind unzählige neben einander längs der ganzen Lamina spiralis gereiht. Wie es scheint (Deiters S. 30), sind sie in der Scala media von Flüssigkeit umgeben, und diese nicht (wie Claudius angegeben) ganz mit Zellenparenchym erfüllt, sondern solches nur an einigen Stellen der Scala media vorhanden, so daß das Cortiísche Organ davon frei bleibt.
Nach Deiters (S. 27. 29) ist die innere Faser wesentlich ein homogenes, solides, plattes, viel weniger dickes als breites Gebilde, starrer, weniger biegsam, spröder, elastischer als die äußere Faser. Die Festigkeit der Substanz der inneren Faser nimmt von ihrem Ansatze nach Oben allmälig zu. "In ihrer normalen gebogenen Lage wird sie in einer gewissen Spannung erhalten, welche sie der geraden Richtung zuzuführen strebt." Die äußere Faser ist hingegen nach Deiters ein rundliches, röhrenförmiges Gebilde, an dem eine Hülle und ein konsistenter Inhalt neben einander zu unterscheiden sind; die Festigkeit der äußeren Faser ist überall gleich, die Elastizität geringer, die Biegsamkeit größer als bei der äußeren Faser, ihr Ende, womit sie auf der Membrana basilaris aufsitzt (Deiters 37), "eine eigentümliche glocken- oder trichterförmige Erweiterung, die mit ihrem Lumen in der Art auf der Grundmembran aufsitzt, daß die letztere sich unmittelbar in die erstere fortsetzt." "Die Glocke steht etwas schief unter spitzem Winkel zur Membrana basilaris" und "kann mit dem Kelche einer Blume verglichen werden."
Es ist mir aus dieser Beschreibung nicht ganz klar, ob die Mündung der Trichter offen gegen das Labyrinthwasser oder durch die Membrana basilaris verschlossen ist.
Die Nervenverteilung im Cortiíschen Organe und dessen Pertinenzien ist sehr kompliziert, und in den Verhältnissen und letzten Endigungen derselben Vieles noch unklar. Hier kann nicht näher darauf eingegangen werden.
Die eigentümlichen Borsten, mit welchen die Enden des Vorhofnerven in Beziehung stehen, haben nach der Abbildung in Funkeís Lehrb. II, S. 91 f. eine verschiedene Länge und ragen frei in das Labyrinthwasser hinein. Mit dem Näheren der anatomischen Untersuchungen darüber bin ich nicht bekannt.
Eine Ausführung der Hypothese, in soweit sie möglich sein sollte, wird überhaupt zunächst den Anatomen, welche genauere Sachkenntnis von den Verhältnissen, die dabei in Betracht kommen, haben, zu überlassen sein; aber die ganze Untersuchung scheint noch nicht auf den Punkt gediehen, der eine solche gestattet.
Dieselbe Hypothese ist nicht nur schon früher, selbst ehe jene anatomische Entdeckung gemacht war, mehrfach aufgestellt worden, sondern auch neuerdings hat sich Helmholtz wiederholt dafür ausgesprochen; und nicht ungern mache ich die Autorität dieses gründlichen und genialen Forschers mit für dieselbe geltend.
In dem amtl. Berichte über die 34. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Karlsruhe 1859. S. 157 (vergl. auch S. 225) ist ein Vortrag desselben "Über physikalische Ursache der Harmonie und Disharmonie" abgedruckt, dem ich folgende Stelle entlehne:
"Im Allgemeinen ist die Luftbewegung, welche von einem musikalischen Instrumente hervorgebracht wird, mathematisch darzustellen als eine Summe von Luftbewegungen, welche verschiedenen einfachen Tönen von n, 2n, 3n etc. Schwingungen entsprechen. Diese Zusammensetzung der Luftbewegung ist allerdings nur eine mathematische Fiktion, und doch finden wir auch im Ohre bei hinreichend aufmerksamer Beobachtung heraus, daß alle die den einzelnen Gliedern jener Reihe entsprechenden Töne empfunden werden, nämlich der von n Schwingungen als Grundton, die übrigen als seine höheren harmonischen Obertöne. Man kann sich in solchen Fällen, wo die Form der Schwingungsbewegungen genau bestimmt werden kann, z. B. bei angeschlagenen Saiten, überzeugen, daß das Ohr alle diejenigen Obertöne hört, deren entsprechende Glieder in dem mathematischen Ausdrucke vorhanden sind, die fehlenden auch nicht hört."
"Diese höchst auffallende und eigentümliche Fähigkeit des Ohres, auf der es auch beruht, daß die verschiedenen Töne eines Akkordes unterschieden werden können, würde ihre Erklärung finden, wenn wir annehmen, daß die eigentümlichen elastischen Plättchen und Härchen, welche in neuester Zeit an den Enden der Hörnervenfasern ansitzend gefunden worden sind, jedes auf einen bestimmten Ton abgestimmt sind, so daß jede Hörnervenfaser nur empfindet, wenn der entsprechende einfache Ton angegeben wird und ihr elastisches Anhängsel vibriert."
Anderwärts (Pogg. Ann. CVIII, 1859. S. 290) äußert er sich wie folgt:
"Ich habe schon an einem anderen Orte die Hypothese ausgesprochen, daß jede Nervenfaser des Hörnerven für die Wahrnehmung einer besonderen Tonhöhe bestimmt ist, und in Bewegung kommt, wenn der Ton das Ohr trifft, welcher der Tonhöhe des mit ihr verbundenen elastischen Gebildes (Cortiíschen Organs oder Borste in den Ampullen) entspricht. Danach würde sich die Empfindung verschiedener Klangfarben darauf reduzieren, daß gleichzeitig mit der Faser, welche den Grundton empfindet, gewisse andere in Bewegung gesetzt werden, welche den Nebentönen entsprechen."
Der auch von Helmholtz geltend gemachte Hauptgrund für unsere Hypothese liegt in dem verschiedenen Verhalten der Aufmerksamkeit zu den Gesichts- und Gehörseindrücken. Wenn Farben durch dieselbe Optikusfaser gemischt eindringen, vermögen wir durch keine Kraft der Aufmerksamkeit die eine vor der anderen ins Bewußtsein zu heben. Wenn hingegen Töne durch dasselbe Ohr eindringen, vermögen wir sie bis zu gewissen Grenzen durch Richtung der Aufmerksamkeit jetzt auf den einen, jetzt auf den anderen Ton zu trennen, und die Bestandteile des zusammengesetzten Tones besonders aufzufassen. Sollten alle gleichzeitig vernommenen Töne eben so gemeinsam durch jede Akustikusfaser perzipiert werden, so ließe sich der Unterschied der Wirkung der Aufmerksamkeit nicht erklären; was dagegen wohl der Fall ist, wenn die verschiedenen Töne durch verschiedene Fasern perzipiert werden, da wir auch von einem Teile des Gesichtsfeldes unsere Aufmerksamkeit beliebig abziehen können.
Ein sehr einfacher und schlagender Versuch kommt dieser Auffassung zu Hilfe:
Man halte vor jedes Ohr eine Taschenuhr, so wird man den Schlag beider Uhren hören, und je nachdem man die Aufmerksamkeit für das eine oder andere Ohr spannt, den Schlag und Takt jeder Uhr als einen von dem der anderen unterschiedenen auffassen können. Sollte die Aufmerksamkeit im Stande sein, das, was sie leisten kann, wo die Schläge beider Uhren durch zwei verschiedene Nerven perzipiert werden, auch noch zu leisten, wenn sie durch denselben Nerven perzipiert werden, so müßte man den Schlag und Takt beider Uhren mittelst demgemäßer Stimmung der Aufmerksamkeit auch noch als einen besonderen auffassen können, wenn man beide Uhren vor dasselbe Ohr hält. Aber dies ist nach einem bekannten Versuche von E. H. Weber 73) durchaus nicht der Fall; die Schläge beider Uhren setzen sich zu einem Geräusche zusammen, in dem man jetzt nur die gemeinsamen Perioden der Verstärkung und Schwächung wahrnimmt, welche man umgekehrt nicht wahrnimmt, wenn man beide Uhren vor die verschiedenen Ohren hält, indes man es ganz unmöglich findet, den Schlag und Takt beider Uhren noch gesondert aufzufassen. Übrigens kann man statt des Geräusches zweier Uhren mit gleichem Erfolge irgend ein anderes Geräusch anwenden, z. B. das Geräusch, was man durch Reiben der Haare zwischen zwei Fingern respektiv vor einem und vor zwei Ohren erzeugt.
73) S. seine Abhandl. über Tastsinn und Gemeingefühl in Wagnerís Wörterb. S. 489.
Wenn Geräusche sehr verschieden sind, so hindert nichts, sie zu unterscheiden und durch Aufmerksamkeit zu trennen, auch wenn sie in dasselbe Ohr eindringen, und täglich vernachlässigen wir, indem wir z. B. auf die Worte eines Redenden achten, und unsere Aufmerksamkeit ganz darauf richten, andere mitgehende Geräusche. Dies kann teils darauf beruhen, daß unsere Aufmerksamkeit sich dem eigentümlichen Takte, den viele Geräusche, wie das Mühlengeklapper, haben, in einem entsprechenden Wechsel zu akkommodieren vermag. Außerdem aber hängt die Möglichkeit der Trennung so sehr an der Verschiedenheit der Geräusche, daß man wohl annehmen darf, sie finde nur nach Maßgabe statt, als die verschiedenen Akustikusfasern in ungleichem Verhältnisse davon affiziert werden, so daß die Aufmerksamkeit einen besonderen Angriff darauf gewinnt. Eine Störung findet immerhin statt, wie ich mich nur eben sehr gestört fand, und schwer verstand, als jemand mit mir sprach, und zugleich die Asche aus dem Ofen gekratzt wurde.
Mit dem vorigen Grunde hängt folgender zusammen: wenn verschiedene optisch einfache Farben durch dieselbe Optikusfaser einwirken, gehen sie in einem Eindrucke unter, welcher wieder den Charakter eines solchen hat, der durch eine optisch einfache Farbe erzeugt wäre, und selbst nahe mit dem Eindrucke einer optisch einfachen Farbe von der mittleren Schwingungszahl übereinkommt; was sich daraus erklären läßt, daß die in derselben Faser sich superponierenden Schwingungen von verschiedener Schwingungsdauer nach Grailichíschem Prinzipe mit einander interferieren. Sollten nun eben so alle Töne durch dieselbe Akustikusfaser eindringen, so ließe sich nicht erklären, warum sie nicht nach einem gleichen Prinzipe durch Interferenz in einem Toneindrucke untergehen sollten, welcher den Charakter eines einfachen Tones trägt, und mit dem eines mittleren einfachen Tones nahe zusammenfällt. In der Tat aber, wenn wir verschiedene Töne zusammen anschlagen, findet nichts der Art statt; der zusammengesetzte Ton hat nicht den Charakter eines einfachen und kann nicht mit einem mittleren Tone zwischen den angeschlagenen verwechselt werden.
Allerdings ist auch bei Tönen die Entstehung neuer Töne durch Interferenz möglich, wie die Entstehung der Kombinationstöne beweist; aber es läßt sich auch beweisen, daß der Kombinationston schon durch die Interferenz der Luftschwingungen außer dem Ohre entsteht, eine objektive Existenz wie die Töne hat, denen er den Ursprung verdankt.74) Dringt nun mit zwei Tönen der durch ihre Interferenz in der Luft erzeugte Tartiniísche Ton zugleich ein, so wird er von seiner besonderen Akustikusfaser perzipiert, und kann deshalb auch von den komponierenden Tönen unterschieden werden, was nicht möglich wäre, wenn er mit ihnen durch dieselbe Akustikusfaser zugleich perzipiert würde.
74) Vergl. Helmholtz, Pogg. XCIX, S. 539.
Versucht man einen Tartiniíschen Ton durch zwei Stimmgabeln vor zwei Obren statt vor einem Ohre zu erzeugen, so wird er nach der (s. o.) angeführten Erfahrung von Dove nicht mehr gehört, weil die Schwingungen jeder Gabel dann merklich gesondert in jedes Ohr dringen, und also der objektive Tartiniísche Ton nicht entsteht, die Seele aber nach dieser Erfahrung selbst nicht die Macht hat, solchen subjektiv aus seinen Komponenten zu bilden.
Hiermit zusammenhängend läßt sich weiter erklären, wie es kommt, daß man im Gebiete der Töne an einem und demselben Eindrucke drei Seiten, Stärke, Höhe, Klang unterscheiden kann, im Gebiete des Lichtes bloß zwei, Stärke und Farbe. Mit dem durch eine Akustikusfaser anklingenden Haupttone kann ein Gemisch höherer Nebentöne durch andere anklingen, und hierdurch eine Zumischung zum Haupttone entstehen, welche als Klang gespürt wird; wogegen dies nicht der Fall ist beim Gesicht, sofern die durch dieselbe Optikusfaser eindringenden verschiedenen Farben sich immer wieder zum Resultate einer einfachen zusammensetzen, die durch andere Optikusfasern eindringenden aber räumlich diskret erscheinen.
Vielleicht steht auch der eigentümliche und durch eine sehr allgemeine Erfahrung konstatierte Umstand, daß Schwerhörige in der Regel musikalische Töne viel besser vernehmen, als Geräusche, mit unserer Hypothese in Beziehung.
Betreffs der übrigens sehr bekannten Tatsache führe ich beiläufig folgende Stelle aus der rationellen Otiatrik von Ehrhard (1859) an:
p. 41. "Meine pathologischen Beobachtungen ergeben, daß der musikalische Sinn in beiderlei Weise mit der Schärfe des Gehörs in Einklang steht; ich habe denselben bei den verschiedensten Graden der Schwerhörigkeit, ja selbst 2 mal bei Taubstummen ausgeprägt gefunden; es ist oft wunderbar zu finden, daß Schwerhörige, die meine Kastenuhr gar nicht, meine Repetiruhr nur wenige Zoll hören, mit Befriedigung ein Konzert besuchen, und die feinsten Nuancen einer Symphonie empfinden. Ich sah in Köln einen Taubstummen, der in der Kirche mitsang, obschon seine Stimme natürlich klanglos war; ich lernte einen Anderen kennen, der sich Pfeifen schnitzte und ihre Reinheit probierte. Die verschiedensten pathologischen Zustande des Gehörorgans, sowohl des akustischen wie des nervösen Apparates, selbst bis zur zentralen Lähmung hinauf, wie ja eben die Taubstummen beweisen, können den einmal vorhandenen musikalischen Sinn nicht töten."
Ein Geräusch läßt sich nämlich als Gemisch vieler Töne von verschiedener Höhe betrachten, die für sich schwach, nur in der Summe stark sind. Im Ohre zerlegt sich das Geräusch bei der Apperzeption in seine Komponenten; und wenn diese die Schwelle nicht oder nur wenig für sich übersteigen, so wird das Geräusch nicht oder nur schwach gehört, indes ein objektiv gleich starker Ton stark gehört wird, weil er sich bei der Apperzeption nicht zerlegt, sondern in derselben Faser konzentriert bleibt.
Weiter trifft mit den bisherigen Gründen folgender zusammen. Die Bedeutung des Oktavenintervalls für die periodische Seite der Skala der Tonempfindung läßt sich mathematisch bloß für einfache Schwingungen begründen, und müßte also, wenn sich die Schwingungen für verschieden hohe Töne in derselben Akustikusfaser zusammensetzen könnten, für Akkorde verloren gehen, was wider die Erfahrung ist.
Endlich scheint mir noch unserer Hypothese eine sehr schlagende Analogie zu statten zu kommen. Unser Auge ist ein dioptrischer Apparat, welcher nach gleichen Prinzipien gebaut ist, als unsere künstlichen dioptrischen Apparate, und insbesondere ganz ähnlich, nur vollkommener, als unsere Camera obscura. Es kann also nicht unangemessen erscheinen, wenn wir auch unsere Ohren einem unserer akustischen Apparate, d. i. musikalischen Instrumente entsprechend gebaut halten, und zwar scheint es am meisten einem Klaviere vergleichbar, wo eine so große Menge Saiten mit zugehörigen Tasten vorhanden ist, daß alle Tonstufen, wenn schon nicht mit absoluter, aber für das praktische Bedürfnis hinreichender Genauigkeit repräsentiert sind, und jede besondere Saite durch einen besonderen Hammer angeschlagen wird, nur daß, wenn die anatomische Andeutung nicht trügt, in unserem Gehörorgane der Hammer es ist, welcher musikalisch gestimmt ist, und durch seinen Anschlag den Ton an die Saite überträgt. Beim Auge ist alle Kunst darauf verwendet, daß Lichtstrahlen, die von einem sichtbaren Punkte herkommen, sich nicht mit solchen mischen, die von anderen Punkten herkommen, sondern gesondert gefaßt werden können. Mit aller Kunst hat sich dies nicht vollständig, aber doch sehr approximativ erreichen lassen. So meinen wir nun auch, daß eine entsprechende Kunst im Ohre verwendet ist, die Töne, die von einem tongebenden Körper herkommen, gesondert von denen perzipieren zu lassen, welche von anderen herkommen; und auch hier wird sich dies nicht vollständig, aber mit entsprechender Approximation haben erreichen lassen.
Hiermit gehen wir auf zwei Einwände über, die man der, schon früher hier und da in Anregung gekommenen, Hypothese entgegenstellen konnte und entgegengestellt hat. 75)
75) Vgl. u. a. Funke Physiol. 1. Aufl. I, S. 690. 3. Aufl. II, 141.
Es läßt sich erstens bemerken, daß die Zahl der Töne selbst nur innerhalb einer Oktave, geschweige innerhalb der ganzen Tonskala, die unserem Ohre zugänglich ist, unendlich ist, und daß wir wirklich alle diese unendlich verschiedenen Töne zu vernehmen vermögen, indes die Zahl der Nervenfasern des Akustikus doch nur eine endliche sein kann; zweitens, daß eine Zerlegung der durch das Labyrinthwasser in Zusammensetzung anlangenden Schallwellen in solcher Weise, daß jede einzelne Faser sich den ihr eigenen Ton herauslese, nach keinem physikalischen Prinzipe vorstellbar sei.
Beiden Einwänden aber läßt sich im Zusammenhange begegnen.
Der erste Einwand würde Stich halten, wenn wir wirklich jeder Faser bloß die Perzeption eines einzigen absolut bestimmten Tones zuzuschreiben hätten, und zugleich würde sich keine physikalische Vorstellung fassen lassen, wie jeder Faser bloß eine absolut einzige Schwingungsart zugeführt werden, oder sie bloß für ihre Aufnahme allein empfänglich gemacht sein sollte. Aber wir haben nur nötig anzunehmen, wie auch von Anfange an geschehen, daß jede Faser einen Spielraum von Tönen hat, der klein genug ist, daß er die Unterschiedsschwelle nicht erreicht oder übersteigt. Dann wird es nicht nur möglich, die Kontinuität der Tonempfindungen durch die ganze Skala der Töne mit einer endlichen Zahl von Fasern zu erhalten, sondern es lassen sich auch physikalische Wege denken, jede Faser unter Bedingungen zu versetzen, daß ihr aus einem Tongemisch nur Schwingungen innerhalb eines kleinen Spielraums zukommen, und in den angeführten Entdeckungen über die Struktur des Gehörorgans Andeutungen finden, daß solche Bedingungen wirklich erfüllt sind. Zwar fordert auch diese Voraussetzung, wenn schon keine unendlich große, aber noch eine ungeheure Zahl Nervenfasern; aber da diese Bedingung wirklich erfüllt ist, so spricht dies vielmehr für als gegen die Voraussetzung. Kölliker fand, wie ich einer Notiz in Funkeís Physiol, 1. Aufl. (S. 683) entnehme, in der Schnecke des Ohres "eine 18'" lange Reihe von mehr als 3000 mit mathematischer Gesetzmäßigkeit neben einander gelagerter Nervenenden." Kölliker hielt die Cortiíschen Fasern für Nervenenden; aber dies ändert den Gesichtspunkt nicht, da denselben Nervenfasern entsprechen. Es würde ganz unmöglich sein, eine teleologisch zulängliche Vorstellung zu fassen, wozu so viele, so eigentümlich armierte Nervenfasern dienen sollten, wenn jede Faser alle Töne gleichzeitig aufnehmen und erst die Seele solche scheiden sollte.
Dem Einwände, daß eine physikalische Vorrichtung undenkbar sei, welche die einzelnen Komponenten einer resultierenden Tonmischung wieder zu trennen, und den verschiedenen Nervenelementen zuzuführen vermöge, wird eben so durch Tatsachen wie durch Theorie widersprochen.
Bekannt und zweifelfrei ist das Experiment, daß sich manche Gläser durch Hineinschreien eines gewissen Tones, aber nicht anderer Töne zersprengen lassen. Ein solches Glas wählt also zwischen den Tönen, schwingt nur mit einem gewissen Tone hinlänglich stark mit, um zersprengt zu werden. So erzittern die Fensterscheiben vorzugsweise unter dem Einflusse gewisser Töne; so bringt eine schwingende Saite vor anderen nur die gleichgestimmte zum Mitschwingen. Dabei ist überall gleichgültig, ob noch andere Töne außer den betreffenden mitklingen.
Inzwischen eben so gewiß, als diese Auswahl ist, so gewiß ist, daß sie nicht absolut auf einen einzigen bestimmten Ton beschränkt ist. Einmal kann weder das Glas, noch die Fensterscheibe, noch die Saite absolut genau auf den Ton gestimmt sein, der sie zum Mitschwingen bringt. Außerdem würde jene Annahme sich mit den Gesetzen der Tonmitteilung nicht vertragen.
In der gründlichen Abhandlung A. Seebeckís "Über Schwingungen unter der Einwirkung veränderlicher Kräfte"76), ist der Fall allgemein behandelt, daß einem plattenförmigen Körper N, welcher (wie wir von den Cortiíschen Fasern mindestens erster Reihe, und den Borsten an den Enden des Hörnerven voraussetzen) einer selbständigen Schwingung von der Periode n fähig ist, oder, kurz gesagt, auf den Ton n gestimmt ist, in einem widerstehenden Medium77), durch dieses Medium Schwingungen eines selbsttönenden Körpers M 78) von der Periode m zugeführt werden. Hiernach gilt mathematischerseits Folgendes.79)
77) Seebeck behandelt den Fall für Luft; indes hindert prinzipiell nichts die Übertragung auf Wasser.
78) Im Originale ist M von der Masse des resonierenden Körpers gebraucht. Übrigens stimmen unsere Bezeichnungen mit denen des Originals überein.
79) Der zweite und vierte der folgenden Sätze ist aus
der S. 265 mitgeteilten Formel zu folgern.
2) Das Mittönen nach der Periode m ist um so stärker, je weniger die Periode m von der eignen Periode n des mittönenden Körpers unterschieden ist; und wenn beide Perioden beträchtlich verschieden sind, so findet ein merkliches Mittönen nur bei Flächen statt, welche verhältnismäßig ihres Areals wenige Masse haben.
3) Wird der Körper N statt durch eine einfache Schwingungsbewegung durch eine zusammengesetzte zum Mittönen angeregt, so gilt dasselbe für die einzelnen Komponenten der Schwingung: "namentlich macht der Körper nur die Bewegungen merklich mit, welche von seiner eigenen Periode nicht zu sehr verschieden sind."
Hiernach kann man die Möglichkeit einer Auswahl von Tönen aus einem Tongemisch durch geeignete physikalische Veranstaltungen eben so experimental als mathematisch begründet halten.
4) Einem je größeren Widerstande der Körper N bei seinen Schwingungen durch das umgebende Medium unterliegt, desto größer kann die Differenz zwischen n und m sein, bei welcher er noch merklich in der Periode m mitschwingt, wonach die Umgebung des Hörnervenenden-Apparates mit Wasser statt mit Luft außer einer schnellen Dämpfung des Nachklingens auch den Erfolg haben könnte, den Spielraum der Töne, von welchem die Endplättchen anklingen können, etwas zu erweitern.
Inzwischen gibt es zwei andere Schwierigkeiten der Hypothese, die zwar nicht als durchschlagend anzusehen, aber doch auch eben so wenig schon zulänglich gehoben sind, und auf deren genauere Untersuchung und hoffentlich Beseitigung daher das Augenmerk hinzulenken ist.
Die erste ist die, daß die Cortiíschen
Fasern in der Schnecke und Borsten in den Ampullen nur vermöge einer
Verschiedenheit ihrer Dimensionen, Substanz oder Anbringungsweise auf einen
verschieden hohen Ton gestimmt sein können. Nun bin ich mit den schon
zu großer Ausdehnung gediehenen anatomischen Untersuchungen über
diesen Gegenstand bei Weitem nicht hinlänglich bekannt80),
um sagen zu können, was etwa Genaueres von Bestimmungen darüber
vorliegt. Über die Borsten vergl. in dieser Hinsicht die bereits genannten
Bemerkung. Die Cortiíschen Fasern aber scheinen in der ganzen Länge
der Schnecke einander sehr ähnlich zu sein, und auch von einer verschiedenen
Anbringungsweise finde ich nichts gesagt. Namentlich bemerkte Kölliker81)
gegen die von Helmholtz ausgesprochene Hypothese ausdrücklich: "Daß
die Größendifferenzen der Teile des Cortiíschen Organs
nur minimal sind, die Teile scheinen gegen die Kuppel zu länger zu
werden." Helmholtz erklärte hierauf "die Längenmessungen für
weniger wichtig, als die der Dicke." Nur dürfte zu bemerken sein,
daß die transversale Schwingungszahl eines parallelepipedischen Stabes
bei gleicher Anbringungsweise unabhängig von der Breite, aber proportional ![]() ist, wenn d die Dicke, l die Länge des Stabes ist 82),
wonach Längenänderungen doch einen größeren Einfluß
auf die Tonhöhe haben würden, als Dickenänderungen.
ist, wenn d die Dicke, l die Länge des Stabes ist 82),
wonach Längenänderungen doch einen größeren Einfluß
auf die Tonhöhe haben würden, als Dickenänderungen.
81) In dem S. 279 angezeigten Berichte der Karlsruher Versammlung S. 216.
82) vgl, mein Repertor. der Experimentalphysik. Th. I, S.
274.
Die dritte Hypothese trägt einige der allgemeinsten Verhältnisse, welche zwischen den äußeren Licht- und Schallschwingungen bestehen, auf die dadurch erweckten inneren Schwingungen nach inneren Gründen über.
Unser Hören beruht unter normalen Verhältnissen auf longitudinalen Luftschwingungen, welche unser Trommelfell normal treffen, indem auch von den schief gerichteten Schwingungen doch nur die nach der Normale zerlegten wirksam sein können, die Bewegungen der Gehörknöchelchen zu bewirken, welche die Schwingungen an die fenestra ovalis übertragen; hingegen beruht das Sehen auf transversalen Lichtschwingungen. Jene lassen sich wesentlich als geradlinige fassen, diese können geradlinig sein, aber auch alle mögliche kreisförmige, elliptische und zusammengesetzte Formen haben und haben solche wirklich.
Die Hypothese, welche von uns gebraucht wird, ist nun die, daß, dieser normalen Form der äußeren Anregungen entsprechend, das Hören auch innerlich seiner psychophysischen Unterlage nach auf einfachen geradlinigen, das Sehen auf Schwingungen von weniger bestimmten wechselnden Formen beruht. Es ist dies eine Hypothese, denn an sich ist nach der Auseinandersetzung (s. o.) nicht zu erwarten, daß die äußeren Schwingungen sich in unveränderter Form ins Innere an unseren Nervenapparat übertragen. Auch besteht unsere Hypothese nicht darin, daß die innere Form der äußeren vermöge direkter Übertragung der äußeren, sondern wegen Anpassung der inneren Bedingungen zu einer im Allgemeinen entsprechenden Form als die äußeren haben, entspreche, so daß z. B. im Hörnerven die Schwingungen auch dann einfach geradlinig ausfallen, wenn die anregenden Schwingungen ausnahmsweise durch die Kopfknochen in irgendwelcher anderen Richtung und Form als gewöhnlich durch das Trommelfell zutreten, und daß auch beim Auge sich nicht geradlinige Schwingungen des Lichtstrahls unverändert in geradlinige, kreisförmige in kreisförmige übersetzen, was vielmehr, wie (Kap. 32) gezeigt, einen Widerspruch zwischen Erfahrung und Theorie setzen würde, sondern daß nur überhaupt nach der Einrichtung des Sehapparates innerlich dergleichen verschiedene Formen so gut wie äußerlich entstehen können.
Der Hauptgrund für diese Hypothese fällt wesentlich mit einem der Gründe für die vorige Hypothese zusammen. Die Bedeutung des Oktavenintervalles, welche sich durch die Elementaranalyse der Empfindungsverhältnisse zum Schlusse des 30. Kapitels und im 32. Kapitel herausgestellt hat, gilt wesentlich nur für einfache geradlinige Schwingungen. Eine Theorie welche mittelst solcher Analyse Rechenschaft von dieser Bedeutung des Oktavenintervalles für die Töne geben will, muß also voraussetzen, daß die Schwingungen in den Nerven, auf denen die Empfindung der Töne beruht, geradlinig und daß sie nicht zusammengesetzt sind, wovon Erstes der jetzigen, das Zweite der vorigen Hypothese entspricht. Sie muß aber zur Erklärung, warum das Oktavenintervall nicht dieselbe Bedeutung für die Farben als Töne hat, zugleich voraussetzen, daß die Schwingungen in den Nerven, welche den Farben unterliegen, nicht eben so einfach geradlinig sind.
Zur Unterstützung kann dann wieder das Vorkommen der Tastenapparate an den Enden des Hörnerven zugezogen werden, welches die Entstehung einer immer identischen einfachen Schwingungsform hier leicht denkbar macht, indes ähnliche Apparate an den Enden des Sehnerven fehlen, und der Gesichtspunkt; daß eine Einrichtung der Sinnesorgane auf ein gewisses allgemeines Entsprechen zwischen der Form der äußeren anregenden und innerlich angeregten Schwingungen an sich natürlich erscheint.
Übrigens würde nicht nötig sein, eine mathematisch geradlinige Form für die Schwingungen im Gehörnerven vorauszusetzen, sondern genügen, daß sie nur sehr wenig von der geradlinigen abweichen; da überall sehr kleine Abweichungen die Empfindung nicht merkbar affizieren.
Die vierte Hypothese, die ich aufstelle, widerspricht den gewöhnlichen Annahmen gewissermaßen im umgekehrten Sinne als die zweite. Nach der zweiten liest sich jede Akustikusfaser aus einem zusammengesetzten objektiven Tongemische ihre besondere Schwingungszahl heraus, nach unserer jetzigen vollzieht umgekehrt jede Optikusfaser unter dem Einflusse selbst des einfachsten Farbenreizes eine Zusammensetzung von Schwingungen, und während es keine ähnlich zusammengesetzten subjektiven Töne als objektiven gibt, gibt es keine in ähnlichem Sinne einfachen subjektiven wie objektiven Farben, sondern die einfachste objektive Farbe ruft bloß die verhältnismäßig einfachste subjektive Farbenmischung, d. i. Zusammensetzung von Schwingungen verschiedener Dauer hervor, und die Qualität der Empfindung, welche daran hängt, beruht auf der Zusammensetzungsweise dieser Mischung.
Der bindendste Grund für diese Ansicht scheint mir in der Abweichung zu liegen, welche die Farben nach der Bemerkung Th. I, S. 175 und den Angaben Th. II, Kap. 33b vom Weberíschen Gesetze darbieten. Wenn die den äußeren Schwingungszahlen n, n', n".... entsprechenden inneren Schwingungszahlen bei einfachen homogenen Farben eben so einfach wieder n, n', n" sind, als wir es bei einfachen Tönen Grund haben anzunehmen, so läßt sich für die Abweichung derselben vom Weberíschen Gesetze keine Erklärung finden. Wenn jedoch bei Farben jeder einfachen äußeren Schwingung eine zusammengesetzte innere Schwingung entspricht, so läßt sich übersehen, daß die Unterscheidbarkeit zweier Farben nicht mehr bloß von den Verhältnissen der äußeren Schwingungszahlen nach dem Weberíschen Gesetze für sich abhängig gemacht werden kann, sondern eine komplexe Form der Verhältnisse werden muß, mit welchen die komponierenden Strahlen in das erweckte Farbengemisch eingehen.
Zugleich läßt sich unter der im Abschnitte a) mit großer Wahrscheinlichkeit begründeten Voraussetzung, daß die Schwingungszahlen der Netzhaut eine gewisse Grenze nicht zu überschreiten vermögen, übersehen, daß an den Grenzen des sichtbaren Spektrum die Unterscheid-barkeit der Farben verhältnismäßig geringer sein muß, als nach der Mitte, wie es nach Erfahrung wirklich der Fall ist. Denn nach Maßgabe, als der erregende Strahl sich von dem mittleren Teile des Spektrum einer der Grenzen nähert oder gar über die Grenze hinausgeht, über welche die Schwingungszahlen der Netzhaut nicht reichen, werden verhältnismäßig die Schwingungszahlen der mittleren Strahlen überwiegend bleiben, und wird also auch um so weniger leicht im Fortschritte nach den Grenzen eine Unterscheidung von den nach der Mitte liegenden Strahlen möglich sein.
Wenn sich überhaupt fragt, in welchem Verhältnisse sich das innere Farbengemisch, was nach uns voraussetzlich durch einen einfachen homogenen Farbenstrahl erweckt wird, aus Komponenten zusammensetzt, so haben wir, falls wir die Hypothese statuieren, unstreitig zwei Momente in Betracht zu ziehen. Von einer Seite ist zu erwarten, daß die Schwingungszahl der erregenden Farbe mit der größten Stärke in dem erregten Gemische wiederklinge und die anderen Zahlen nach Maßgabe schwächer, als ihre Zahlen weiter davon abweichen. Von anderer Seite aber ist zu erwarten, sofern die Erregbarkeit der Netzhaut überhaupt nur innerhalb gewisser Grenzen der Schwingungszahlen eingeschränkt ist, daß eine Schwingungszahl mit verhältnismäßig um so größerer Stärke entsteht, je weiter sie von dieser Grenze entfernt ist, so daß schließlich beide Umstände in Verbindung in Betracht kommen.
Die Grenzen der inneren Schwingungszahlen werden hiernach enger sein müssen, als die der äußeren, wodurch sie erregt werden, weil eine äußere Schwingungszahl, welche so hoch oder niedrig ist, daß die Netzhaut ihr nicht mehr zu korrespondieren vermag, doch noch schwache Schwingungen zu erwecken und dadurch sichtbar zu werden vermag, die zwischen die Grenzen der erregbaren fallen, so daß das äußerste Rot und Violett innerlich als durch Schwingungen gebildet angesehen werden muß, welche an die Langsamkeit und Schnelligkeit der äußeren nicht mehr reichen.
Abgesehen von diesen subjektiven Momenten wird die Helligkeit, mit der jeder Teil des Spektrum erscheint, noch von der objektiven Intensität, mit welcher der Lichtstrahl auf die Netzhaut trifft, abhängen, welche nach den Erörterungen im Abschnitte a) unter Voraussetzung der Identitätsansicht von Licht und Wärme für den sichtbaren Teil des Spektrum durch die thermischen Wirkungen als gegeben angesehen werden kann, sofern in diesem Teile (nach Kap. 33a) keine ungleichförmige Absorption durch die Augenmedien besteht.
Vielleicht könnte man meinen, daß die Abweichung der Farben vom Weberíschen Gesetze mit der nach der Stelle des Spektrum variabeln Helligkeit derselben zusammenhinge. Aber dann müßte auch bei Tönen die Unterscheidbarkeit der Höhen mit von Verhältnissen der Stärke abhängen, was nicht der Fall ist.
Mit Vorigem erklärt sich dann zugleich, warum die Farbe überhaupt vielmehr dem Klange, dem Gemische von Tönen, als dem einfachen Tone analog scheint, und etwas der Höhe der Töne Entsprechendes bei Farben nicht vorkommen, hingegen vielmehr die Beurteilung derselben nach ihrer Abweichung vom Weiß oder als Bruchteile des Weiß sich geltend machen kann, sofern selbst der einfachsten objektiven Farbe ein subjektives Farbengemisch entspricht, analog dem, was entstände, wenn alle möglichen Töne innerhalb eines gegebenen Intervalles zusammen angeschlagen würden. Dabei bleibt aber doch die Verschiedenheit, daß der gemischte Ton sich aus Tönen zusammensetzt, die in verschiedene Akustikusfasern fallen, die gemischte Farbe aus solchen, die in dieselbe Faser fallen, was beiträgt, zu erklären, daß doch Klang nicht Farbe ist.
Es wird ferner nun um so leichter erklärlich, wie eine Komposition zweier objektiv einfachen Farben einen entsprechenden Eindruck als eine einfache Farbe hervorbringen kann, da selbst die objektiv einfache eine subjektiv zusammengesetzte repräsentiert.
Inzwischen fragt sich, ob die Hypothese überhaupt möglich, und nach den Bedingungen, unter denen die Farben im Auge entstehen, wahrscheinlich ist.
Nun kennen wir die mechanischen Bedingungen, unter denen sich die Lichtschwingungen in Nervenschwingungen übersetzen, nicht hinlänglich, um der Hypothese danach a priori widersprechen oder sie dadurch stützen zu können. Die Möglichkeit derselben aber läßt sich durch Tatsachen beweisen, und die Wahrscheinlichkeit derselben durch solche stützen. In dieser Hinsicht mache ich Folgendes geltend.
1) Selbst im Gebiete der objektiven Lichtlehre kann eine einfache homogene farbige Schwingung in einem Medium durch Mitteilung ein anderes zu einer zusammengesetzten Farbenschwingung anregen. Es ist dies nämlich der Fall der Fluoreszenz. Bekanntlich wird durch fluoreszierende Substanzen die Schwingungszahl der brechbareren Farben überhaupt erniedrigt; aber nach den Untersuchungen von Stokes geschieht dies im Allgemeinen nicht so, daß die homogene Farbe sich in eine andere homogene von geringerer Schwingungszahl umsetzt; sondern das, durch homogene Farbenstrahlen hervorgerufene, dispergierte Licht findet sich im Allgemeinen mehr oder weniger zusammengesetzt.
Ob nun von den Gesetzen der Fluoreszenz eine speziellere Anwendung auf unseren Fall zu machen, und dem Umstande, daß die Netzhaut selbst nach dem Tode noch eine gewisse Fluoreszenz zeigt, wie Helmholtz ermittelt hat (vgl. Kap. 33a), eine gewisse Bedeutung hierbei beizulegen, kann hier zunächst ganz dahingestellt bleiben; es wird der Fluoreszenz wesentlich nur insofern gedacht, als ihre Tatsache beweist, daß unsere Hypothese nichts den allgemeinen Bewegungsgesetzen Widersprechendes, sondern wirklich Vorkommendes fordert83), mögen auch im Übrigen die Verhältnisse und Gesetze der Fluoreszenz, deren Grund selbst noch nicht ergründet ist, ganz andere sein. Nicht eine Analogie mit der Fluoreszenz, sondern Tatsachen anderer Natur scheinen mir die jetzige Hypothese zu fordern.
3) Dieser Grund verstärkt sich dadurch, daß in abnormen Fällen gar keine Farben mehr unterschieden werden, indes doch der Lichteindruck der Farben noch fortbesteht. Dies scheint keine andere Deutung zuzulassen, als daß in solchen Fällen jeder äußere Farbenstrahl alle Farbentätigkeiten in innerlich gleichem Verhältnisse auslöst, und die bekannten Fälle fehlerhaften Farbesehens scheinen ebenfalls am leichtesten ihre Erklärung dadurch zu finden, daß das normale Verhältnis zwischen den Komponenten des Farbengemisches gestört ist.
"Die Achromatopsie, sagt Rüte, umfaßt den Zustand, wobei der Kranke keine deutliche Idee von den Farben hat, wobei er weder Gelb noch Rot, noch Blau zu unterscheiden vermag, wo Alles grau erscheint (selten). óBeispiel in Hudartís Brief an Joseph Priestley (Philosophical transacfions 1777. p. 260). Vier Brüder konnten nur Weiß und Grau unterscheiden. Ein anderes, von Rosier mitgeteiltes Beispiel s. in dessen Observations sur la physigue et l' histoire naturelle vol. VIII. p. 87. année 1779."
Die verschiedene Empfindlichkeit für Farben, die sich abnormer Weise zwischen verschiedenen Individuen zeigt, zeigt sich sogar normalerweise in gewissem Sinne zwischen verschiedenen Stellen der Netzhaut, wie die oben angeführten Erfahrungen von Helmholtz lehren.
4) Der eigentümliche Umstand, daß alle einfachen wie zusammengesetzten Farben sich um so mehr dem Weiß nähern, je mehr man die Intensität derselben verstärkt (s. o.), läßt nach unserer Hypothese die Deutung zu, daß das verhältnismäßige Übergewicht der, der erregenden entsprechenden Hauptfarbe über die Beifarben sich mit wachsender Amplitude immer mehr mindert, und überhaupt die verhältnismäßige Stärke der Komponenten der erregten Farben sich immer mehr der im Weiß stattfindenden nähert. Wie nun dies nach mechanischen Gesetzen geschehen könne, mag noch Gegenstand der Frage sein; es scheint mir aber, daß ohne die Hypothese die Tatsache, um die es sich hier handelt, überhaupt unerklärlich bliebe.
Allerdings auch die Tonhöhe ändert sich mit der Amplitude der Schwingungen. Der Ton einer transversal schwingenden Stimmgabel zieht sich bekanntlich beim Verhallen, wo die Schwingungen kleiner werden, etwas in die Höhe 84), und überhaupt ist es nach W. Weber eine Eigenschaft aller transversal schwingenden Körper, daß ihr Ton etwas tiefer bei größerer als bei kleinerer Amplitude ist, insofern nicht Spannungsänderungen dabei stattfinden, indes für alle longitudinalschwingenden Körper, ganz besonders Luftsäulen, das Entgegengesetzte gilt. Transversalschwingende Saiten freilich klingen etwas höher bei größerer oder kleinerer Exkursion, aber nur, weil ihre Spannung bei größerer Exkursion größer wird 85). Keinesfalls aber wird der Ton durch seine Verstärkung einem Geräusche ähnlicher. Ich habe mir sogar von einem Musiker sagen lassen, daß durch reichere Besetzung eines Orchesters oder Chores der Ton, wie er sich ausdrückte, etwas Idealeres erhalte, indem die dem Tone fremdartigen Nebengeräusche dann verhältnismäßig weniger spürbar würden.
85) Vgl. W. Weber, Pogg. XXVIII, 6.
Jedes mit dem anderen solidarisch zur Lichtempfindung zusammenwirkende Teilchen entspricht, in soweit ihm eine Bewegung von einfacher Periode beigelegt werden kann, mit seiner eigentümlichen Schwingungszahl einer gewissen einfachen objektiven Farbe, die wir aber nie einfach erblicken, und nach der Natur der Lichtempfindung gar nicht einfach erblicken können, da die einfachste Lichtempfindung überall schon das solidarische Zusammenwirken verschieden erregbarer und erregter Teile voraussetzt.
Wie viel in den Molekülen auf das Wägbare und Unwägbare insbesondere zu rechnen, mag für jetzt unentschieden bleiben; da wir keine hinreichenden Kenntnisse haben, um es zu sondern, wennschon ich mir denke, daß die Lichtempfindung wesentlich auf den Schwingungen des Unwägbaren ruht, die deshalb für verschiedene Ätherteilchen verschieden sind, weil nicht alle sich unter den gleichen Verhältnissen zu den wägbaren Teilchen befinden. Es herrscht aber selbst unter den mathematischen Physikern noch so viel Schwanken über den Anteil, der den wägbaren Teilchen an dem Zustandekommen der objektiven Lichterscheinungen in den Körpern beizulegen, daß ich nicht wagen möchte, irgends entschiedene Voraussetzungen auszusprechen.
Diese Hypothese ist eine nähere Bestimmung der vorigen, nach welcher jeder noch so einfachen erregenden äußeren Farbenschwingung innerlich eine Mehrheit von Schwingungszuständen mit verschiedenen Perioden und Amplituden entspricht. Nun kann aber nach den Prinzipien der Interferenz auch ein einzelnes Teilchen in verschiedenen Schwingungszuständen gleichzeitig als begriffen angesehen werden, und die vorbesprochenen Tatsachen ließen noch sehr wohl die Deutung zu, daß alle zum Sehen beitragenden Bewegungen als zusammengesetzte Schwingungsbewegungen zu fassen seien, welche sich eben so an allen einzelnen, zum Sehen beitragenden Teilchen wiederholen, wie es bei den zum Hören beitragenden einfachen Schwingungsbewegungen voraussetzlich der Fall ist. Aber andere faktische Verhältnisse scheinen die jetzige Hypothese zu fordern, welche nicht ausschließt, daß auch die einzelnen Teilchen eben so in zusammengesetzte wie einfache Schwingungsbewegungen geraten können.
Ehe wir auf die Gründe für die Hypothese eingehen, wird sie etwas näher zu entwickeln sein.
Des Näheren werden wir uns nach dieser Hypothese ein zur Lichtempfindung anregbares Molekül als ein System mehrerer Teilchen (Atome) zu denken haben, deren jedem, wenn es aus seiner ursprünglichen Gleichgewichtslage verrückt wird und sich selbst überlassen bleibt, nach seiner relativen Entfernung und Masse gegen die anderen eine eigentümliche Schwingungszahl zukommt, etwa wie Stimmgabeln, Stäben oder Saiten, die durch Befestigung auf einem gemeinsamen Resonanzboden zu einem Systeme verbunden sind, nur daß die Bestimmung zu einer eigentümlichen Schwingungszahl für jeden dieser zum Systeme verbundenen Körper durch das Verhältnis seiner eigenen Teile gegen einander gegeben ist, für die zum Molekül verbundenen Teilchen aber durch ihr Verhältnis zu den anderen Teilchen desselben Moleküls 86). Schon ohne äußeren Lichtreiz sind alle erregbaren Teilchen in einer gewissen Schwingungsbewegung begriffen, wovon die farblose Empfindung des Augenschwarz abhängt. Wenn die Amplituden derselben sich absolut bei unverändertem Verhältnisse ihrer Größe und unveränderter Schwingungszahl vergrößern, so entsteht die Empfindung des weißen Lichtes; hingegen die Empfindung der Farbe, wenn die Schwingungsprodukte an, a'n', a"n"..., welche den einzelnen Teilchen zukommen, ein anderes Verhältnis annehmen, als dem farblosen Augenschwarz entspricht.
Folgendes die Gründe für diese Hypothese.
1) Das Licht beweist durch seine chemische Wirksamkeit, daß es wirklich in die inneren Verhältnisse der Moleküle abändernd einzugreifen vermag, und die hier über seine Wirksamkeit als Sinnesreiz aufgestellte Ansicht verlangt nichts Anderes. Was wir von der Übertragung der Schallschwingungen an den Hörnerven wissen, begünstigt keine entsprechende Ansicht bezüglich des Schalles.
2) Jeder Lichtreiz ändert durch seine Einwirkung selbst die Weise, wie er empfunden wird, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ab, um so mehr, je stärker er ist, woraus mannigfache subjektive Phänomene hervorgehen.
Für alle diese Phänomene, so wenig sie im Einzelnen erklärt und bis jetzt erklärbar sind, läßt sich doch im Sinne unserer Hypothese folgender allgemeine Gesichtspunkt der Erklärung aufstellen.
Der Lichtreiz hat nicht bloß den Effekt, die zur Lichtempfindung solidarisch zusammenwirkenden Teilchen zu Schwingungen um die gegenwärtigen Gleichgewichtslagen anzuregen, oder die vorhandenen Schwingungen zu vergrößern, sondern auch die Gleichgewichtslagen selbst zu ändern, so daß die Teilchen während der Einwirkung des Reizes um andere Gleichgewichtslagen als sonst schwingen, womit sich zugleich die Verhältnisse ihrer Schwingungsprodukte an, a'n'... abändern. Diese Änderung tritt mehr oder weniger allmälig unter der Einwirkung des Reizes ein (vgl. hierzu die bereits gen.Tatsachen), und verschwindet allmälig wieder nach Wegfall des Reizes, so aber, daß die Teilchen nach der Wiederkehr zu den alten Gleichgewichtslagen nicht sofort dabei stehen bleiben, sondern dieselben überschreiten und in entgegengesetzter Richtung dazu zurückkehren, welche Oszillationen noch mehrmals wiederholt werden können. Diese langsamen Oszillationen der Gleichgewichtslagen der Teilchen, von welchen die Periodizität beim Abklingen der Nachbilder abhängt, sind aber nicht mit den schnelleren Oszillationen der Teilchen um die jedesmalige Gleichgewichtslage (wovon die Farbenempfindungen selbst abhängen) zu verwechseln, und es können zur kurzen Unterscheidung jene als Oszillationen erster Ordnung, diese zweiter Ordnung bezeichnet werden.
Man kann sich denken, daß die langsamen Oszillationen wesentlich die wägbaren Teilchen betreffen, welche aber Veränderungen in den davon mit abhängigen Oszillationen der unwägbaren nachziehen. Doch lasse ich dies dahingestellt.
Ich muß jetzt Plateau gegen meine frühere Ansicht darin Recht geben, daß die oszillatorische Form im Ablaufe der Nachbilder die wesentliche Form derselben ist, wobei die erste Phase leicht wegen zu großer Schnelligkeit, mit der sie vorübergeht, die letzten wegen zu großer Schwäche oft nicht wahrgenommen werden, ohne daß übrigens damit die von mir gegenüber aufgestellte Ansicht, daß man in dem Phänomen der Nachbilder einen Konflikt der Nachdauer und Abstumpfung zu sehen habe, aufgehoben wird, denn dies ist im Grunde bloß ein kurzer Ausdruck tatsächlicher Verhältnisse und keine Hypothese. Eine periodische Form dieses Konfliktes aber, die ich früher glaubte, nur unter exzeptionellen Bedingungen anerkennen zu müssen, ist unstreitig nach folgenden Gründen die normale Form.
Zuvörderst läßt sich dieselbe unter besonderen Versuchsbedingungen 87) vollständig beobachten, und wo sie nicht vollständig erscheint, doch aus folgenden Verhältnissen erkennen. Jeder Lichteindruck klingt nach Beseitigung des Reizes erst in einer positiven Phase89) nach, wie die gedrehte Scheibe mit weißen und schwarzen oder farbigen Sektoren und die Nachbilder blendender Eindrücke beweisen; darauf folgt eine negative, nach farbigen Eindrücken komplementäre, Phase und diese kehrt in den Fällen gewöhnlicher Nachbilder allmälig zum ursprünglichen Zustande zurück, ohne darüber hinauszugehen, indes unter besonderen Versuchsverhältnissen erwähntermaßen mehrere Oszillationen zwischen primärer und komplementärer Farbe oder Erscheinen und Verschwinden des Nachbildes folgen. Aber auch die Rückkehr zum ursprünglichen Zustande muß doch als eine Oszillation in entgegengesetztem Sinne als der vorherige Gang betrachtet werden, und es wäre gegen alle Analogie, anzunehmen, daß die rückgehende Oszillation bei der ursprünglichen Gleichgewichtslage stehen bliebe, und zeigt sich auch nicht so bei jenen Versuchsbedingungen, wogegen sich leicht denken läßt, daß das Überschreiten derselben in entgegengesetztem Sinne vielfach zu gering ist, um noch Phänomene zu geben, welche die Schwelle der Wahrnehmbarkeit überschreiten; wie denn auch bei einer in einem stark widerstehenden Mittel schwingenden Saite der Fall eintreten kann, daß sie nach Rückkehr zur ursprünglichen Lage dieselbe nur noch unmerklich überschreitet; doch ist diese Rückkehr Sache einer Oszillation.
88) Positiv und negativ in Brückeís Sinne verstanden.