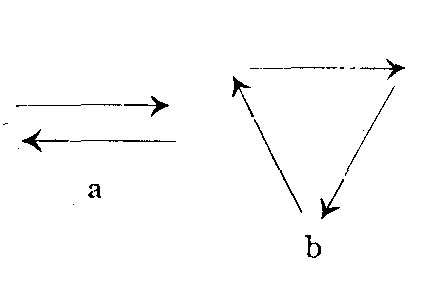
1.
Wir versuchen nun von dem gewonnenen Standpunkte einen orientierenden
Ausblick für unseren besonderen Zweck.
Hat der forschende Intellekt durch Anpassung die
Gewohnheit erworben, zwei Dinge A und B in Gedanken zu verbinden,
so sucht derselbe diese Gewohnheit auch unter etwas veränderten Umständen
nach Möglichkeit festzuhalten. Überall, wo A auftritt,
wird B hinzugedacht. Man kann das sich hierin aussprechende Prinzip,
welches in dem Streben nach Ökonomie seine Wurzel hat, und welches
bei den großen Forschern besonders klar hervortritt, das Prinzip
der Stetigkeit oder Kontinuität nennen.
Jede tatsächlich beobachtete Variation in der
Verbindung von A und B, welche groß genug ist, um bemerkt
zu werden, macht sich aber als Störung der bezeichneten Gewohnheit
geltend, so lange, bis die letztere genügend modifiziert ist, um diese
Störung nicht mehr zu empfinden. Man hätte sich z. B. gewöhnt,
das auf die Grenze von Luft und Glas einfallende Licht abgelenkt zu sehen.
Diese Ablenkungen variieren aber von Fall zu Fall in merklicher Weise,
und man kann die an einigen Fällen gewonnene Gewohnheit solange nicht
ungestört auf neu vorkommende Fälle übertragen, bis man
imstande ist, jedem besonderen Einfallswinkel A einen besonderen
Brechungswinkel B zuzuordnen, was durch Auffindung des sogenannten
Brechungsgesetzes beziehungsweise durch Geläufigwerden der in demselben
enthaltenen Regel erreicht ist. Es tritt also dem Prinzip der Stetigkeit
ein anderes Prinzip modifizierend entgegen; wir wollen es das Prinzip der
zureichenden Bestimmtheit oder der zureichenden Differenzierung nennen.
Das Zusammenwirken beider Prinzipien läßt
sich nun durch weitere Ausführung des berührten Beispieles recht
gut erläutern. Um den Tatsachen gerecht zu werden, welche bei Änderung
der Farbe des Lichtes auftreten, hält man den Gedanken des Brechungsgesetzes
fest, muß aber jeder besonderen Farbe einen besonderen Brechungsexponenten
zuordnen; bald merkt man dann, daß man auch jeder besonderen Temperatur
einen besonderen Brechungsexponenten zuordnen muß, usw.
Dieser Prozeß führt schließlich
zur zeitweiligen Beruhigung und Befriedigung, indem die beiden Dinge A
und B so verbunden gedacht werden, daß jeder der augenblicklichen
Erfahrung zugänglichen Änderung des einen eine zugehörige
Änderung des andern entspricht. Es kann der Fall eintreten, daß
sowohl A als B sich als Komplexe von Bestandteilen darstellen,
und daß jeder Bestandteil von A einem Bestandteil von B
zugeordnet ist. Dieses findet z. B. statt, wenn B ein Spektrum und
A die zugehörige Probe eines Gemenges ist, wo je einem Bestandteil
des Spektrums je ein Bestandteil der vor dem Spektralapparat verflüchtigten
Probe unabhängig von den übrigen zugeordnet ist. Erst durch die
vollständige Geläufigkeit dieses Verhältnisses kann dem
Prinzip der zureichenden Bestimmtheit entsprochen werden.
2.
Stellen wir uns nun vor, wir betrachten eine Farbenempfindung B
nicht in ihrer Abhängigkeit von der glühenden Probe A,
sondern in ihrer Abhängigkeit von den Elementen des Netzhautprozesses
N. Hierdurch ist nicht die Art, sondern nur die Richtung der Orientierung
geändert, alles eben Besprochene verliert dadurch nicht seine Geltung,
und die zu befolgenden Grundsätze bleiben dieselben. Und dies gilt
natürlich für alle Empfindungen.
Die Empfindung kann nun an sich, unmittelbar, psychologisch
analysiert werden (wie dies Joh. Müller getan hat), oder es
können die ihr zugeordneten physikalischen (physiologischen) Prozesse
nach den Methoden der Physik untersucht werden (wie dies vorzugsweise die
moderne Physiologenschule tut), oder endlich (was am weitesten führen
wird, weil hierbei die Beobachtung an allen Punkten angreift und eine Untersuchung
die andere stützt, kann der Zusammenhang des psychologisch Beobachtbaren
mit dem zugehörigen physikalischen (physiologischen) Prozeß
verfolgt werden. Dieses letztere Ziel streben wir überall an, wo es
erreichbar scheint.
Mit diesem Ziel im Auge werden wir dem Prinzip der
Kontinuität und jenem der zureichenden Bestimmtheit nur genügen
können, wenn wir dem gleichen B (irgend einer Empfindung) immer
und überall nur das gleiche N (denselben Nervenprozeß)
zuordnen, zu jeder beobachtbaren Änderung von B aber eine entsprechende
Änderung von N auffinden. Können wir B psychologisch
in mehrere von einander unabhängige Bestandteile zerlegen, so können
wir nur in der Auffindung ebensolcher den ersteren entsprechender Bestandteile
in N Beruhigung finden. Sollten aber an B Eigenschaften oder
Seiten zu bemerken sein, die nicht gesondert auftreten können, wie
z. B. Höhe und Intensität des Tones, so würde dasselbe Verhalten
auch von N zu erwarten sein. Mit einem Worte, zu allen psychisch
beobachtbaren Einzelheiten von B haben wir die zugeordneten physikalischen
Einzelheiten von N aufzusuchen.
Wir wollen natürlich nicht behaupten, daß
nicht auch durch recht komplizierte Umstände eine (psychologisch)
einfache Empfindung bedingt werden kann. Denn die Umstände hängen
kettenförmig zusammen und lösen keine Empfindung aus, wenn die
Kette nicht bis in den Nerv reicht. Da aber die Empfindung auch als Halluzination
auftreten kann, wenn gar keine außerhalb des Leibes liegende physikalische
bedingte Umstände vorhanden sind, so sehen wir, daß ein gewisser
Nervenprozeß, als Endglied jener Kette, die wesentliche und unmittelbare
Bedingung der Empfindung ist. Diese unmittelbare Bedingung können
wir nun nicht variiert denken, ohne uns auch die Empfindung variiert vorzustellen,
und umgekehrt. Für den Zusammenhang dieses Endgliedes und der Empfindung
wollen wir das ausgesprochene Prinzip als gültig ansehen.
3.
Wir können also einen leitenden Grundsatz für die Untersuchung der Empfindungen aufstellen, der als Prinzip des vollständigen Parallelismus des Psychischen und Physischen bezeichnet werden mag. Nach unserer Grundanschauung, welche eine Kluft zwischen den beiden Gebieten (des Psychischen und Physischen) gar nicht anerkennt, ist dieses Prinzip fast selbstverständlich, kann aber auch ohne Hilfe dieser Grundanschauung als heuristisches Prinzip aufgestellt werden, wie ich dies vor Jahren getan habe1).
Zur Erläuterung des vielleicht etwas zu abstrakt ausgesprochenen
Grundsatzes mögen sofort einige Beispiele dienen. Überall wo
ich Raum empfinde, ob durch das Gesicht, den Tastsinn oder auf andere Weise,
werde ich einen in allen Fällen gleichartigen Nervenprozeß als
vorhanden anzunehmen haben. Für alle Zeitempfindung supponiere ich
gleiche Nervenprozesse.
Sehe ich gleiche verschiedenfarbige Gestalten, so
suche ich neben den verschiedenen Farbenempfindungen besondere gleiche
Raumempfindungen und zugehörige gleiche Nervenprozesse. Sind zwei
Gestalten ähnlich (liefern sie teilweise gleiche Raumempfindungen),
so enthalten auch die zugehörigen Nervenprozesse teilweise gleiche
Bestandteile. Haben zwei verschiedene Melodien gleichen Rhythmus, so besteht
neben den verschiedenen Tonempfindungen in beiden Fällen eine gleiche
Zeitempfindung mit gleichen zugehörigen Prozessen. Sind zwei Melodien
in verschiedener Tonlage gleich, so haben die Tonempfindungen und ihre
physiologischen Bedingungen trotz der ungleichen Tonhöhe gleiche Bestandteile.
Kann die scheinbar unbegrenzte Mannigfaltigkeit der Farbenempfindungen
durch psychologische Analyse (Selbstbeobachtung) auf 6 Elemente (Grundempfindungen)
reduziert werden, so dürfen wir die gleiche Vereinfachung für
das System der Nervenprozesse erwarten. Zeigt sich das System der Raumempfindungen
als eine dreifache Mannigfaltigkeit, so wird sich auch das System der zugeordneten
Nervenprozesse als eine solche darstellen.
5.
Dieses Prinzip ist übrigens mehr oder weniger bewußt, mehr oder weniger konsequent stets befolgt worden. Wenn z. B. Helmholtz3) für jede Tonempfindung eine besondere Nervenfaser (mit dem zugehörigen Prozeß) statuiert, wenn er den Klang in Tonempfindungen auflöst, die Verwandtschaft der Klänge auf den Gehalt an gleichen Tonempfindungen (und Nervenprozessen) zurückführt, so liegt hierin eine Betätigung des ausgesprochenen Prinzips. Die Anwendung ist nur keine vollständige, wie später gezeigt werden soll. Brewster4) ließ sich durch eine, wenn auch mangelhafte, psychologische Analyse der Farbenempfindungen und unvollkommene physikalische Versuche5) geleitet, zu der Ansicht führen, daß den drei Empfindungen Rot, Gelb, Blau entsprechend auch physikalisch nur drei Lichtsorten existieren, und daß demnach die Newtonsche Annahme einer unbegrenzten Anzahl von Lichtsorten mit kontinuierlich abgestuften Brechungsexponenten falsch sei. Leicht konnte Brewster in den Irrtum verfallen, Grün für eine Mischempfindung zu halten. Hätte er aber überlegt, daß Farbenempfindungen ganz ohne physikalisches Licht auftreten können, so hätte er seine Folgerungen auf den Nervenprozeß beschränkt und Newtons physikalische Aufstellungen, die ebenso wohlbegründet sind, unangetastet gelassen. Th. Young hat diesen Fehler wenigstens prinzipiell verbessert. Er hat erkannt, daß eine unbegrenzte Anzahl physikalischer Lichtsorten von kontinuierlich abgestuften Brechungsexponenten (und Wellenlängen) mit einer geringen Zahl von Farbenempfindungen und Nervenprozessen vereinbar ist, daß dem Kontinuum der Ablenkungen im Prisma (dem Kontinuum der Raumempfindungen) eine diskrete Zahl von Farbenempfindungen entspricht. Aber auch Young hat das ausgesprochene Prinzip nicht mit vollem Bewußtsein und nicht mit strenger Konsequenz angewandt, abgesehen davon, daß er sich bei der psychologischen Analyse noch durch physikalische Vorurteile beirren ließ. Auch Young nahm zuerst Rot, Gelb, Blau als Grundempfindungen an, die er später, durch einen physikalischen Irrtum Wollastons verleitet, wie Alfred Mayer (in Hoboken) in einer trefflichen Arbeit gezeigt hat6), durch Rot, Grün und Violett ersetzt hat. In welcher Richtung die Theorie der Farbenem-pfindung zu modifizieren ist, welche seither durch Hering einen hohen Grad der Vollendung erreicht hat, habe ich vor Jahren an einem andern Ort angedeutet.
3) Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen. Braunschweig, Vieweg, 1863.
5) Brewster meinte nämlich die Nuance von Newton für einfach gehaltener Spektralfarben durch Absorption ändern zu können, was, wenn es richtig wäre, die Newtonsche Anschauung wirklich erschüttern würde. Er experimentierte jedoch, wie Helmholtz (Physiologische Optik) gezeigt hat, mit einem unreinen Spektrum.
6) Philosophical Magazine. February 1876, p. III. Wollaston beobachtete (1802) zuerst die später nach Fraunhofer benannten dunklen Linien des Sonnenspektrums, und glaubte sein schmales Spektrum durch die stärksten Linien in einen roten, grünen oder violetten Teil getrennt zu sehen. Er hielt diese Linien für Grenzen physikalischer Farben. Young nahm diese Ansicht an, und setzte an die Stelle seiner Grundempfindungen Rot, Gelb, Blau die Farben Rot, Grün, Violett. Bei der ersten Aufstellung hielt also Young das Grün für eine Mischempfindung, bei der zweiten aber dieses und Violett für einfach. — Die zweifelhaften Resultate, welche die psychologische Analyse hiernach liefern kann, könnten leicht den Glauben an ihre Brauchbarkeit überhaupt erschüttern. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß man bei Anwendung eines jeden Prinzips in Irrtum verfallen kann. Die Übung wird auch hier entscheidend sein. Der Umstand, daß die physikalischen Bedingungen der Empfindung fast immer Mischempfindungen auslösen, und die Empfindungsbestandteile nicht leicht gesondert auftreten, erschwert die psychologische Analyse sehr bedeutend. So ist z. B. Grün eine einfache Empfindung. Ein vorgelegtes Pigment- oder Spektralgrün wird aber in der Regel eine Gelb- oder Blauempfindung miterregen und dadurch die irrtümliche (auf Mischergebnissen von Pigmenten beruhende) Ansicht begünstigen, daß die Grünempfindung aus Gelb- und Blauempfindung zusammengesetzt sei. Das sorgfältige physikalische Studium ist also auch bei der psychologischen Analyse nicht zu entbehren. Andrerseits darf man auch die physikalische Erfahrung nicht überschätzen. Die bloße Erfahrung, daß ein gelbes und blaues Pigment gemischt ein grünes Pigment liefert, kann uns allein nicht bestimmen, im Grün Gelb und Blau zu sehen, wenn nicht das eine oder das andere wirklich darin enthalten ist. Sieht doch im Weiß niemand Gelb und Blau, obgleich Spektralgelb und Spektralblau gemischt, wirklich Weiß geben.
Ich will hier nur kurz zusammenfassen, was ich heute über die Behandlung der Theorie der Farbenempfindung zu sagen habe. Man findet in neueren Schriften häufig die Angabe, daß die von Hering akzeptierten sechs Grundfarbenempfindungen, Weiß, Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau zuerst von Leonardo da Vinci, nachher von Mach und Aubert aufgestellt worden seien. Daß die Angabe in bezug auf Leonardo da Vinci auf einem Irrtum beruhe, war mir von vornherein, in Anbetracht der Anschauungen seiner Zeit, höchst wahrscheinlich. Hören wir, was er selbst in seinem "Buche von der Malerei" sagt7): "254. Der einfachen Farben sind sechs. Die erste davon ist das Weiß, obwohl die Philosophen weder Weiß noch Schwarz unter die Zahl der Farben aufnehmen, da das eine die Ursache der Farbe ist, das andere deren Entziehung. Da indes der Maler nicht ohne diese beiden fertig werden kann, so werden wir sie zu der Zahl der übrigen hierhersetzen und sagen, das Weiß sei in dieser Ordnung unter den einfachen die erste, Gelb die zweite, Grün die dritte, Blau die vierte, Rot die fünfte, Schwarz die sechste. Und das Weiß werden wir für Licht setzen, ohne das man keine Farbe sehen kann, das Gelb für die Erde, das Grün fürs Wasser, Blau für die Luft, Rot für Feuer und das Schwarz für die Finsternis, die sich über dem Feuerelement befindet, weil dort keine Materie oder dichter Stoff ist, auf den die Sonnenstrahlen ihren Stoß ausüben; und den sie infolgedessen beleuchten könnten." — "255. Das Blau und das Grün sind nicht einfache für sich. Denn das Blau setzt sich aus Licht und Finsternis zusammen, wie das Blau der Luft, aus äußerst vollkommenem Schwarz und vollkommen reinem Weiß ähnlich". "Das Grün setzt sich aus einer einfachen und einer zusammengesetzten zusammen, nämlich aus Gelb und aus Blau". Dies wird genügen, zu zeigen, daß es sich bei Leonardo da Vinci teils um Beobachtungen über Pigmente, teils um naturphilosophische Betrachtungen, nicht aber um die Grundfarbenempfindungen handelt. Die vielen wunderbaren und feinen naturwissenschaftlichen Beobachtungen aller Art, welche in Leonardos Buch enthalten sind, führen zu der Überzeugung, daß die Künstler und insbesondere er, wahre Vorläufer der großen bald folgenden Naturforscher waren. Sie mußten die Natur kennen, um sie angenehm vorzutäuschen; sie beobachteten sich und anderen zum Vergnügen. Doch hat wohl Leonardo bei weitem nicht alle Entdeckungen und Erfindungen gemacht, welche ihm z. B. Groth8) zuschreibt. — Meine nur gelegentlichen Äußerungen über die Theorie der Farbenempfindung waren vollkommen deutlich. Ich nahm die Grundempfindungen: Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Blau und diesen entsprechend in der Netzhaut sechs verschiedene (chemische) Prozesse (nicht Nervenfasern) an. Vergl. Reicherts und Du Bois' Archiv, 1865, S. 633 u. ff.) Das Verhältnis der Komplementärfarben war natürlich, wie jedem Physiker, auch mir bekannt und geläufig. Ich stellte mir aber vor, daß die beiden Komplementärprozesse zusammen einen neuen, den Weißprozeß anregen (a. a. O. S. 634). Die großen Vorzüge der Heringschen Theorie erkenne ich freudig an. Sie bestehen für mich in Folgendem. Zunächst wird der Schwarzprozeß als eine Reaktion gegen den Weißprozeß aufgefaßt. Ich weiß die Erleichterung, welche darin liegt, umso mehr zu würdigen, als mir das Verhältnis von Schwarz und Weiß gerade die größte Schwierigkeit einzuschließen schien. Außerdem werden Rot und Grün, ebenso Gelb und Blau als antagonistische Prozesse aufgefaßt, die nicht einen neuen Prozeß erzeugen, sondern die sich gegenseitig vernichten. Das Weiß wird hiernach nicht erst erzeugt, sondern es ist schon vorher vorhanden, und bleibt bei der Vernichtung einer Farbe durch die Komplementärfarbe übrig. Was mich an der Heringschen Theorie allein noch gestört hat, war, daß man nicht sah, warum die beiden Gegenprozesse Schwarz und Weiß zugleich auftreten und zugleich empfunden werden können, während dies bei Rot-Grün und Blau-Gelb nicht möglich ist. Dieses Bedenken ist aber durch die Darlegung Herings teilweise beseitigt9). Die vollständige Aufklärung dieses Verhältnisses liegt wohl in dem Nachweise, welchen W. Pauli geliefert hat, daß gewisse Prozesse in kolloidalen und in lebenden Substanzen durch entgegengesetzte Prozesse auf demselben Wege, homodrom, wie in a, andere Prozesse aber durch Gegenprozesse auf anderem Wege, heterodrom, wie in b, rückgängig gemacht werden können10). Ich selbst habe vor langer Zeit gezeigt, daß gewisse Empfindungen sich zu einander verhalten wie positive und negative Größen, z. B. Rot und Grün, daß aber andere nicht in diesem Verhältnis stehen, z. B. Weiß und Schwarz11). Alles kommt nun in beste Übereinstimmung, wenn man mit Pauli die dem ersteren Paar entsprechenden Heringschen Gegenprozesse als homodrom, die dem letzteren Paar zugrunde liegenden Vorgänge als heterodrom ansieht12).
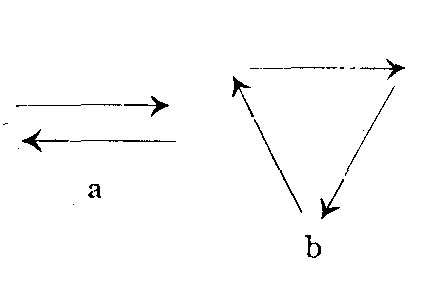
8) Leonardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph. Berlin 1874. — Marie Herzfeld, Leonardo da Vinci, Auswahl nach den veröffentlichten Handschriften. Leipzig 1904.
9) Zur Lehre vom Lichtsinne. Wien 1878, S. 122. Vgl. auch meine oben zitierte Abhandlung. Sitzungsberich-te der Wiener Akademie, Bd. LII, Jahrg. 1865, Oktober.
10) W. Pauli, Der kolloidale Zustand und die Vorgänge in der lebendigen Substanz. Braunschweig, Vieweg, 1902, S. 22, 30.
Die angeführten Beispiele werden genügen, den Sinn des aufgestellten
Forschungsgrundsatzes zu erläutern und zugleich zu zeigen, daß
dieser Grundsatz nicht durchaus neu ist. Als ich mir vor Jahren den Satz
formulierte, hatte ich auch keine andere Absicht, als etwas instinktiv
längst Gefühltes mir selbst zur vollen Klarheit zu bringen.
Es schien mir ein einfacher und natürlicher,
ja beinahe selbstverständlicher Gedanke, daß Ähnlichkeit
auf einer teilweisen Gleichheit, auf einer teil weisen Identität beruht,
und daß man demnach bei ähnlichen Empfindungen nach den gemeinsamen
identischen Empfindungsbestandteilen und den entsprechenden gemeinsamen
physiologischen Prozessen zu suchen hat. Ich kann jedoch den Leser darüber
nicht im Unklaren lassen, daß diese Ansicht sich keineswegs allgemeiner
Zustimmung erfreut. In philosophischen Schriften findet man vielfach die
Behauptung, daß eine Ähnlichkeit auch wahrgenommen werden kann,
ohne daß im geringsten von solchen identischen Bestandteilen die
Rede sein könnte. Ein Physiologe13) spricht sich in folgender
Weise über das hier dargelegte Prinzip aus: "Denn dessen Anwendung
auf die obigen Probleme führt ihn (Mach) direkt dazu, nach
dem physiologischen Moment zu fragen, welches jenen postulierten Qualitäten
entspreche. Mir scheint nun, daß von allen Axiomen und Prinzipien
keines bedenklicher, keines größeren Mißverständnissen
ausgesetzt ist, als dieser Satz. Sollte er nichts anderes sein als eine
Umschreibung des sogen. Parallelprinzips, so würde er weder als neu
noch als besonders fruchtbar gelten können, und das Gewicht, das auf
ihn gelegt wird, nicht verdienen. Wenn er dagegen besagen soll, daß
allem, was wir psychologisch als etwas Einheitliches herausheben können,
jedem Verhältnis, jeder Form, kurz allem, was wir durch eine Allgemeinvorstellung
bezeichnen können, ein bestimmtes Element, ein Bestandteil des physiologischen
Geschehens, entsprechen muß, so kann, glaube ich, diese Formulierung
nur als bedenklich und irreführend bezeichnet werden." Allerdings
will ich den Satz (unter dem Abschn. 2 gemachten Vorbehalt) in diesem letzteren
"bedenklichen und irreführenden" Sinn verstanden wissen. Ich muß
es nun ganz dem Leser überlassen, ob er mir noch weiter folgen und
in den durch jenen Grundsatz deutlich bezeichneten Anfang der Untersuchung
eingehen, oder ob er, der Autorität der Gegner folgend, umkehren und
sich lediglich mit der Betrachtung der vorgehaltenen Schwierigkeiten begnügen
will. In ersterem Falle wird er, wie ich hoffe, die Erfahrung machen, daß
nach Erledigung einfacherer Fälle, in Fällen tiefer liegender,
abstrakter Ähnlichkeit die Schwierigkeiten nicht mehr in der abschreckenden
Beleuchtung erscheinen, in welcher sie zuweilen gesehen wurden. Ich möchte
nur gleich hinzufügen, daß in solchen komplizierten Fällen
von Ähnlichkeit dieselbe nicht auf einem gemeinschaftlichen Element,
sondern auf einem gemeinschaftlichen System von Elementen beruht, wie ich
dies wiederholt in Bezug auf das begriffliche Denken ausgeführt habe
(vgl. Kap. XIV).
Da wir eine eigentliche Kluft zwischen Physischem und Psychischem überhaupt nicht anerkennen, so versteht es sich, daß beim Studium der Sinnesorgane sowohl die allgemein physikalischen als auch die speziell biologischen Erfahrungen Verwendung finden können. Manches, was uns schwer verständlich bleibt, wenn wir das Sinnesorgan mit einem physikalischen Apparat parallelisieren, an welchem die "Seele" beobachtet, wird durchsichtig im Lichte der Entwicklungslehre, wenn wir annehmen, daß wir mit einem lebenden Organismus mit besonderem Gedächtnis, besonderen Gewohnheiten und Manieren, die einer langen und schicksalsreichen Stammesgeschichte ihren Ursprung verdanken, zu tun haben. Die Sinnesorgane sind selbst ein Stück Seele, leisten selbst einen Teil der psychischen Arbeit, und überliefern das Ergebnis fertig dem Bewußtsein. Was ich hierüber zu sagen habe, will ich hier kurz zusammenfassen.
9.
Der Gedanke, die Entwicklungslehre auf die Physiologie der Sinne insbesondere, und auf die Physiologie überhaupt, anzuwenden, tritt schon vor Darwin bei Spencer (1855) auf. Derselbe hat eine mächtige Förderung durch Darwins Buch "Über den Ausdruck der Gemütsbewegungen" erfahren. Später hat P. R. Schuster (1879) die Frage, ob es "ererbte Vorstellungen" gebe, in Darwinschem Sinne erörtert. Auch ich habe mich (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Oktober 1866) für die Anwendung der Entwicklungslehre auf die Theorie der Sinnesorgane ausgesprochen. Eine der schönsten und aufklärendsten Ausführungen im Sinne einer psychologisch-physiologischen Anwendung der Entwicklungslehre enthält die akademische Festrede von Hering14). Gedächtnis und Vererbung fallen in der Tat fast in einen Begriff zusammen, wenn wir bedenken, daß Organismen, welche Teile des Elternleibes waren, auswandern, und die Grundlage der neuen Individuen werden. Die Vererbung wird uns durch diesen Gedanken fast ebenso verständlich als z. B. der Umstand, daß die Amerikaner englisch sprechen, daß ihre Staatseinrichtungen in vieler Beziehung den englischen gleichen, usw. Das Problem, welches darin liegt, daß Organismen ein Gedächtnis haben, welches der unorganischen Materie zu fehlen scheint, wird hierdurch selbstverständlich nicht berührt und besteht fort (vgl. Kap. V, XI). — Will man an Herings Darstellung nicht unbillige Kritik üben, so muß man in Betracht ziehen, daß er den Begriff Gedächtnis in einem weiteren Sinne nimmt. Er hat die Verwandtschaft erschaut, die besteht zwischen den anhaltenden Spuren, welche die Stammesgeschichte den Organismen aufprägt, und den flüchtigeren Eindrücken, die das individuelle Leben (im Bewußtsein) zurückläßt. Das spontane Wiederaufleben eines einmal eingeleiteten Prozesses auf einen leisen Anstoß hin erkennt er als wesentlich denselben Vorgang, ob derselbe nun in dem engen Rahmen des Bewußtseins beobachtet werden kann oder nicht. Das Erschauen dieses gemeinsamen Zuges in einer großen Reihe von Erscheinungen ist nun ein wesentlicher Fortschritt, wenn auch dieser Grundzug selbst noch aufzuklären bleibt15). — In neuerer Zeit hat Weismann16) auch den Tod als eine Vererbungserscheinung aufgefaßt. Auch diese schöne Schrift wirkt sehr anregend. Die Schwierigkeit, die man darin sehen könnte, daß sich eine Eigenschaft vererben soll, die im Elternorganismus erst sich geltend machen kann, nachdem der Prozeß der Vererbung schon abgeschlossen ist, liegt wohl nur im Ausdruck. Sie fällt weg, wenn man darauf achtet, daß die Vermehrungsfähigkeit der Körperzellen auf Kosten der Vermehrung der Keimzellen (wie Weismann andeutet) wachsen kann. Somit kann man sagen, daß die längere Lebensdauer der Zellengemeinschaft und die verminderte Fortpflanzung zwei sich gegenseitig bedingende Anpassungserscheinungen seien. — Noch als Gymnasiast hörte ich einmal, daß Pflanzen der südlichen Hemisphäre bei uns blühen, wenn in ihrer Heimat Frühling ist. Ich erinnere mich lebhaft der geistigen Erschütterung, die mir diese Mitteilung verursacht hat. Ist dies richtig, so kann man hierbei in der Tat an eine Art Gedächtnis der Pflanze denken, auch dann, wenn die Periodizität der Lebenserscheinungen hierbei die Hauptsache sein sollte. — Die sogenannten Reflexbewegungen der Tiere lassen sich in natürlicher Weise als Gedächtniserscheinungen außerhalb des Bewußtseinsorgans auffassen. Eine der merkwürdigsten dieser Erscheinungen sah ich (ich glaube 1865) bei Rollett an enthirnten Tauben. Diese Tiere trinken jedesmal, wenn sie mit den Füßen in eine kalte Flüssigkeit gesetzt werden, ob dieselbe nun Wasser, Quecksilber oder Schwefelsäure ist. Da nun ein Vogel gewöhnlich in die Lage kommen wird, seine Füße zu benetzen, wenn er seinen Durst zu stillen sucht, so ergibt sich die Anschauung ganz ungezwungen, daß hier eine durch die Lebensweise bedingte zweckmäßige, durch Vererbung befestigte Gewohnheit vorliegt, welche (auch bei Ausschaltung des Bewußtseins) auf den entsprechenden auslösenden Reiz mit der Präzision eines Uhrwerks abläuft. Goltz hat in seinem wunderbaren Buch17) und in späteren Schriften viele derartige Erscheinungen beschrieben. — Ich will nun bei dieser Gelegenheit noch einige Beobachtungen erwähnen, deren ich mich mit großem Vergnügen erinnere. In den Herbstferien 1873 brachte mir mein kleiner Junge einen wenige Tage alten Sperling, welcher aus dem Nest gefallen war, und wünschte ihn aufzuziehen. Die Sache war jedoch nicht einfach. Das Tierchen war nicht zum Schlingen zu bewegen, und wäre den unvermeidlichen Insulten beim gewaltsamen Füttern sicherlich bald erlegen. Da stellte ich folgende Überlegung an: "Das neugeborene Kind wäre (ob die Darwinsche Theorie richtig ist oder nicht) unfehlbar verloren, wenn es nicht die vorgebildeten Organe und den ererbten Trieb zum Saugen hätte, welche durch den passenden Reiz ganz automatisch und mechanisch in Tätigkeit geraten. Etwas Ähnliches muß in anderer Form auch beim Vogel existieren." Ich bemühte mich nun den passenden Reiz zu finden. Ein kleines Insekt wurde an ein spitzes Stäbchen gesteckt und an diesem um den Kopf des Vogels rasch herumbewegt. Sofort sperrte das Tier den Schnabel auf, schlug mit den Flügeln und schlang gierig die dargebotene Nahrung hinab. Ich hatte also den richtigen Reiz für die Auslösung des Triebes und der automatischen Bewegung gefunden. Das Tier wurde zusehends stärker und gieriger; es fing an, nach der Nahrung zu schnappen, erfaßte einmal auch ein zufällig vom Stäbchen auf den Tisch gefallenes Insekt, und fraß von da an ohne Anstand selbständig. In dem Maße als sich der Intellekt, die Erinnerung entwickelte, war ein immer kleinerer Teil des auslösenden Reizes notwendig. Das selbständig gewordene Tier nahm nach und nach alle charakteristischen Sperlingsmanieren an, die es doch nicht eigens gelernt hatte. Bei Tage (bei wachem Intellekt) war es sehr zutraulich und liebenswürdig. Des Abends traten regelmäßig andere Erscheinungen auf. Das Tier wurde furchtsam. Es suchte immer die höchsten Orte der Stube auf, und beruhigte sich erst, wenn es durch die Zimmerdecke verhindert wurde, noch höher zu steigen. Wieder eine andere zweckmäßige ererbte Gewohnheit! Bei einbrechender Dunkelheit war das Tier vollends verändert. Näherte man sich dann, so sträubte es die Federn, fing an zu fauchen und zeigte den Ausdruck des Entsetzens und der leibhaftigen Gespensterfurcht. Auch diese ist ganz wohlbegründet und zweckmäßig bei einem Wesen, das unter normalen Verhältnissen jeden Augenblick von irgend einem Ungetüm verschlungen werden kann. — Diese letztere Beobachtung bekräftigte mir die schon vorher gefaßte Ansicht, daß die Gespensterfurcht meiner Kinder nicht von den (sorgfältig ferngehaltenen) Ammenmärchen herrührte, sondern angeboren war. Eines meiner Kinder fing gelegentlich an, den im Dunkeln stehenden Lehnstuhl zu beanstanden, ein anderes wich abends sorgfältig einem Kohlenbehälter beim Ofen aus, besonders wenn derselbe mit geöffnetem Deckel dastand, und einem aufgesperrten Rachen glich. Die Gespensterfurcht ist die wirkliche Mutter der Religionen. Weder die naturwissenschaftliche Analyse noch die sorgfältige historische Kritik eines D. Strauss Mythen gegenüber, welche für den kräftigen Intellekt schon widerlegt sind, bevor sie noch erfunden wurden, werden diese Dinge plötzlich beseitigen und hinwegdekretieren. Was so lange einem wirklichen ökonomischen Bedürfnis entsprach und teilweise noch entspricht (Furcht eines Schlimmem, Hoffnung eines Bessern), wird in den dunkleren unkontrollierbaren instinktiven Gedankenreihen noch lange fortleben. Wie die Vögel auf unbewohnten Inseln (nach Darwin) die Menschenfurcht erst im Laufe mehrerer Generationen erlernen müssen, so werden wir erst nach vielen Generationen das unnötig gewordene "Gruseln" verlernen. Jede Faustaufführung kann uns darüber belehren, wie sympathisch uns insgeheim die Anschauungen der Hexenzeit noch sind. Nützlicher als die Furcht vor dem Unbekannten wird dem Menschen die genaue Kenntnis der Natur, seiner Lebensbedingungen. Und bald ist es für ihn am wichtigsten, daß er auf der Hut sei vor Nebenmenschen, die ihn roh vergewaltigen, oder durch Irreleitung seines Verstandes und Gefühls perfid mißbrauchen wollen. — Noch eine eigentümliche Beobachtung will ich hier mitteilen, deren Kenntnis ich meinem Vater (zuletzt Gutsbesitzer in Krain), einem begeisterten Darwinianer, verdanke. Mein Vater beschäftigte sich viel mit Seidenzucht, zog Yama Mai frei im Eichenwalde usw. Die gewöhnliche Morus-Seidenraupe ist seit vielen Jahrhunderten ein Haustier und dadurch höchst unbehilflich und unselbständig geworden. Kommt die Zeit des Einspinnens heran, so pflegt man den Tieren Strohbündel darzubieten, auf welchen sie sich verpuppen. Mein Vater kam nun eines Tages auf den Einfall, einer Gesellschaft von Morusraupen die üblichen Strohbündel nicht bereit zu legen. Die Folge war, daß der größte Teil der Raupen zu Grunde ging, und nur ein geringer Bruchteil, die Genies (mit größerer Anpassungsfähigkeit), sich einspann. Ob, wie meine Schwester beobachtet zu haben glaubt, die Erfahrungen einer Generation schon in der nächsten merklich benutzt werden, muß wohl noch weiter untersucht werden. Aus den Versuchen, die C. Lloyd Morgan (Comparative psychology, London 1894) mit jungen Hühnchen, Enten usw. angestellt hat, geht hervor, daß wenigstens bei höheren Tieren kaum etwas anderes angeboren ist als die Reflexe. Das frisch ausgeschlüpfte Hühnchen pickt gleich mit großer Sicherheit nach allem, was es sieht. Was aber aufzupicken ersprießlich ist, muß es durch individuelle Erfahrung lernen. Je einfacher der Organismus, desto geringer die Rolle des individuellen Gedächtnisses. — Aus allen diesen merkwürdigen Erscheinungen brauchen wir keine Mystik des Unbewußten zu schöpfen. Ein über das Individuum hinausreichendes Gedächtnis (in der oben bezeichneten erweiterten Bedeutung) macht sie verständlich. Eine Psychologie in Spencer-Darwinschem Sinne auf Entwicklungslehre gegründet, aber auf positiver Detailforschung fußend, verspricht reichere Resultate als alle bisherigen Spekulationen. — Meine Beobachtungen und Betrachtungen waren längst angestellt und niedergeschrieben, als Schneiders wertvolle Schrift ("Der tierische Wille", Leipzig 1880) erschien, die viele ähnliche enthält. Den Detailausführungen Schneiders, soweit dieselben nicht durch Lloyd Morgans Versuche problematisch werden, muß ist fast durchaus zustimmen, wenngleich seine naturwissenschaftlichen Grundanschauungen (das Verhältnis von Empfindung und physikalischem Prozeß, die Bedeutung der Arterhaltung usw. betreffend) von den meinigen wesentlich verschieden sind, und obgleich ich z. B. auch die Unterscheidung von Empfindungs- und Wahrnehmungstrieben für ganz überflüssig halte. — Eine wichtige Umgestaltung unserer Anschauungen über die Vererbung dürfte durch Weismanns Schrift (Über die Vererbung. Jena 1883) eingeleitet sein. Weismann hält die Vererbung durch Übung erworbener Eigenschaften für höchst unwahrscheinlich und sieht das wichtige Moment in der zufälligen Variation der Keimesanlagen und der Auslese der Keimesanlagen. Wie man sich auch zu Weismanns Ausführungen stellen mag, jedenfalls kann die durch ihn angeregte Diskussion zur Klärung der Fragen nur beitragen. Der fast mathematischen Schärfe und Tiefe seiner Problemstellung wird man gewiß nicht die Anerkennung versagen, und seinen Argumenten nicht die Kraft absprechen können. Die Bemerkung z. B. gibt sehr zu denken, daß die eigentümlichen ungewöhnlichen, scheinbar auf Gebrauch und Anpassung zurückzuführenden Formen der geschlechtslosen Ameisen, welche zudem von der Form ihrer fortpflanzungsfähigen Genossen so sehr abweichen, nicht auf einer Vererbung durch Übung erworbener Eigenschaften beruhen können18). Daß die Keimesanlagen selbst sich durch äußere Einflüsse ändern können, scheint aber doch durch die Bildung neuer Rassen, welche sich als solche erhalten, ihre Rasseneigenschaften vererben, und die selbst wieder unter anderen Umständen einer Umbildung fähig sind, deutlich hervorzugehen. Auf das Keimplasma muß also doch auch der dasselbe umschließende Leib Einfluß nehmen (wie Weismann selbst zugibt). Somit ist ein Einfluß des individuellen Lebens auf die Nachkommen doch nicht auszuschließen, wenn auch eine direkte Übertragung der Resultate der Übung des Individuums auf die Deszendenten (nach Weismanns Darlegung) nicht mehr erwartet werden kann. — Wenn man sich vorstellt, daß die Keimesanlagen zufällig variieren, so ist zu bedenken, daß der Zufall kein Aktionsprinzip ist. Wenn ganz gesetzmäßig wirksame periodische Umstände verschiedener Art und Periodizität zusammentreffen, so überdecken sich dieselben derart, daß man im einzelnen kein Gesetz mehr wahrnimmt. Dennoch äußert sich das Gesetz im Verlauf eines längeren Zeitraumes und erlaubt uns auf gewisse Mittelwerte, Wahrscheinlichkeiten der Effekte zu rechnen19). Ohne ein solches Aktionsprinzip hat die Wahrscheinlichkeit, der Zufall, gar keinen Sinn. Welches Aktionsprinzip sollte aber auf die Variation der Keimesanlagen mehr Einfluß üben als der Elternleib? — Ich für meine Person kann mir nicht vorstellen, daß die Art dem Einflüsse variierender Umstände unterliegen sollte, welche gleichwohl nicht am Individuum angreifen würden. Meine eigene Variation wird mir aber zudem gewiß, durch jeden Gedanken, jede Erinnerung, jede Erfahrung, welche ja mein ganzes physisches Verhalten ändern20).
14) Über das Gedächtnis als eine allgem. Funktion der organisierten
Materie, 1870.
15) R. Semon, Die Mneme. Leipzig 1904.
16) Über die Dauer des Lebens, 1882.´
17) Die Nervenzentren des Frosches, 1869.
Obwohl es kaum nötig ist, möchte ich noch ausdrücklich hinzufügen, daß ich die Entwicklungslehre in jeder Form als eine modifizierbare, zu verschärfende naturwissenschaftliche Arbeitshypothese betrachte, deren Wert so weit reicht, als dieselbe das provisorische Verständnis des in der Erfahrung Gegebenen erleichtert. Für mich, der den gewaltigen Aufschwung aller Forschung, nicht nur der biologischen, durch Darwin miterlebt hat, ist dieser Wert allerdings ein sehr großer. Ich rechte nicht mit jenen, für welche derselbe sehr gering ist. Auf die Notwendigkeit, mit schärferen, durch das Studium der biologischen Tatsachen an sich gewonnenen Begriffen vorzugehen, habe ich schon 1883 und 1886 hingewiesen21). Ich stehe also Forschungen, wie jenen Drieschs, keineswegs verständnislos gegenüber. Ob aber Drieschs Kritik22) meines Verhaltens gegenüber der Entwicklungslehre gerechtfertigt ist, überlasse ich jenen zu beurteilen, welche sich die Mühe nehmen, trotz dieser Kritik, doch noch meine Ausführungen zu lesen.
10.
Teleologische Betrachtungen haben wir als Hilfsmittel der Forschung keineswegs zu scheuen. Gewiß wird uns das Tatsächliche nicht verständlicher durch Zurückführung desselben auf einen selbst problematischen unbekannten "Weltzweck", oder den ebenso problematischen Zweck eines Lebewesens. Allein die Frage, welchen Wert diese oder jene Funktion für das tatsächliche Bestehen des Organismus hat, oder was sie zu der Erhaltung desselben beiträgt, kann das Verständnis dieser Funktion selbst fördern23). Deshalb dürfen wir natürlich noch nicht glauben, dass wir, wie manche Darwinianer sich ausdrücken, eine Funktion "mechanisch erklärt" haben, wenn wir erkennen, daß sie für das Bestehen der Art notwendig ist. Darwin selbst ist von dieser kurzsichtigen Auffassung wohl vollkommen frei. Durch welche physikalische Mittel die Funktion sich entwickelt, bleibt noch immer ein physikali-sches, und wie und warum sich der Organismus anpassen will, ein psychologisches Problem. Die Erhaltung der Art ist überhaupt nur ein tatsächlicher wertvoller Anhaltspunkt für die Forschung, keineswegs aber das Letzte und Höchste. Arten sind ja wirklich zugrunde gegangen, und neue wohl ebenso zweifellos entstanden. Der lustsuchende und schmerzmei-dende Wille24) muß also wohl weiter reichen als an die Erhaltung der Art. Er erhält die Art, wenn es sich lohnt, er vernichtet sie, wenn ihr Bestand sich nicht mehr lohnt. Wäre er nur auf die Erhaltung der Art gerichtet, so bewegte er sich, alle Individuen und sich selbst betrügend, ziellos in einem fehlerhaften Zirkel. Dies wäre das biologische Seitenstück des berüchtigten physikalischen "perpetuum mobile". Derselben Verkehrtheit machen sich jene Staatsmänner schuldig, welche den Staat als Selbstzweck ansehen.
24) Man kann den Schopenhauerschen Gedanken der Beziehung von Willen und Kraft ganz wohl annehmen, ohne in beiden etwas Metaphysisches zu sehen.