
Fig. 2.
5.
1.
Der Baum mit seinem grauen harten rauhen Stamm, den vielen im Winde
bewegten Zweigen, mit den glatten, glänzenden weichen Blättern
erscheint uns zunächst als ein untrennbares Ganze. Ebenso halten wir
die süße runde gelbe Frucht, das helle warme Feuer mit seinen
mannigfaltig bewegten Zungen für ein Ding. Ein Name bezeichnet das
Ganze, ein Wort zieht wie an einem Faden alle zusammengehörigen Erinnerungen
auf einmal aus der Tiefe der Vergessenheit hervor.
Das Spiegelbild des Baumes, der Frucht, des Feuers
ist sichtbar, aber nicht greifbar. Bei abgewendetem Blick oder geschlossenen
Augen können wir den Baum tasten, die Frucht schmecken, das Feuer
fühlen, aber nicht sehen. So trennt sich das scheinbar einheitliche
Ding in Teile, welche nicht nur aneinander, sondern auch an andern Bedingungen
haften. Das Sichtbare trennt sich von dem Tastbaren, Schmeckbaren usw.
Auch das bloß Sichtbare erscheint uns zunächst
als ein Ding. Wir können aber eine gelbe runde Frucht neben einer
gelben sternförmigen Blüte sehen. Eine zweite Frucht kann ebenso
rund sein als die erste, sie ist aber grün oder rot. Zwei Dinge können
von gleicher Farbe aber ungleicher Gestalt sein; sie können von verschiedener
Farbe und gleicher Gestalt sein. Hierdurch teilen sich die Gesichtsempfindungen
in Farbenempfindungen und Raumempfindungen, die wohl von einander unterschieden,
wenn auch nicht voneinander isoliert dargestellt werden können.
2.
Die Farbenempfindung, auf welche wir hier nicht näher eingehen, ist im wesentlichen eine Empfindung der günstigen oder ungünstigen chemischen Lebensbedingungen. In der Anpassung an diese möchte sich die Farbenempfindung entwickeln und modifizieren1). Das Licht leitet das organische Leben ein. Das grüne Chlorophyll und das (komplementär) rote Hämoglobin spielen in dem chemischen Prozeß des Pflanzenleibes und dem chemischen Gegenprozeß des Tierleibes eine hervorragende Rolle. Beide Stoffe treten uns modifiziert in dem mannigfaltigsten Farbenkleide entgegen. Die Entdeckung des Sehpurpurs, die Erfahrungen der Photographie und Photochemie lassen auch die Sehvorgänge als chemische Vorgänge auffassen. Die Rolle, welche die Farbe in der analytischen Chemie, bei der Spektralanalyse, in der Kristallphysik spielt, ist bekannt. Sie legt den Gedanken nahe, die sogenannten Lichtschwingungen nicht als mechanische, sondern als chemische Schwingungen aufzufassen, als eine wechselnde Verbindung und Trennung, als einen oszillatorischen Prozeß von der Art, wie er bei photochemischen Vorgängen nur in einer Richtung eingeleitet wird. — Diese Anschauung, welche durch die neueren Untersuchungen über anomale Dispersion wesentlich unterstützt wird, kommt der elektromagnetischen Lichttheorie entgegen. Auch von dem elektrischen Strom gibt ja die Chemie die faßbarste Vorstellung im Falle der Elektrolyse, wenn sie beide Bestandteile der Elektrolyten als im entgegengesetzten Sinne durcheinander hindurchwandernd ansieht. So dürften also in einer künftigen Farbenlehre viele biologisch - psychologische und chemisch - physikalische Fäden zusammenlaufen.
Die Anpassung an die chemischen Lebensbedingungen, welche sich durch die Farbe kundgeben, erfordert Lokomotion in viel ausgiebigerem Maße, als die Anpassung an jene, die durch Geschmack und Geruch sich äußern. Wenigstens beim Menschen, über den allein wir ein direktes und sicheres Urteil haben, und um den es sich hier handelt, ist es so. Die enge Verknüpfung (eines mechanischen Momentes) der Raumempfindung mit (einem chemischen Moment) der Farbenempfindung wird hierdurch verständlich. Auf die Analyse der optischen Raumempfindungen wollen wir zunächst eingehen.
4.
Wenn wir zwei gleiche verschiedenfarbige Gestalten, z. B. zwei gleiche verschiedenfarbige Buchstaben, betrachten, so er kennen wir die gleiche Form trotz der Verschiedenheit der Farbenempfindung auf den ersten Blick. Die Gesichtswahrnehmungen müssen also gleiche Empfindungsbestandteile enthalten. Diese sind eben die (in beiden Fällen gleichen) Raumempfindungen.

Fig. 2.
5.
Wir wollen nun untersuchen, welcher Art die Raumempfindungen sind, welche physiologisch das Wiedererkennen einer Gestalt bedingen. Zunächst ist klar, daß dieses Wiedererkennen nicht durch geometrische Überlegungen herbeigeführt wird, welche nicht Empfindungs-, sondern Verstandessache sind. Vielmehr dienen die betreffenden Raumempfindungen aller Geometrie zum Ausgangspunkt und zur Grundlage. Zwei Gestalten können geometrisch kongruent, physiologisch aber ganz verschieden sein, wie dies die beiden obenstehenden Quadrate veranschaulichen, welche ohne mechanische und intellektuelle Operationen niemals als gleich erkannt werden können2). Um uns die hierher gehörigen Verhältnisse geläufig zu machen, stellen wir einige recht einfache Versuche an. Wir betrachten einen ganz beliebigen Fleck (Fig. 4). Stellen wir denselben Fleck zweimal oder mehrmal in gleicher Orientierung in eine Reihe, so bedingt dies einen eigentümlichen angenehmen Eindruck, und wir erkennen ohne Schwierigkeit auf den ersten Blick die Gleichheit aller Gestalten (Fig. 5). Die Formgleichheit wird aber ohne intellektuelle Mittel nicht mehr erkannt, wenn wir den einen Fleck gegen den andern genügend verdrehen (Fig. 6). Eine auffallende Verwandtschaft beider Formen wird dafür bemerklich, wenn man dem Fleck einen zweiten in bezug auf die Medianebene des Beobachters symmetrischen hinzufügt (Fig. 7). Nur durch Drehung der Figur oder durch intellektuelle Operationen erkennt man aber die Formverwandtschaft, wenn die Symmetrieebene bedeutend, z. B. wie in Fig. 8 von der Medianebene des Beobachters abweicht. Dagegen wird die Form Verwandtschaft wieder merklich, wenn man dem Fleck denselben Fleck, um 180° in der eigenen Ebene gedreht, hinzufügt (Fig. 9). Es entsteht auf diese Weise die sogenannte zentrische Symmetrie.
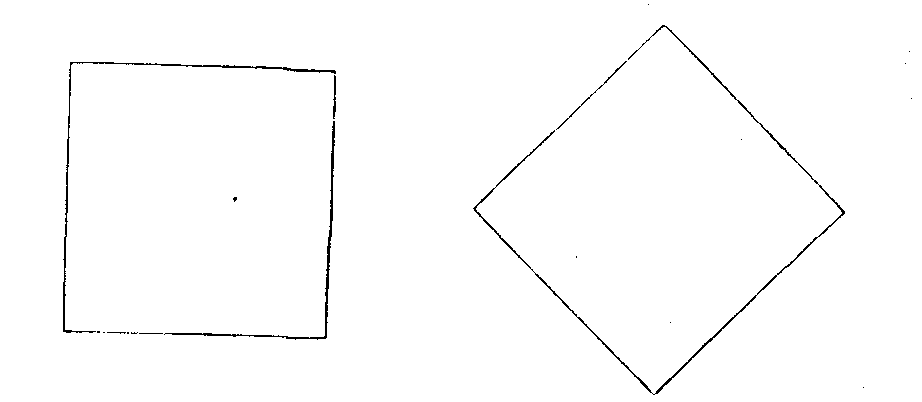
Fig. 3.
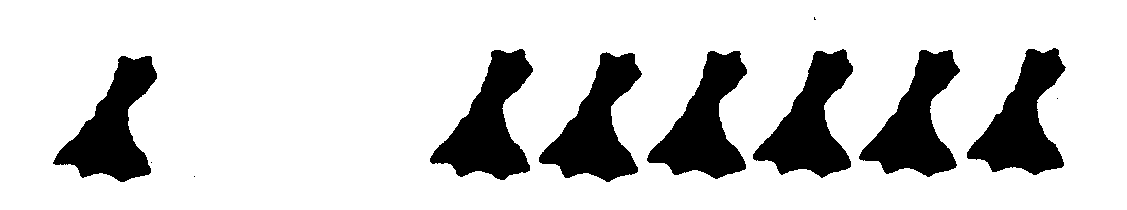
![]()
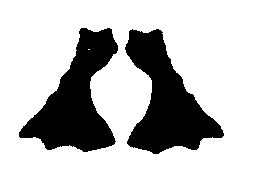
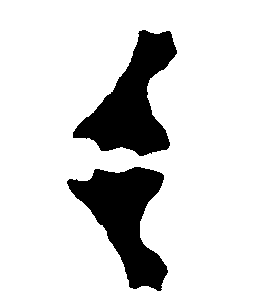

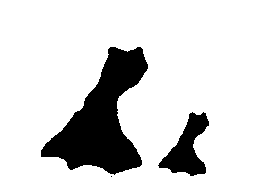
Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10
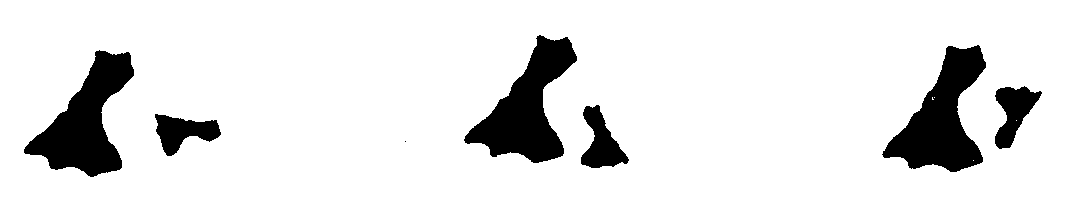
6.
Worin besteht nun das Wesen der optischen Ähnlichkeit gegenüber der geometrischen Ähnlichkeit? In geometrisch ähnlichen Gebilden sind alle homologen Entfernungen proportioniert. Das ist aber Verstandessache und nicht Sache der Empfindung. Wenn wir einem Dreiecke mit den Seiten a, b, c ein anderes mit den Seiten 2a, 2b, 2c gegenüberstellen, so erkennen wir diese einfache Beziehung nicht unmittelbar, sondern intellektuell durch Abmessung. Soll die Ähnlichkeit auch optisch hervortreten, so muß noch die richtige Orientierung hinzukommen. Daß eine einfache Beziehung zweier Objekte für den Verstand nicht auch eine Ähnlichkeit der Empfindung bedingt, sehen wir, wenn wir die Dreiecke mit den Seiten a, b, c und a + m, b + m, c + m vergleichen. Beide Dreiecke sehen einander keineswegs ähnlich. Ebenso sehen nicht alle Kegelschnitte einander ähnlich, obgleich alle in einer einfachen geometrischen Verwandtschaft stehen; noch weniger zeigen die Kurven dritter Ordnung untereinander eine optische Ähnlichkeit, usw.
7.
Die geometrische Ähnlichkeit zweier Gebilde ist bestimmt dadurch, daß alle homologen Entfernungen proportioniert, oder dadurch, daß alle homologen Winkel gleich sind. Optisch ähnlich werden die Gebilde erst, wenn sie auch ähnlich liegen, wenn also alle homologen Richtungen parallel, oder wie wir vorziehen wollen zu sagen, gleich sind (Fig. 14). Die Wichtigkeit der Richtung für die Empfindung geht schon aus der aufmerksamen Betrachtung der Figur 3 hervor. Die Gleichheit der Richtungen ist es also, wodurch die gleichen Raumempfindungen bedingt sind, welche die physiologisch - optische Ähnlichkeit der Gestalten charakterisieren3).
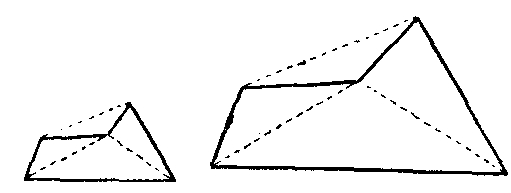
8.
Daß die Raumempfindungen mit dem motorischen Apparat der Augen irgendwie zusammenhängen, hat von vornherein eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ohne noch auf die Einzelheiten näher einzugehen, bemerken wir zunächst, daß der ganze Augenapparat, und insbesondere der motorische Apparat in bezug auf die Medianebene des Kopfes symmetrisch ist. Dementsprechend werden auch mit symmetrischen Blickbewegungen gleiche oder doch fast gleiche Raumempfindungen verbunden sein. Kinder verwechseln fortwährend die Buchstaben b und d. p und q. Auch Erwachsene merken eine Umkehrung von rechts nach links nicht leicht, wenn nicht besondere sinnliche oder intellektuelle Anhaltspunkte dieselbe bemerklich machen. Der motorische Apparat der Augen ist von sehr vollkommener Symmetrie. Für sich allein würde die gleiche Erregung seiner symmetrischen Organe die Unterscheidung von rechts und links kaum ermöglichen. Allein der ganze Menschenleib, und insbesondere das Hirn, ist mit einer geringen Asymmetrie behaftet, welche z. B. dazu führt, die eine (gewöhnlich die rechte) Hand bei motorischen Funktionen zu bevorzugen. Dies führt wieder zu einer weiteren und besseren Entwicklung der rechtsseitigen motorischen Funktionen und zu einer Modifikation der zugehörigen Empfindungen. Haben sich einmal beim Schreiben die Raumempfindungen des Auges mit den motorischen Empfindungen der rechten Hand verknüpft, so tritt eine Verwechslung jener vertikalsymmetrischen Gestalten, auf welche sich die Schreibefertigkeit und Schreibegewohnheit erstreckt, nicht mehr ein. Diese Verknüpfung kann sogar so stark werden, daß die Erinnerungen nur in den gewohnten Bahnen ablaufen, und daß man z. B. Spiegelschrift nur mit der größten Schwierigkeit liest. Die Verwechslung von rechts und links kommt aber immer noch vor in bezug auf Gestalten, die ein rein optisches (z. B. ornamentales), kein motorisches Interesse haben. Eine merkliche Differenz zwischen rechts und links müssen übrigens auch die Tiere empfinden, da sie in vielen wichtigen Fällen sich nur hierdurch orientieren können. Wie ähnlich übrigens die Empfindungen sind, welche an symmetrische motorische Funktionen geknüpft sind, darüber kann sich der aufmerksame Beobachter leicht belehren. Wenn ich z. B., weil meine rechte Hand zufällig beschäftigt ist, mit der linken Hand eine Mikrometerschraube oder einen Schlüssel anfasse, so drehe ich (ohne vorausgegangene Überlegung) sicherlich verkehrt, d. h. ich führe die symmetrische Bewegung zu der gewohnten aus, indem ich beide wegen der Ähnlichkeit der Empfindung verwechsle. Die Beobachtungen von Heidenhain über die Spiegelschrift halbseitig Hypnotisierter gehören auch hierher.
9.
Der Gedanke, daß die Unterscheidung von rechts und links auf einer Asymmetrie, und in letzter Linie möglicher Weise auf einer chemischen Verschiedenheit beruhe, verfolgt mich seit meiner Jugend; ich habe denselben schon bei Gelegenheit meiner ersten Vorlesungen ausgesprochen (1861). Seither hat sich derselbe wiederholt hervorgedrängt. Von einem alten Offizier erfuhr ich gelegentlich, daß Truppen in dunkler Nacht, im Schneegestöber, wenn äußere Anhaltspunkte fehlen, in der Meinung, geradlinig in einer Richtung zu marschieren, sich annähernd in einem Kreise von großem Radius bewegen, so daß sie fast auf den Ausgangsort zurückkommen. In Tolstois Erzählung "Herr und Diener" wird von einer analogen Erscheinung berichtet. Diese Phänomene sind wohl nur durch eine geringe motorische Asymmetrie verständlich. Sie sind analog dem Rollen eines vom Zylinder wenigabweichenden Kegels in einem Kreis von großem Radius. In der Tat hat F. O. Guldberg4), der über die hierher gehörigen Erscheinungen an verirrten Menschen und Tieren eingehende Untersuchungen angestellt hat, die Sache so aufgefaßt. Desorientierte Menschen und Tiere bewegen sich ausnahmslos nahezu in Kreisen, deren Radien nach der Spezies variieren, während der Mittelpunkt, je nach dem Individuum und der Spezies, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des die Kreisbahn durchlaufenden Individuums liegt. Guldberg sieht hierin auch eine teleologische Einrichtung zum Wiederfinden der pflegebedürftigen Jungen. Versuche an niederen Tieren, bei welchen letzteres Moment wegfällt, wären daher von Interesse. Unvollkommene Symmetrie wird man übrigens schon aus allgemeinen Wahrscheinlichkeitsgründen auch bei niederen Tieren erwarten.
5) Loeb, Über den Fühlraum der Hand. Pflügers Archiv, Bd. 41 u. 46.
10.
Mit dem Blick nach oben und dem Blick nach unten sind grundverschiedene
Raumempfindungen verbunden, wie dies die gewöhnlichste Erfahrung lehrt.
Das ist auch verständlich, weil der motorische Augenapparat in bezug
auf eine horizontale Ebene unsymmetrisch ist. Die Richtung der Schwere
ist auch für den übrigen motorischen Apparat viel zu maßgebend
und wichtig, so daß dieser Umstand auch in dem Apparat des Auges,
welcher dem übrigen dient, wohl seinen Ausdruck finden muß.
Daß die Symmetrie einer Landschaft und ihres Spiegelbildes im Wasser
gar nicht empfunden wird, ist bekannt. Das von oben nach unten umgekehrte
Portrait einer bekannten Persönlichkeit ist fremd und rätselhaft
für jeden, der nicht durch intellektuelle Anhaltspunkte sie erkennt.
Wenn man sich hinter den Kopf einer auf einem Ruhebette liegenden Person
stellt, und ohne Spekulation sich dem Eindrucke des Gesichtes ganz hingibt
(namentlich wenn die Person spricht), so ist derselbe ein durchaus fremdartiger.
Die Buchstaben b und p, ferner d und q werden
auch von Kindern nicht verwechselt.
Unsere bisherigen Bemerkungen über Symmetrie,
Ähnlichkeit usw. gelten natürlich nicht nur für ebene, sondern
auch für räumliche Gebilde. Dementsprechend haben wir noch über
die Raumempfindung der Tiefe eine Bemerkung hinzuzufügen. Der Blick
in die Ferne und der Blick in die Nähe bedingt verschiedene Empfindungen.
Sie dürfen auch nicht verwechselt werden, weil der Unterschied von
nah und fern für Mensch und Tier zu wichtig ist. Sie können nicht
verwechselt werden, weil der motorische Apparat der Augen unsymmetrisch
ist in bezug auf eine Ebene, welche auf der Richtung vorn-hinten senkrecht
steht. Die Erfahrung, daß die Büste einer bekannten Persönlichkeit
nicht durch die Matrize dieser Büste ersetzt werden kann, ist ganz
analog den Beobachtungen bei Umkehrungen von oben nach unten.
11.
Wenn gleiche Abmessungen und gleiche Richtungen gleiche Raumempfindungen,
zur Medianebene des Kopfes symmetrische Richtungen ähnliche Raumempfindungen
auslösen, so werden hierdurch die oben berührten Tatsachen sehr
verständlich. Die Gerade hat in allen Elementen dieselbe Richtung
und löst überall einerlei Raumempfindungen aus. Darin liegt ihr
ästhetischer Vorzug. Außerdem treten noch Gerade, welche in
der Medianebene liegen oder zu derselben senkrecht stehen, in eigentümlicher
Weise hervor, indem sie sich bei dieser Symmetrielage zu beiden Hälften
des Sehapparates gleich verhalten. Jede andere Stellung der Geraden wird
als eine "Schiefstellung" empfunden, als eine Abweichung von der Symmetriestellung.
Die Wiederholung desselben Raumgebildes in gleicher
Orientierung bedingt Wiederholung derselben Raumempfindungen. Alle Verbindungslinien
homologer ausgezeichneter (auffallender) Punkte haben die gleiche Richtung
und lösen dieselbe Empfindung aus. Auch bei Nebeneinanderstellung
bloß geometrisch ähnlicher Gebilde in gleicher Orientierung
bleibt dies Verhältnis bestehen. Nur die Gleichheit der Abmessungen
geht verloren. Bei Störung der Orientierung ist aber auch dies Verhältnis
und hiermit der einheitliche (ästhetische) Eindruck gestört.
Bei einem in bezug auf die Medianebene symmetrischen
Gebilde treten an die Stelle der gleichen Raumempfindungen die ähnlichen,
welche den symmetrischen Richtungen entsprechen. Die rechte Hälfte
des Gebildes steht zur rechten Hälfte des Sehapparates in demselben
Verhältnis, wie die linke Hälfte des Gebildes zur linken Hälfte
des Sehapparates. Läßt man die Gleichheit der Abmessungen fallen,
so wird noch die symmetrische Ähnlichkeit empfunden. Schiefstellung
der Symmetrieebene stört das ganze Verhältnis.
Stellt man neben ein Gebilde dasselbe Gebilde, aber
um 180° gedreht, so entsteht die zentrische Symmetrie. Verbindet man
nämlich zwei Paare homologer Punkte, so schneiden sich die Verbindungslinien
in einem Punkte O, durch welchen als Halbierungspunkt alle Verbindungslinien
homologer Punkte hindurchgehen. Auch im Falle der zentrischen Symmetrie
sind alle homologen Verbindungslinien gleich gerichtet, was angenehm empfunden
wird. Geht die Gleichheit der Abmessungen verloren, so bleibt noch die
zentrisch symmetrische Ähnlichkeit für die Empfindung übrig.
Die Regelmäßigkeit scheint der Symmetrie
gegenüber keinen eigentümlichen physiologischen Wert zu haben.
Der Wert der Regelmäßigkeit dürfte vielmehr nur in der
vielfachen Symmetrie liegen, welche nicht bloß bei einer Stellung
merklich wird.
12.
Die Richtigkeit der gegebenen Ausführungen wird sehr fühlbar,
wenn man das Werk von Owen Jones (Grammar of Ornament, London 1865)
durchblättert. Fast auf jeder Tafel wird man die verschiedenen Arten
der Symmetrie als Belege für die gewonnenen Anschauungen wiederfinden.
Die Ornamentik, welche, wie die reine Instrumentalmusik, keinen Nebenzweck
verfolgt, sondern nur dem Vergnügen an der Form (und Farbe) dient,
liefert am besten die Tatsachen für die vorliegenden Studien. Die
Schrift wird durch andere Rücksichten als jene der Schönheit
beherrscht. Gleichwohl findet man z. B. unter den 24 großen lateinischen
Buchstaben 10 vertikal symmetrische (A, H, I, M, O, T, V, W, X,
Y), fünf horizontal symmetrische (B, C, D, E, K), drei zentrisch symmetrische
(N, S, Z), und nur sechs unsymmetrische (F, G, L, P, Q, R),
Das Studium der Entwicklung der primitiven Kunst
ist für die uns beschäftigenden Fragen sehr lehrreich. Der Charakter
dieser Kunst ist bestimmt: durch die Naturobjekte, welche sich der Nachahmung
darbieten, durch den Grad der mechanischen Geschicklichkeit, und endlich
durch das Streben, die Wiederholung in ihren verschiedenen Formen zur Anwendung
zu bringen6).
6) Alfred C. Haddon, Evolution in art.: as illustrated by the life-histories of designs. London 1895.
13.
Die ästhetische Bedeutung der hier besprochenen Tatsachen habe ich schon in älteren Schriften kurz dargelegt. Ausführlich darüber zu handeln, lag nicht in meinem Plan. Ich kann jedoch nicht unerwähnt lassen, daß der verstorbene Physiker J. L. Soret7) in Genf in einem schönen 1892 erschienenen Buch dies getan hat, als dessen Vorläufer ein 1866 von ihm auf der Schweizer Naturforscherversammlung gehaltener Vortrag anzusehen ist. Soret knüpft an Helmholtz an, ohne, wie es scheint, meine Ausführungen zu kennen. Die physiologische Seite der Frage wird von ihm nicht weiter erörtert, dagegen sind die Ausführungen über Ästhetik sehr reich und durch ansprechende Beispiele belegt. Soret betrachtet die ästhetische Wirkung der Symmetrie, der Wiederholung, der Ähnlichkeit und der Kontinuität, welche letztere er als einen Fall der Wiederholung ansieht. Kleinere Abweichungen von der Symmetrie können nach seiner Auffassung durch die eingeführte Mannigfaltigkeit und das hiermit verbundene intellektuelle ästhetische Vergnügen für den Ausfall des sinnlichen Vergnügens reichlich entschädigen. Dies wird an Ornamenten und den Skulpturen gothischer Dome erläutert. Dieses intellektuelle Vergnügen wird auch durch die virtuelle (potentielle) Symmetrie ausgelöst, welche man an unsymmetrischen Stellungen der symmetrischen menschlichen Figur oder anderer Gebilde wahrnimmt. Diese Betrachtungen wendet er übrigens nicht bloß auf optische Fälle an, sondern dehnt sie auf alle Gebiete aus, wie ich es ebenfalls getan habe. Er berücksichtigt den Rhythmus, die Musik, die Bewegungen, den Tanz, die Naturschönheiten und sogar die Literatur. Von besonderem Interesse sind Sorets Beobachtungen über Blinde, zu welchem ihm das Asyl von Lausanne Gelegenheit bot. Blinde erfreuen sich der periodischen Wiederholung derselben Formen an tastbaren Gegenständen, haben einen entschiedenen Sinn für Symmetrie der Formen. Auffallende Störungen derselben sind ihnen unangenehm und erscheinen ihnen zuweilen komisch. Ein Blinder, welcher seine Studien an einer großen Reliefkarte von Europa gemacht hatte, erkannte diesen Erdteil vermöge der geometrischen Ähnlichkeit, als er denselben in verkleinertem Maßstab als Teil einer größeren Reliefkarte fand. Das symmetrische Tastorgan, die beiden Arme und Hände, sind ja analog angelegt, wie das Sehorgan. Die Übereinstimmung darf uns also nicht wundern. Dieselbe hat schon auf die antiken Forscher, nicht minder auf die modernen (Descartes) gewirkt, und auch manche nicht eben glückliche Ideen erzeugt, die zum Teil noch fortwirken. Weniger gelungen scheint das Kapitel über Literatur in dem Soretschen Buche. An Metrum, Reim usw. zeigen sich ja ähnliche Erscheinungen, wie in den vorher behandelten Gebieten. Wenn aber Soret z. B. die Wirkung der sechsmal wiederkehrenden Phrase: "Que diable allait il faire sur cette galère" in dem bekannten Moliéreschen Stück8) mit der Wiederholung eines ornamentalen Motivs in Parallele setzt, so wird er wohl wenig Zustimmung finden. Die Wiederholung wirkt hier gewiß nicht als solche, sondern durch sukzessive Steigerung eines komischen Gegensatzes, nur intellektuell.
7) J. L. Soret, Sur les conditions physiques de la perception du beau.
Genese 1892.
8) Les fourberies de Scapin.
Ich möchte hier noch auf die seither erschienene Arbeit von Arnold Emch: Mathematical principles of esthetic forms (the Monist, Oktober 1900) aufmerksam machen. Emch gibt anziehende Beispiele, in welchen eine Reihe von Formen durch Befolgen desselben geometrischen Prinzips zu einem ästhetischen Eindruck zusammenwirkt. Er verfolgt denselben Gedanken, den ich in meiner Vorlesung von 1871 berührt habe, daß eine Produktion nach einer festen Regel ästhetisch wirkt. (Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig, 3. Aufl. 1903, S. 102.) Ich habe aber zugleich hervorgehoben und möchte es hier nochmals tun, daß die Regel als Verstandesangelegenheit an sich keinen ästhetischen Effekt hat, sondern nur die hierdurch bedingte Wiederholung desselben sinnlichen Motivs.
14.
Es sei hier nochmals hervorgehoben, daß geometrische und physiologische Eigenschaften eines Raumgebildes scharf zu scheiden sind. Die physiologischen Eigenschaften sind durch geometrische mitbestimmt, aber nicht allein durch diese bestimmt. Dagegen haben physiologische Eigenschaften höchst wahrscheinlich die erste Anregung zu geometrischen Untersuchungen gegeben. Die Gerade ist wohl nicht durch ihre Eigenschaft, die Kürzeste zwischen zwei Punkten zu sein, sondern zuerst durch ihre physiologische Einfachheit aufgefallen. Auch die Ebene hat, neben ihren geometrischen Eigenschaften, einen besondern physiologisch - optischen (ästhetischen) Wert, durch welchen sie auffällt, wie dies noch ausgeführt werden soll. Die Teilung der Ebene und des Raumes nach rechten Winkeln hat nicht nur den Vorzug der gleichen Teile, welche hierbei entstehen, sondern auch noch einen besonderen Symmetriewert. Der Umstand, daß kongruente und ähnliche geometrische Gebilde in eine Orientierung gebracht werden können, in welcher ihre Verwandtschaft physiologisch auffällt, hat ohne Zweifel bewirkt, daß diese Arten der geometrischen Verwandtschaft früher untersucht worden sind, als minder auffällige, wie Affinität, Kollineation und andere. Ohne Zusammenwirken der sinnlichen Anschauung und des Verstandes ist eine wissenschaftliche Geometrie nicht denkbar. H. Hankel hat aber in seiner "Geschichte der Mathematik" (Leipzig 1874) sehr schön ausgeführt, daß in der griechischen Geometrie das Verstandesmoment, in der indischen hingegen das sinnliche Moment bedeutend überwiegt. Die Inder verwenden das Prinzip der Symmetrie und der Ähnlichkeit (a. a. O. S. 206) in einer Allgemeinheit, welche den Griechen vollkommen fremd ist. Der Vorschlag Hankels, die Schärfe der griechischen Methode mit der Anschaulichkeit der indischen zu einer neuen Darstellungsweise zu verbinden, ist sehr beherzigenswert. Man brauchte übrigens hierin nur den Anregungen von Newton und Joh. Bernoulli zu folgen, welche das Prinzip der Ähnlichkeit selbst in der Mechanik in noch allgemeinerer Weise verwendet haben. Welche Vorteile auf dem letzteren Gebiete das Prinzip der Symmetrie bietet, habe ich an einem andern Orte vielfach ausgeführt9).