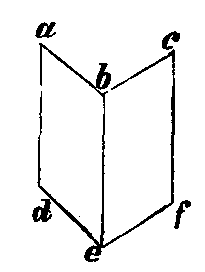
Fig. 24
1.
Die Gesichtsempfindungen treten im normalen psychischen Leben nicht
isoliert auf, sondern mit den Empfindungen anderer Sinne verknüpft.
Wir sehen nicht optische Bilder in einem optischen Raum, sondern wir nehmen
die uns umgebenden Körper mit ihren mannigfaltigen sinnlichen Eigenschaften
wahr. Erst die absichtliche Analyse löst aus diesen Komplexen die
Gesichtsempfindungen heraus. Allein auch die Wahrnehmungen insgesamt kommen
fast nur mit Gedanken, Wünschen, Trieben verknüpft vor. Durch
die Sinnesempfindungen werden die den Lebensbedingungen entsprechenden
Anpassungsbewegungen der Tiere ausgelöst. Sind diese Lebensbedingungen
einfach, wenig und langsam veränderlich, so wird die unmittelbare
Auslösung durch die Sinne zureichen. Höhere intellektuelle Entwicklung
wird unnötig sein. Anders ist dies bei sehr mannigfaltigen und veränderlichen
Lebensbedingungen. Ein so einfacher Anpassungsmechanismus kann sich da
nicht entwickeln, noch weniger zum Ziele führen.
Niedere Tiere verschlingen alles, was in ihre Nähe
kommt und den entsprechenden Reiz ausübt. Ein höher entwickeltes
Tier muß seine Nahrung mit Gefahren suchen, die gefundene geschickt
fassen oder listig fangen, und vorsichtig prüfen. Ganze Reihen von
verschiedenen Erinnerungen müssen vorbeiziehen, bevor eine den widerstreitenden
gegenüber stark genug wird, die entsprechende Bewegung auszulösen.
Hier muß also eine die Anpassungsbewegungen mitbestimmende Summe
von Erinnerungen (oder Erfahrungen) den Sinnesempfindungen gegenüberstehen.
Darin besteht der Intellekt.
Bei höheren Tieren mit komplizierten Lebensbedingungen
sind in der Jugend die Komplexe von Sinnesempfindungen, welche die Anpassungsbewegungen
auslösen, oft sehr zusammengesetzt. Das Saugen der jungen Säugetiere,
das im Kap. IV beschriebene Verhalten des jungen Sperlings sind passende
Beispiele hiefür. Mit der Entwicklung der Intelligenz werden immer
kleinere Teile dieser Komplexe zur Auslösung hinreichend, und die
Sinnesempfindungen werden immer mehr und mehr durch den Intellekt ergänzt
und ersetzt, wie sich dies an Kindern und heranwachsenden Tieren täglich
konstatieren läßt.
In der Auflage von 1886 habe ich in einer Anmerkung
vor der damals noch verbreiteten Überschätzung der Intelligenz
der niederen Tiere gewarnt. Meine Ansicht beruhte nur auf gelegentlichen
Beobachtungen über die maschinenmäßige Bewegung von Käfern,
den Lichtflug der Motten u. s. w. Seither sind die wichtigen Arbeiten von
J. Loeb erschienen, welche diese Ansicht auf eine solide experimentelle
Basis gestellt haben.
Gegenwärtig ist die Psychologie der niederen
Tiere wieder ein viel umstrittenes Gebiet. Während A. Bethe1)
auf Grund sinnreicher und interessanter Experimente in Bezug auf Ameisen
und Bienen eine extreme Reflextheorie vertritt, nach welcher diese Tiere
als Descartessche Maschinen erscheinen, schreiben sorgfältige
kritische Beobachter, wie E. Wasmann2),
H. v. Buttel-Reepen3),
A. Forel4) u. a. denselben
Tieren eine recht hohe psychische Entwicklung zu. Auch die Psychologie
der höheren Tiere liegt jetzt dem allgemeinen Interesse wieder näher.
Die Schriften von Th. Zell, die sich vorwiegend an das große
Publikum wenden, enthalten manche gute Beobachtung, manchen glücklichen
Blick und scheinen der Überschätzung und Unterschätzung
der Tiere in besonnener Weise gleich fern zu bleiben.
2) E. Wasmann Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. Stuttgart 1899, Zoologica. Heft 26. – Vergleichen-de Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höheren Tiere, 2. Aufl., Freiburg i. Br. 1900.
Ich hoffe, daß wir nicht nur von unseren Kindern, sondern auch von "unseren jüngeren Brüdern", den Tieren noch sehr viel für die eigene Psychologie lernen werden. Um aber zu verstehen, warum der Mensch psychisch so viel mehr ist als das klügste Tier, wird es wohl hinreichen, auf die Erwerbungen der Art und des Individuums in der Atmosphäre einer vieltausendjährigen sozialen Kultur zu achten.
2.
Die Vorstellungen haben also die Sinnesempfindungen, soweit sie unvollständig
sind, zu ersetzen, und die durch letztere anfänglich allein bedingten
Prozesse weiterzuspinnen. Die Vorstellungen dürfen aber im normalen
Leben die Sinnesempfindungen, soweit letztere vorhanden sind, durchaus
nicht dauernd verdrängen, wenn hieraus nicht die höchste Gefahr
für den Organismus entspringen soll. In der Tat besteht im normalen
psychischen Leben ein sehr starker Unterschied zwischen beiden Arten psychischer
Elemente. Ich sehe eine schwarze Tafel vor mir. Ich kann mir mit der größten
Lebhaftigkeit auf dieser Tafel ein mit scharfen weißen Strichen gezogenes
Sechseck oder eine farbige Figur vorstellen. Ich weiß aber, pathologische
Fälle abgerechnet, immer, was ich sehe, was ich mir vorstelle. Ich
fühle, wie ich bei dem Übergang zur Vorstellung die Aufmerksamkeit
von dem Auge abwende und anderswohin richte. Der auf der Tafel gesehene
und der an derselben Stelle vorgestellte Fleck unterscheiden sich durch
diese Aufmerksamkeit wie durch eine vierte Koordinate. Die Tatsachen würden
nicht vollständig gedeckt, wenn man sagen würde, das Eingebildete
lege sich über das Gesehene wie das Spiegelbild in einer unbelegten
Glasplatte über die hindurchgesehenen Körper. Im Gegenteil scheint
mir das Vorgestellte durch einen qualitativ verschiedenen, widerstreitenden
sinnlichen Reiz verdrängt zu werden und auch letzteren zeitweilig
zu verdrängen. Das ist vorläufig eine psychologische Tatsache,
deren physiologische Erklärung sich gewiß auch finden wird.
Es ist natürlich anzunehmen, daß bei
Vorstellungen teilweise auch dieselben organischen Prozesse durch die Wechselwirkung
der Organe des Zentralnervensystems wieder aufleben, welche bei den entsprechenden
Empfindungen durch den physikalischen Reiz bedingt waren. Die Vorstellungen
unterscheiden sich in normalen Fällen von den Empfindungen wohl durch
ihre geringere Intensität, vor allem aber durch ihre Flüchtigkeit.
Wenn ich mir in der Vorstellung eine geometrische Figur zeichne, so verhält
es sich so, als ob die Linien, bald nachdem sie gezogen wurden, verlöschen
würden, sobald die Aufmerksamkeit sich andern Linien zuwendet. Bei
Rückkehr findet man sie nicht mehr vor, und muß sie aufs neue
reproduzieren. In diesem Umstande liegt hauptsächlich der Vorteil
und die Bequemlichkeit, den eine materielle geometrische Zeichnung gegenüber
der vorgestellten bietet. Eine geringe Anzahl Linien, z. B. Zentri- und
Peripheriewinkel auf demselben Kreisbogen mit einem Paar zusammenfallender
oder sich schneidender Schenkel, wird man leicht in der Vorstellung festhalten.
Fügt man im letzteren Falle noch den Durchmesser durch den Scheitel
des Peripheriewinkels hinzu, so wird es schon schwerer, in der Vorstellung
das Maßverhältnis der Winkel abzuleiten, ohne fortwährend
die Figur zu erneuern und zu ergänzen. Die Geläufigkeit und Geschwindigkeit
des Wiederersetzens gewinnt übrigens ungemein durch die Übung.
Als ich mich mit der Steinerschen und v. Staudtschen
Geometrie beschäftigte, konnte ich darin viel mehr leisten, als es
mir jetzt möglich ist.
Bei der stärkern Entwicklung der Intelligenz,
welche durch die komplizierten Lebensverhältnisse des Menschen bedingt
ist, können die Vorstellungen zeitweilig die ganze Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, so daß Vorgänge in der Umgebung des Sinnenden
nicht gesehen, an ihn gerichtete Fragen nicht gehört werden, was solcher
Beschäftigung ungewohnte Menschen "Zerstreuung" nennen, während
es viel passender "Sammlung" heißen würde. Wird nun der Betreffende
in einem solchen Falle gestört, so empfindet er sehr deutlich die
Arbeit beim Wechsel der Aufmerksamkeit.
3.
Die Beachtung dieses Unterschiedes zwischen den Vorstellungen und Sinnesempfindungen
ist sehr geeignet, vor Unvorsichtigkeit bei psychologischen Erklärungen
der Sinnesphänomene zu schützen. Die bekannte Theorie der "unbewußten
Schlüsse" wäre nie zu so breiter Entwicklung gelangt, wenn man
mehr auf diesen Umstand geachtet hätte.
Das Organ, dessen Zustände die Vorstellungen
bestimmen, können wir uns vorläufig als ein solches denken, welches
(in einem geringeren Grade) aller spezifischen Energieen der Sinnesorgane
und der motorischen Organe fähig ist, so daß je nach seiner
Aufmerksamkeitsstimmung bald diese, bald jene Energie eines Organs in dasselbe
hineinspielen kann. Ein solches Organ wird vorzüglich geeignet sein,
die physiologische Beziehung zwischen den verschiedenen Energieen zu vermitteln.
Wie die Erfahrungen an Tieren mit entferntem Großhirn lehren, gibt
es außer dem "Vorstellungsorgan" wahrscheinlich noch mehrere andere
analoge, mit dem Großhirn weniger innig zusammenhängende Vermittlungsorgane,
deren Vorgänge daher nicht ins Bewußtsein fallen.
Der Reichtum des Vorstellungslebens, wie wir denselben
aus der Selbstbeobachtung kennen, tritt gewiß erst beim Menschen
auf. Die Anfänge dieser Lebensäußerung, in welcher sich
durchaus nur die Beziehung aller Teile des Organismus zu einander ausspricht,
reichen ebenso gewiß tief in der Entwicklungsreihe der Tiere herab.
Aber auch die Teile eines Organs müssen durch gegenseitige Anspannung
zu einander in eine Beziehung treten, welche jener der Teile des Gesamtorganismus
analog ist. Die beiden Netzhäute mit ihrem von den Lichtempfindungen
abhängigen motorischen Akkommodations- und Blendungsapparat geben
ein sehr klares und bekanntes Beispiel eines solchen Verhältnisses.
Das physiologische Experiment und die einfache Selbstbeobachtung belehren
uns darüber, daß ein solches Organ seine eigenen zweckmäßigen
Lebensgewohnheiten, sein besonderes Gedächtnis, fast möchte man
sagen, seine eigene Intelligenz hat.
4.
Die lehrreichsten hierher gehörigen Beobachtungen sind wohl von
Johannes Müller in seiner schönen Schrift "Über die
phantastischen Gesichtserscheinungen" (Coblenz 1826) zusammengestellt worden.
Die von Müller u. a. im wachen Zustande beobachteten Gesichtsphantasmen
entziehen sich durchaus dem Einfluß des Willens und der Überlegung.
Es sind selbständige, wesentlich an das Sinnesorgan gebundene Erscheinungen,
welche durchaus den Charakter des objektiv Gesehenen an sich tragen. Es
sind wahre Phantasie- und Gedächtniserscheinungen des Sinnes. Müller
hält das freie Eigenleben der Phantasie für einen Teil des organischen
Lebens und für unvereinbar mit den sogenannten Assoziationsgesetzen,
über welche er sich sehr abfällig ausspricht. Es scheint mir,
daß die kontinuierlichen Änderungen der Phantasmen, die Müller
beschreibt, nicht gegen die Assoziationsgesetze sprechen. Diese Vorgänge
können vielmehr geradezu als Erinnerungen an die langsamen perspektivischen
Änderungen der Gesichtsbilder aufgefaßt werden. Das Sprunghafte
in dem gewöhnlichen assoziativen Verlauf der Vorstellungen kommt doch
nur dadurch hinein, daß bald dieses, bald jenes Sinnesgebiet mitzusprechen
beginnt. Vgl. Kap. XI.
Jene Prozesse, welche in der "Sehsinnsubstanz" (nach
Müller) normaler Weise als Folgen der Netzhauterregung sich
abspielen, und welche das Sehen bedingen, können ausnahmsweise auch
ohne Netzhauterregung spontan in der Sehsinnsubstanz auftreten, und die
Quelle von Phantasmen oder Halluzinationen werden. Wir sprechen von Sinnengedächtnis,
wenn sich die Phantasmen in ihrem Charakter stark an zuvor Gesehenes anschließen,
von Halluzinationen, wenn die Phantasmen freier und unvermittelter eintreten.
Eine scharfe Grenze zwischen beiden Fällen wird aber kaum festzuhalten
sein.
Ich kenne alle Arten von Gesichtsphantasmen aus
eigener Anschauung. Das Hineinspielen von Phantasmen in undeutlich Gesehenes,
wobei letzteres teilweise verdrängt wird, kommt wohl am häufigsten
vor. Besonders lebhaft treten mir diese Erscheinungen nach einer ermüdenden
nächtlichen Eisenbahnfahrt auf. Alle Felsen, Bäume nehmen dann
die abenteuerlichsten Gestalten an. — Als ich mich vor Jahren eingehender
mit Pulskurven und Sphygmographie beschäftigte, traten mir die zarten
weißen Kurven auf schwarzem Grunde des Abends und auch bei Tage im
Halbdunkel oft mit voller Lebhaftigkeit und Objektivität vor Augen.
Auch später sah ich bei verschiedenen physikalischen Beschäftigungen
analoge Erscheinungen des "Sinnengedächtnisses". — Seltener traten
mir bei Tage Bilder vor Augen, die ich zuvor nicht gesehen hatte. So leuchtete
mir vor Jahren an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Buch, in
welchem ich las, oder auf dem Schreibpapier ein hellrotes Kapillarnetz
(ähnlich einem sogenannten Wundernetz) auf, ohne daß ich mich
mit derartigen Formen beschäftigt hatte. — Das Sehen von lebhaft gefärbten
veränderlichen Tapetenmustern vor dem Einschlafen war mir in meiner
Jugend sehr geläufig; es tritt auch jetzt noch ein, wenn ich die Aufmerksamkeit
darauf richte. Auch eines meiner Kinder erzählte mir oft vom "Blumensehen",
vor dem Einschlafen. Seltener sehe ich abends vor dem Einschlafen mannigfaltige
menschliche Gestalten, die sich ohne meinen Willen ändern. Ein einziges
Mal versuchte ich mit Erfolg ein menschliches Gesicht in einen skelettierten
Schädel umzuwandeln; dieser vereinzelte Fall kann aber auch ein Zufall
sein. — Daß beim Erwachen im dunklen Zimmer die letzten Traumbilder
in lebhaften Farben mit einer Fülle von Licht noch vorhanden waren,
ist mir oft vorgekommen. — Eine eigentümliche Erscheinung, die mir
seit einigen Jahren häufiger begegnet, ist folgende. Ich erwache und
liege mit geschlossenen Augen ruhig da. Vor mir sehe ich die Bettdecke
mit allen ihren Fältchen, und auf derselben meine Hände mit allen
Einzelheiten ruhig und unveränderlich. Öffne ich die Augen, so
ist es entweder ganz dunkel, oder zwar hell, aber die Decke und die Hände
liegen ganz anders, als sie mir erschienen waren. Es ist dies ein besonders
starres und dauerndes Phantasma, wie ich es unter anderen Verhältnissen
nicht beobachtet habe. Ich glaube an diesem Bild zu bemerken, daß
alle auch weit voneinander abliegenden Teile zugleich deutlich erscheinen,
in einer Weise, wie dies bei objektiv Gesehenem aus bekannten Gründen
unmöglich ist.
Akustische Phantasmen, namentlich musikalische,
traten in meiner Jugend öfter nach dem Erwachen sehr lebhaft auf,
sind aber, seit mein Interesse für Musik sehr abgenommen hat, recht
selten und dürftig geworden. Vielleicht ist aber auch das Interesse
für Musik das Sekundäre, Bedingte.
Spuren von Phantasmen, wenn man die Netzhaut dem
Einfluß der äußeren Reize entzieht und die Aufmerksamkeit
dem Sehfelde allein zuwendet, sind fast immer vorhanden. Ja sie zeigen
sich schon dann, wenn die äußeren Reize schwach und unbestimmt
sind, im Halbdunkel, oder wenn man etwa eine Fläche mit matten, verschwommenen
Flecken, eine Wolke, eine graue Wand beobachtet. Die Gestalten, die man
dann zu sehen meint, so weit sie nicht auf einem bloßen Herausheben
und Zusammenfassen deutlich gesehener Flecke durch die Aufmerksamkeit beruhen,
sind jedenfalls keine vorgestellten, sondern wenigstens teilweise spontane
Phantasmen, welchen zeitweilig und stellenweise der Netzhautreiz weichen
muß. Die Erwartung scheint in diesen Fällen das Auftreten der
Phantasmen zu begünstigen. Sehr oft glaubte ich beim Aufsuchen von
Interferenzstreifen die ersten matten Spuren derselben im Gesichtsfeld
deutlich wahrzunehmen, während mich die Fortführung des Versuches
überzeugte, daß ich mich gewiß getäuscht hatte. Einen
Wasserstrahl, dessen Hervortreten aus einem Kautschukschlauch ich erwartete,
glaubte ich im halbdunklen Raum wiederholt deutlich zu sehen, und erkannte
den Irrtum erst durch Tasten mit dem Finger. Solche schwache Phantasmen
scheinen sich gegen den Einfluß des Intellektes sehr nachgiebig zu
verhalten, während dieser gegen die starken, lebhaft gefärbten
nichts auszurichten vermag. Erstere stehen den Vorstellungen, letztere
den Sinnesempfindungen näher.
Diese schwachen Phantasmen, welche von Sinnesempfindungen
bald überwältigt werden, bald den letzteren das Gleichgewicht
halten, bald diese verdrängen, legen die Möglichkeit nahe, die
Stärke der Phantasmen mit jener der Empfindungen zu vergleichen. Scripture
hat diesen Gedanken ausgeführt, indem er in dem Gesichtsfelde eines
Beobachters, der in demselben ein (nicht vorhandenes) Fadenkreuz zu sehen
glaubte, eine reelle Linie von unerwarteter Richtung mit von Null an wachsender
Intensität auftreten ließ, bis diese bemerkt und dem Phantasma
gleich geschätzt wurde7). Es lassen
sich alle Übergange von der Empfindung zur Vorstellung nachweisen.
Nirgends kommen wir auf ein psychisches Element, welches mit der Empfindung,
die wir unzweifelhaft auch als ein physisches Objekt ansehen müssen,
ganz unvergleichbar wäre. Der (assoziative) Zusammenhang der Vorstellungen
ist allerdings ein anderer als jener der Empfindungen.
7) Scripture, The new Psychology, London 1897, p. 484.
5.
Leonardo da Vinci a. a. O. bespricht das Hineinspielen der Phantasmen
in das Gesehene in folgenden Worten:
"Ich werde nicht ermangeln, unter diese Vorschriften
eine neuerfundene Art des Schauens herzusetzen, die sich zwar klein und
fast lächerlich ausnehmen mag, nichtsdestoweniger aber doch sehr brauchbar
ist, den Geist zu verschiedenerlei Erfindungen zu wecken. Sie besteht darin,
daß du auf manche Mauern hinsiehst, die mit allerlei Flecken bedeckt
sind, oder auf Gestein mit verschiedenem Gemisch. Hast du irgend eine Situation
zu erfinden, so kannst du da Dinge erblicken, die verschiedenen Landschaften
gleichsehen, geschmückt mit Gebirgen, Flüssen, Felsen, Bäumen,
großen Ebenen, Tal und Hügeln von mancherlei Art. Auch kannst
du da allerlei Schlachten sehen, lebhafte Stellungen sonderbarer fremdartiger
Figuren, Gesichtsmienen, Trachten und unzählige Dinge, die du in vollkommene
und gute Form bringen magst. Es tritt bei derlei Mauern und Gemisch das
Ähnliche ein, wie beim Klang der Glocken, da wirst du in den Schlägen
jeden Namen und jedes Wort wiederfinden können, die du dir einbildest".
"Achte diese meine Meinung nicht gering, in der
ich dir rate, es möge dir nicht lästig erscheinen, manchmal stehen
zu bleiben, und auf die Mauerflecken hinzusehen, oder in die Asche im Feuer,
in die Wolken, oder in Schlamm und auf andere solche Stellen; du wirst,
wenn du sie recht betrachtest, sehr wunderbare Erfindungen in ihnen entdecken.
Denn des Malers Geist wird zu (solchen) neuen Erfindungen (durch sie) aufgeregt,
sei es in Kompositionen von Schlachten, von Tier und Menschen, oder auch
zu verschiedenerlei Kompositionen von Landschaften und von ungeheuerlichen
Dingen, wie Teufeln und dgl., die angetan sind, dir Ehre zu bringen. Durch
verworrene und unbestimmte Dinge wird nämlich der Geist zu neuen Erfindungen
wach. Sorge aber vorher, daß du alle die Gliedmaßen der Dinge,
die du vorstellen willst, gut zu machen verstehst, so die Glieder der lebenden
Wesen, wie auch die Gliedmaßen der Landschaft, nämlich die Steine,
Bäume und dgl".
Das stärkere selbständige Auftreten der
Phantasmen, ohne Anregung durch die Netzhaut, den Traum und den halbwachen
Zustand abgerechnet, muß seiner biologischen Unzweckmäßigkeit
wegen als pathologisch angesehen werden. Ebenso müßte man jede
abnorme Abhängigkeit der Phantasmen vom Willen als pathologisch bezeichnen.
Solche Zustände mögen wohl bei jenen Irren vorkommen, welche
sich für sehr mächtig, für Gott usw., halten. Das bloße
Fehlen hemmender Assoziationen kann aber ebenfalls zu Größenwahnvorstellungen
führen. So kann man im Traum glauben, die größten Probleme
gelöst zu haben, weil die Assoziationen, welche den Widerspruch aufdecken,
sich nicht einstellen.
6.
Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir einige physiologisch-optische
Erscheinungen betrachten, deren vollständige Erklärung zwar noch
fern liegt, die aber als Äußerungen eines selbständigen
Lebens der Sinnesorgane relativ noch am verständlichsten sind.
Man sieht gewöhnlich mit beiden Augen, und
zu einem bestimmten Zweck im Dienste des Lebens, nicht Farben und Formen,
sondern die Körper im Raume. Nicht die Elemente des Komplexes, sondern
der ganze physiologisch-optische Komplex ist von Wichtigkeit. Diesen Komplex
sucht das Auge nach den unter seinen Lebensbedingungen erworbenen (oder
ererbten) Gewohnheiten zu ergänzen, wenn er einmal infolge besonderer
Umstände unvollständig auftritt. Das geschieht zunächst
leicht beim Sehen mit einem Auge oder auch beim Sehen sehr ferner Objekte
mit beiden Augen, wenn die stereoskopischen Differenzen in bezug auf den
Augenabstand verschwinden.
Man nimmt gewöhnlich nicht Licht und Schatten,
sondern räumliche Objekte wahr. Der Selbstschatten der Körper
wird kaum bemerkt. Die Helligkeitsdifferenzen lösen Tiefempfindungsdifferenzen
aus und helfen den Körper modellieren, wo die stereoskopischen Differenzen
hierzu nicht mehr ausreichen, wie dies bei Betrachtung ferner Gebirge sehr
auffallend wird.
Sehr belehrend ist in dieser Hinsicht das Bild auf
der matten Tafel der photographischen Kammer. Man erstaunt hier oft über
die Helligkeit der Lichter und die Tiefe der Schatten, die man an den Körpern
gar nicht bemerkte, solange man nicht genötigt war, alles in einer
Ebene zu sehen. Ich erinnere mich aus meinen Kinderjahren sehr wohl, daß
mir jede Schattierung einer Zeichnung als eine ungerechtfertigte und entstellende
Manier erschien, und daß mich eine Konturzeichnung weit mehr befriedigte.
Es ist ebenso bekannt, daß ganze Völker, wie die Chinesen, trotz
entwickelter artistischer Technik, gar nicht oder nur mangelhaft schattieren.
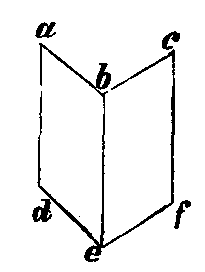
Folgendes Experiment, das ich vor vielen Jahren angestellt habe8), illustriert sehr deutlich die berührte Beziehung zwischen Lichtempfindung und Tiefenempfindung. Wir stellen eine geknickte Visitenkarte vor uns auf den Schreibtisch, so daß sie die erhabene Kante b e uns zukehrt. Von links falle das Licht ein. Die Hälfte a b d e ist dann viel heller, b c e f viel dunkler, was aber bei unbefangener Betrachtung kaum bemerkbar wird. Nun schließen wir ein Auge. Hiermit verschwindet ein Teil der Raumempfindungen. Noch immer sehen wir das geknickte Blatt räumlich und an der Beleuchtung nichts Auffallendes. Sobald es uns aber gelingt, statt der erhabenen Kante be eine hohle zu sehen, erscheinen Licht und Schatten wie mit Deckfarben darauf gemalt. Von der leicht erklärbaren perspektivischen Verzerrung der Karte sehe ich zunächst ab. Eine solche "Inversion" ist möglich, weil durch ein monokulares Bild die Tiefe nicht bestimmt ist. Stellt in Fig. 25, 1 0 das Auge, a b c den Durchschnitt eines geknickten Blattes, der Pfeil die Lichtrichtung vor, so erscheint a b heller als b c. In 2 ist ebenso a b heller als b c. Das Auge muß, wie man sieht, die Gewohnheit annehmen, mit der Helligkeit der gesehenen Flächenelemente auch das Gefälle der Tiefempfindung zu wechseln. Das Gefälle und die Tiefe nimmt mit abnehmender Helligkeit nach rechts ab, wenn das Licht von links einfällt (1), umgekehrt, wenn es von rechts einfällt. Da die Hüllen des Bulbus, in welchen die Netzhaut eingebettet ist, durchscheinend sind, so ist es auch für die Lichtverteilung auf den Netzhäuten nicht gleichgültig, ob das Licht von rechts oder links einfällt. Die Umstände sind also ganz danach angetan, daß sich ohne alles Zutun des Urteils eine feste Gewohnheit des Auges herausbilden kann, vermöge welcher Helligkeit und Tiefe in bestimmterweise verbunden werden. Gelingt es nun, einen Teil der Netzhaut, wie in dem obigen Versuch, vermöge einer andern Gewohnheit mit der erstem in Widerstreit zu bringen, so äußert sich dies durch auffallende Empfindungen.
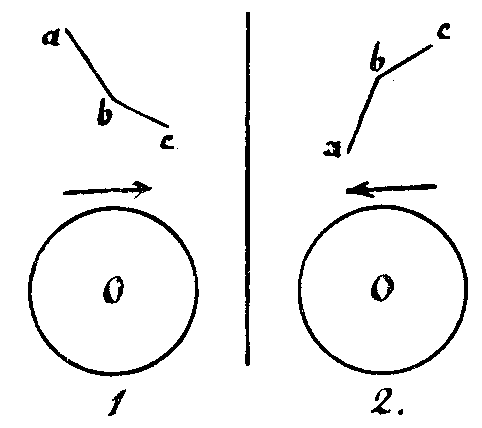
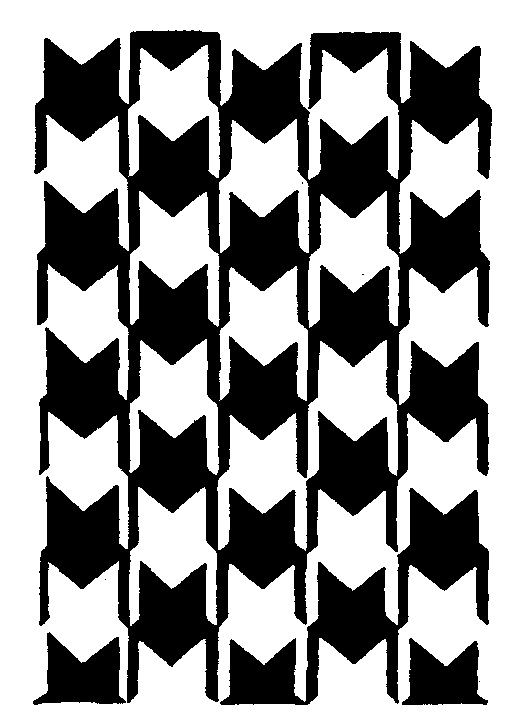
7.
Die Gewohnheit Körper zu beobachten, d. h. einer größern räumlich zusammenhängenden Masse von Lichtempfindungen die Aufmerksamkeit zuzuwenden, bringt eigentümliche, zum Teil überraschende Erscheinungen mit sich. Eine zweifarbige Malerei oder Zeichnung z. B. sieht im allgemeinen ganz verschieden aus, je nachdem man die eine oder die andere Farbe als Grund auffaßt. Die Vexierbilder, in welchen etwa ein Gespenst zwischen Baumstämmen erscheint, sobald man den hellen Himmel als Objekt, die dunklen Bäume aber als Grund auffaßt, sind bekannt. Nur ausnahmsweise bietet Grund und Objekt dieselbe Form dar, worin ein häufig verwendetes ornamentales Motiv besteht, wie dies z. B. die Fig. 26 von S. 15 der erwähnten "Grammar of Ornament", ferner die Figuren 20, 22 der Tafel 45, Figur 13 der Tafel 43 jenes Werkes veranschaulichen.
8.
Die Erscheinungen des Raumsehens, welche bei monokularer Betrachtung
eines perspektivischen Bildes, oder, was auf dasselbe hinauskommt; bei
monokularer Betrachtung eines Objektes auftreten, werden gewöhnlich
als fast selbstverständliche sehr leichthin behandelt. Ich bin aber
der Meinung, daß an denselben noch mancherlei zu erforschen ist.
Durch dasselbe perspektivische Bild, welches unendlich vielen verschiedenen
Objekten angehören kann, ist die Raumempfindung nur teilweise bestimmt.
Wenn also gleichwohl von den vielen dem Bilde zugehörigen denkbaren
Körpern nur sehr wenige wirklich gesehen werden, und zwar mit dem
Charakter der vollen Objektivität, so muß dies einen triftigen
physiologischen Grund haben. Es kann nicht auf dem Hinzudenken von Nebenbestimmungen
beruhen, nicht auf bewußten Erinnerungen, welche uns auftauchen,
sondern auf bestimmten Lebensgewohnheiten des Gesichtssinnes.
Verfährt der Gesichtssinn nach den Gewohnheiten,
welche er unter den Lebensbedingungen der Art und des Individuums erworben
hat, so kann man zunächst annehmen, daß er nach dem Prinzip
der Wahrscheinlichkeit vorgeht, d. h. diejenigen Funktionen, welche am
häufigsten zusammen ausgelöst wurden, werden auch zusammen auftreten,
wenn nur eine allein angeregt wird. Diejenigen Tiefenempfindungen z. B.,
welche am häufigsten mit einem bestimmten perspektivischen Bild verbunden
sind, werden auch leicht reproduziert, wenn jenes Bild auftritt, ohne daß
diese Empfindungen mitbestimmt sind. Außerdem scheint sich beim Sehen
perspektivischer Bilder ein Prinzip der Sparsamkeit auszusprechen, d. h.
der Gesichtssinn ladet sich von selbst keine größere Anstrengung
auf als diejenige, welche durch den Reiz bestimmt ist. Beide Prinzipien
fallen, wie wir sehen werden, in ihren Wirkungen zusammen.
9.
Wir wollen uns das eben Ausgesprochene in den Einzelheiten erläutern.
Betrachten wir eine Gerade in einem perspektivischen Bilde, so sehen wir
diese immer als eine Gerade im Raume, obgleich die Gerade als perspektivisches
Bild unendlich vielen verschiedenen ebenen Kurven als Objekten entsprechen
kann. Allein nur in dem besondern Fall, daß die Ebene einer Kurve
durch den Kreuzungspunkt des einen Auges hindurchgeht, wird sie sich auf
der betreffenden Netzhaut als Gerade (beziehungsweise als größter
Kreis) abbilden, und nur in dem noch spezielleren Fall, daß die Kurvenebene
durch die Kreuzungspunkte beider Augen hindurchgeht, bildet sie sich für
beide Augen als Gerade ab. Es ist also sehr unwahrscheinlich, daß
eine ebene Kurve als Gerade erscheint, während dagegen eine Gerade
im Raume sich immer als Gerade auf beiden Netzhäuten abbildet. Das
wahrscheinlichste Objekt also, welches einer perspektivischen Geraden entspricht,
ist eine Gerade im Raume.
Die Gerade hat mannigfaltige geometrische Eigenschaften.
Diese geometrischen Eigenschaften, z. B. die bekannte Eigenschaft, die
Kürzeste zwischen zwei Punkten darzustellen, sind aber physiologisch
nicht von Belang. Wichtiger ist schon, daß in der Medianebene liegende
oder zur Medianebene senkrechte Gerade physiologisch zu sich selbst symmetrisch
sind. Die in der Medianebene liegende Vertikale zeichnet sich außerdem
noch durch die größte Gleichmäßigkeit der Tiefenempfindung
und durch ihre Koinzidenz mit der Richtung der Schwere physiologisch aus.
Alle vertikalen Geraden können leicht und rasch mit der Medianebene
zur Koinzidenz gebracht werden, und nehmen daher an diesem physiologischen
Vorzug teil. Allein die Gerade im Raume überhaupt muß sich noch
durch etwas anderes physiologisch auszeichnen. Die Gleichheit der Richtung
in allen Elementen wurde schon früher hervorgehoben. Jedem Punkt der
Geraden im Raume entspricht aber auch das Mittel der Tiefenempfindungen
der Nachbarpunkte. Die Gerade im Raume bietet also ein Minimum der Abweichungen
vom Mittel der Tiefenempfindungen dar, wie jeder Punkt einer Geraden das
Mittel der gleichartigen Raumwerte der Nachbarpunkte darbietet. Es liegt
hiernach die Annahme nahe, daß die Gerade mit der geringsten Anstrengung
gesehen wird. Der Gesichtssinn geht also nach dem Prinzip der Sparsamkeit
vor, wenn er uns mit Vorliebe Gerade vorspiegelt, und zugleich nach dem
Prinzip der Wahrscheinlichkeit.
Noch 1866 schrieb ich in den Sitzungsberichten der
Wiener Akademie, Bd. 54: "Da die gerade Linie den zivilisierten Menschen
immer und überall umgibt, so kann man wohl annehmen, daß jede
auf der Netzhaut mögliche Gerade unzähligemal auf jede mögliche
Art als Gerade im Raume gesehen worden sei. Die Geläufigkeit des Auges
im Auslegen des Bildes der Geraden darf uns daher nicht befremden". — Ich
schrieb schon damals diese Stelle (entgegen der darwinistischen
Anschauung, die ich in derselben Abhandlung geltend machte) mit halbem
Herzen. Heute bin ich mehr als je überzeugt, daß die erwähnte
Fähigkeit keine Folge der individuellen Übung, ja nicht einmal
der menschlichen Übung ist, sondern daß sie auch den Tieren
zukommt und teilweise wenigstens ein Erbstück ist.
10.
Die Abweichung einer Empfindung vom Mittel der Nachbarempfindungen fällt überhaupt immer auf und fordert von dem Sinnesorgan eine besondere Anstrengung. Jede Krümmung einer Kurve, jede Hervorragung oder Vertiefung einer Fläche bedeutet immer die Abweichung einer Raumempfindung von dem Mittel der Umgebung, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Die Ebene zeichnet sich physiologisch dadurch aus, daß jene Abweichung vom Mittel ein Minimum oder speziell für jeden Punkt = 0 ist. Betrachtet man im Stereoskop irgend eine fleckige Fläche, deren Teilbilder sich noch nicht zu einem binokularen Bilde vereinigt haben, so macht es einen besonders wohltuenden Eindruck, wenn sich dieselbe plötzlich zu einer Ebene ausstreckt. Der ästhetische Eindruck des Kreises und der Kugel scheint wesentlich darauf zu beruhen, daß die bezeichnete Abweichung vom Mittel für alle Punkte gleich ist.
11.
Daß die Abweichung vom Mittel der Umgebung in bezug auf die Lichtempfindung eine Rolle spielt, habe ich in einer älteren Arbeit nachgewiesen10). Malt man eine Reihe von schwarzen und weißen Sektoren, wie dies in Fig. 27 angedeutet ist, auf einen Papierstreifen AA BB und wickelt diesen nachher als Mantel auf einen Zylinder, dessen Achse parallel AB ist, so entsteht durch die rasche Rotation des letzteren ein graues Feld mit von B gegen A zu wachsender Helligkeit, in welchem aber ein hellerer Streifen a a und ein dunklerer b b hervortritt. Die Stellen, welche den Knickungen a entsprechen, sind nicht physikalisch heller als die Umgebung; ihre Lichtintensität übertrifft aber das Intensitäts-Mittel der nächsten Umgebung, während umgekehrt die Intensität bei b unter der mittleren Intensität der Umgebung bleibt11). Diese Abweichung vom Mittel wird also deutlich empfunden und ladet demnach dem Sehorgan eine besondere Arbeit auf. Die kontinuierliche Änderung der Helligkeit wird hingegen kaum bemerkt, solange die Helligkeit eines jeden Punktes dem Mittel der Nachbarn entspricht. Welche teleologische Bedeutung dieser Umstand für das Hervorheben und die Begrenzung der Objekte hat, darauf habe ich vor langer Zeit (a. a. O. Sitzb. der Wien. Akad., 1865, Oktob. u. 1868, Januar) schon hingewiesen. Die Netzhaut verwischt kleine Unterschiede und hebt größere unverhältnismäßig hervor. Sie schematisiert und karikiert. Schon Panum hat seiner Zeit auf die Bedeutung der Konturen für das Sehen aufmerksam gemacht.
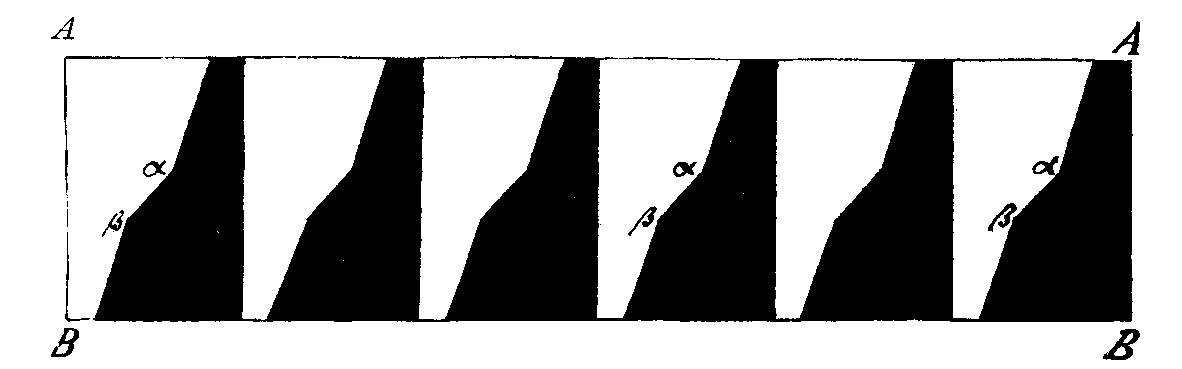
11) Eine Bemerkung über Analogien zwischen der Lichtempfindung und der Potentialfunktion findet sich in meiner Note ,,Über Herrn Guébhards Darstellung der Äquipotentialkurven". Wiedemanns Annalen (1882), Bd. 17, S. 864 und "Prinzipien der Wärmelehre", 2. Aufl. 1900, S. 118.
12.
In bezug auf die durch ein monokulares Bild ausgelösten Tiefenempfindungen sind die folgenden Versuche lehrreich. Die Zeichnung Figur 28 ist ein ebenes Viereck mit den beiden Diagonalen. Betrachten wir sie monokular, so erscheint sie auch, dem Wahrscheinlichkeits- und Sparsamkeitsgesetz entsprechend, am leichtesten eben. Nicht ebene Objekte zwingen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das Auge zum Tiefensehen. Wo dieser Zwang fehlt, ist das ebene Objekt das wahrscheinlichste und zugleich für das Sehorgan das bequemste.
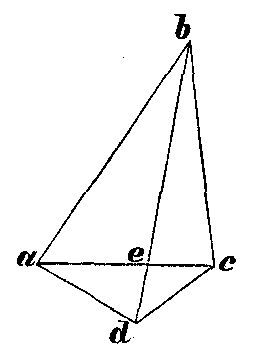
Dieselbe Zeichnung kann monokular noch als ein Tetraeder
gesehen werden, dessen Kante bd vor ac liegt, oder als ein
Tetraeder, dessen Kante bd hinter ac liegt. Der Einfluß
der Vorstellung und des Willens auf den Sehprozeß ist ein höchst
beschränkter, er reduziert sich auf die Leitung der Aufmerksamkeit,
und auf die Auswahl der Stimmung des Sehorgans für einen von mehreren
in seiner Gewohnheit liegenden Fällen, von welchen aber jeder einzelne
gewählte sich dann mit maschinenmäßiger Sicherheit und
Präzision einstellt. Auf den Punkt e achtend, kann man in der
Tat willkürlich zwischen den beiden optisch möglichen Tetraedern
wechseln, je nachdem man sich bd näher oder ferner als ac
vorstellt. Für diese beiden Fälle ist das Sehorgan eingeübt,
weil häufig ein Körper durch den anderen teilweise gedeckt wird.
Loeb13) findet,
daß eine Annäherung der Figur 31 (s. u.) Akkomodation
für die Nähe und damit auch Erhabensehen der fixierten Kante
be auslöst. Ich habe einen so bestimmten Erfolg nicht erzielen
können, und kann auch theoretisch keinen zureichenden Grund für
denselben findenl4), obgleich ich gern
zugebe, daß Entfernungsänderungen der Figur leicht zum Wechsel
der Auffassung führen.
13) Loeb, Über optische Inversion. Pflügers Archiv, Bd. 40, 1887, S. 247.
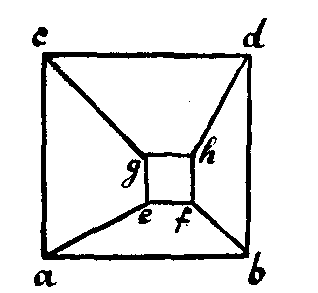
Die Wirkung einer linearen perspektivischen Zeichnung
auf den der Perspektive Unkundigen, sobald er überhaupt von der Zeichnungsebene
abzusehen vermag, was bei monokularer Betrachtung leicht gelingt, tritt
ebenso sicher ein, wie bei vollständiger Kenntnis der Perspektivlehre.
Die Überlegung und auch die Erinnerung an gesehene Objekte hat nach
meiner Überzeugung mit dieser Wirkung wenig oder nichts zu schaffen.
Warum die Geraden der Zeichnung als Gerade im Raume gesehen werden, wurde
schon erörtert. Wo Gerade in einem Punkt der Zeichnungsebene zu konvergieren
scheinen, werden die konvergierenden oder sich annähernden Enden nach
dem Wahrscheinlichkeitsprinzip und dem Sparsamkeitsprinzip in gleiche oder
nahe gleiche Tiefe verlegt. Hierdurch ist die Wirkung der Fluchtpunkte
gegeben. Parallel können solche Linien gesehen werden, die Notwendigkeit
eines solchen Eindrucks besteht aber nicht. Halten wir die Zeichnung Fig.
29 in gleicher Höhe mit dem Auge, so kann sie uns den Blick
in die Tiefe eines Ganges vorspiegeln. Die Enden ghef werden in
gleiche Ferne verlegt. Ist die Entfernung groß, so scheinen hierbei
die Linien ae, bf, cg, dh horizontal. Erhebt man die Zeichnung,
so heben sich die Enden efgh, und der Boden abef scheint
bergan zu steigen. Bei Senkung der Zeichnung tritt die umgekehrte Erscheinung
ein. Analoge Veränderungen beobachten wir, wenn wir die Zeichnung
rechts oder links zur Seite schieben. Hierbei kommen nun die Elemente der
perspektivischen Wirkung zum einfachen und klaren Ausdruck.
Ebene Zeichnungen, wenn sie durchweg aus geraden
Linien bestehen, die sich überall rechtwinklig durchschneiden, erscheinen
fast nur eben. Kommen schiefe Durchschnitte und krumme Linien vor, so treten
die Linien leicht aus der Ebene heraus, wie z. B. die Figur 30 zeigt,
welche man ohne Mühe als ein gekrümmtes Blatt auffaßt.
Wenn eine solche Kontur, wie Fig. 30, eine bestimmte Form im Raume
angenommen hat, und man sieht dieselbe als Grenze einer Fläche, so
erscheint letztere, um es kurz zu sagen, möglichst flach, also wieder
mit einem Minimum der Abweichung vom Mittel der Tiefenempfindung15).
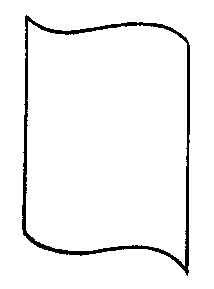
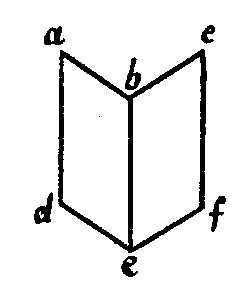
Die eigentümliche Wechselwirkung, sich schief in der Zeichnungsebene (beziehungsweise auf der Netzhaut) durchschneidender Linien, vermöge welcher sich dieselben gegenseitig aus der Zeichnungsebene (beziehungsweise aus der zur Visierlinie senkrechten Ebene) heraustreiben, habe ich zuerst bei Gelegenheit des vorher (s. o.) erwähnten Experimentes mit der monokularen Inversion des Kartenblattes beobachtet. Das Blatt Fig. 31, dessen gegen mich konvexe Kante be vertikal steht, legt sich, wenn es mir gelingt, be konkav zu sehen, wie ein aufgeschlagenes Buch auf den Tisch, so daß b ferner erscheint als e. Kennt man die Erscheinung einmal, so gelingt die Inversion fast bei jedem Objekt, und man kann dann immer mit der Formänderung (Umstülpung) zugleich jene merkwürdige Änderung der Orientierung (Stellung) des Objektes beobachten. Besonders überraschend gestaltet sich der Vorgang bei durchsichtigen Objekten. Es sei ab cd der Durchschnitt eines Glaswürfels auf einem Tisch tt, und O das Auge. Bei der monokularen Inversion rückt die Kante a nach a', b aber näher heran nach b', c nach c' und d nach d'. Der Würfel scheint nun auf der Kante c' schief auf dem Tisch t' t' zu stehen. Um die Zeichnung übersichtlicher zu gestalten, wurden die beiden Bilder nicht ineinander, sondern hintereinander dargestellt. Ein teilweise mit gefärbter Flüssigkeit gefülltes Trinkglas, an die Stelle des Würfels gesetzt, stellt sich natürlich samt seiner Flüssigkeitsoberfläche ebenfalls schief.
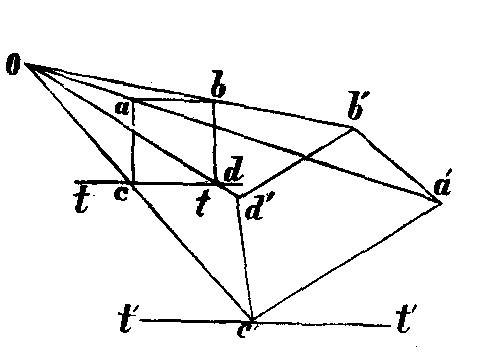
Dieselben Erscheinungen kann man bei genügender Aufmerksamkeit auch an jeder Linearzeichnung beobachten. Wenn man das Blatt mit der Figur 31 vertikal vor sich hinstellt und monokular betrachtet, so sieht man, wenn be konvex ist, b vortreten, wenn b e konkav ist, e vortreten, sich dem Beobachter nähern, und b zurückweichen. Loeb16) bemerkt, daß hierbei die Punkte a, e, in der Zeichnungsebene verbleiben. In der Tat werden hierdurch die Orientierungsänderungen verständlich. Zieht man die punktierten Linien (Fig. 32 a) und denkt sich die Figur, so weit sie außerhalb des punktierten Dreiecks liegt, weggelöscht, so bleibt uns das Bild einer hohlen oder erhabenen dreiseitigen Pyramide, welche mit der Basis in der Zeichnungsebene liegt. Die Inversion hat keine irgendwie rätselhafte Orientierungsänderung mehr zur Folge. Es scheint also, daß jeder monokular gesehene Punkt nach dem Minimum der Abweichungen vom Mittel der Tiefenempfindung, und das ganze gesehene Objekt nach dem Minimum der Entfernung von der Heringschen Kernfläche strebt, welches unter den Versuchsbedingungen erreichbar ist.
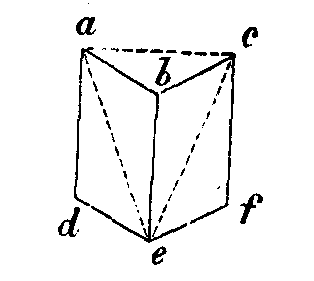
16) Loeb, a. a. O.
Wenn man die Deformationen beachtet, welche eine ebene geradlinige Figur bei monokularer räumlicher Auslegung erfährt, so kann man dieselben qualitativ darauf zurückführen, daß die Schenkel eines spitzen Winkels sich nach entgegengesetzten Seiten, jene eines stumpfen Winkels nach derselben Seite aus der Zeichnungsebene, der zur Visierlinie senkrechten Ebene, heraustreiben. Spitze Winkel vergrößern, stumpfe Winkel verkleinern sich hierbei. Alle Winkel streben dem rechten zu.
14.
Der letztere Satz legt die Beziehung der eben besprochenen Erscheinung
zur Zöllnerschen Pseudoskopie und den zahlreichen verwandten
Phänomenen nahe. Auch hier kommt alles auf scheinbare Vergrößerung
der spitzen und Verkleinerung der stumpfen Winkel hinaus, nur daß
die Zeichnungen in der Ebene gesehen werden. Sieht man dieselben aber monokular
räumlich, so verschwinden die Pseudoskopien, und es treten dann die
zuvor beschriebenen Erscheinungen auf. Obgleich nun diese Pseudoskopien
vielfach studiert worden sind, existiert zur Zeit doch keine allseitig
befriedigende Erklärung derselben. Mit so leichtfertigen Erklärungen,
wie etwa jener, daß wir gewohnt seien, vorzugsweise rechte Winkel
zu sehen, darf man natürlich nicht kommen, wenn die ganze Untersuchung
nicht verfahren oder vorzeitig abgebrochen werden soll. Wir sehen oft genug
schiefwinklige Objekte, dagegen ohne künstliche Veranstaltung niemals,
wie in dem obigen Experiment, einen ruhigen schiefen Flüssigkeitsspiegel.
Dennoch zieht das Auge, wie es scheint, den schiefen Flüssigkeitsspiegel
einem schiefwinkligen Körper vor.
Die elementare Macht, die sich in diesen Vorgängen
ausspricht, hat nach meiner Überzeugung ihre Wurzel in viel einfacheren
Gewohnheiten des Sehorgans, welche kaum erst im Kulturleben des Menschen
entstanden sind. Ich habe seiner Zeit versucht, die Erscheinungen durch
einen dem Farbenkontrast analogen Richtungskontrast zu erklären, ohne
zu einem befriedigenden Resultat zu gelangen. Neuere Untersuchungen von
Loeb17), Heymans18)
u. a., sowie Beobachtungen von Höfler19)
über Krümmungskontrast, sprechen nun doch sehr zugunsten einer
Kontrasttheorie. Auch hat, in letzter Zeit wenigstens, die Neigung für
eine rein physiologische Erklärung entschieden zugenommen20).
17) Loeb, Pflügers Archiv, 1895, S. 509.
18) Heymans, Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane, XIV, 101.
19) Höfler, Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane, XII,
l.
20) Witasek, Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane, XIX, l.
Auch das Prinzip der Sparsamkeit hat sich mir in bezug auf die Zöllnersche Pseudoskopie als unergiebig erwiesen. Etwas mehr Aussicht auf Erfolg schien das Prinzip der Wahrscheinlichkeit zu bieten. Wir denken uns die Netzhaut als Vollkugel und den Scheitel eines Winkels a im Raume fixiert. Die Ebenen, welche durch den Kreuzungspunkt des Auges und die Winkelschenkel hindurchgehend die letzteren auf die Netzhaut projizieren, schneiden auf dieser ein sphärisches Zweieck mit dem Winkel A aus, welcher den Winkel des monokularen Bildes vorstellt. Demselben beliebigen A können nun unzählige Werte von a zwischen 0° und 180° entsprechen, wie man erkennt, wenn man bedenkt, daß die Schenkel des objektiven Winkels jede beliebige Lage in den erwähnten projizierenden Ebenen annehmen können. Einem gesehenen Winkel A können also alle Werte des objektiven Winkels a entsprechen, welche sich ergeben, wenn man jede der Dreieckseiten b und c zwischen 0° und 180° variieren läßt. Hierbei ergibt sich nun wirklich, wenn man die Rechnung in einer bestimmten Weise anlegt, daß gesehenen spitzen Winkeln als wahrscheinlichstes Objekt ein größerer Winkel, gesehenen stumpfen Winkeln ein kleinerer Winkel entspricht. Ich war jedoch nicht in der Lage zu entscheiden, ob jene Fälle, welche man als geometrisch gleich mögliche anzusehen geneigt ist, auch als physiologisch gleich mögliche betrachtet werden dürfen, was wesentlich und wichtig wäre. Auch ist mir die ganze Betrachtung viel zu künstlich.
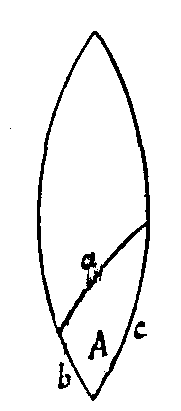
15.
Es kann hier nicht unerwähnt bleiben, daß A. Stöhr versucht hat, von ganz neuen Gesichtspunkten aus über die zuvor besprochenen Erscheinungen Aufklärung zu gewinnen. Den allgemeinen Erwägungen, von welchen sich Stöhr leiten ließ, muß ich volle Sympathie und Zustimmung entgegenbringen. Dagegen habe ich mir bis jetzt kein sicheres Urteil verschaffen können, ob Stöhrs Hypothesen eine tatsächlich nachweisbare Grundlage entspricht. Die vorausgesetzten Verhältnisse sind auch so kompliziert, daß es nicht leicht ist, darüber zu entscheiden, ohne das Gebiet selbst von neuem durchzuexperimentieren. Ich weiß also nicht, ob Stöhrs Ansichten überall zur Erklärung ausreichen werden. In einer älteren Arbeit21) wird angenommen, daß dem dioptrischen Bilde des Auges vor der Netzhaut ein katoptrisches Bild in der Netzhaut entspricht, welches nach deren Tiefe Relief hat. Die Tiefe in der Netzhaut wäre zugleich das Bestimmende für die empfundene Tiefe im Sehraum und das Regulierende der Akkommodation. In der Tat habe ich mich immer gefragt, wodurch denn der Sinn der Akkommodationsänderung bestimmt sei, da dieselbe durch die bloße Größe des Zerstreuungskreises nicht bestimmt sein kann, da ferner der Zusammenhang zwischen Konvergenz und Akkommodation nur ein loser ist, und da auch ein Auge allein sich akkommodiert. Anderseits stehen dieser Ansicht die zahlreichen Beobachtungen über die Wertlosigkeit der Akkommodation für die Tiefenempfindung entgegen. Die große Dicke der Netzhaut der Insektenaugen22) legt es wieder nahe, an eine Funktion derselben bei der Reliefwahrnehmung zu denken.
2l) Zur nativistischen Behandlung des Tiefensehens. Wien 1892.
22) Exner, Die Physiologie der facettierten Augen. Wien 1891, S. 188.
In zwei folgenden Arbeiten23) wird auf diese Ansicht weiter gebaut. Die zweite derselben bringt eine Schefflersche Ansicht in eine mehr physiologische Form. Die herrschende Ansicht, nach welcher die Bilder von Stellen, welche mehr oder weniger von korrespondierenden abweichen, zu einem einheitlichen Eindruck verschmelzen, findet Stöhr unbehaglich. "Wo ist der Weichenwächter, der den Wechsel nicht nur in außergewöhnlicher, sondern auch in zweckmäßiger Weise so stellt, daß jetzt ein ungewöhnliches Paar von Leitungsbahnen zwei Reize zur Vereinigung im Zentralorgan bringen kann?" Es wird angenommen, daß die Netzhäute beider Augen, von einem Streben nach Minimalisation des Lichtreizes beherrscht, nach Äqualisation ungleicher Bilder trachten. Die nervösen Elemente erregen den Ziliarmuskel und zwar nicht nur in ganz gleichmäßiger regelmäßiger Weise, sondern nach Bedürfnis auch sehr ungleichmäßig. Regelmäßige Kontraktion des Ziliarmuskels bringt eine größere Linsenwölbung und eine geringe Kontraktion der Netzhaut hervor. Nehmen hierbei die Netzhautelemente ihre Ortswerte mit, so erscheint dasselbe Netzhautbild vergrößert. So soll es nach Stöhr verständlich werden, daß die Panumschen proportionalen Kreissysteme (bis zum Radienverhältnis 4 : 5) durch Anpassung der beiden Augen aneinander mit identischen Netzhautstellen einfach und in mittlerer Größe gesehen werden. Daß die Verschmelzung der Kreissysteme nicht durch Unterdrückung des einen Bildes geschieht, weist Stöhr nach, indem er das eine Kreissystem aus roten, das andere aus alternierenden grünen Punkten darstellt, so daß in dem binokularen Sammelbild die roten zwischen den grünen Punkten erscheinen. Unregelmäßige Kontraktion des Ziliarmuskels soll nun eine mehrfache Wirkung hervorbringen: Einmal eine unregelmäßige Deformation der Linse mit mannigfaltiger Verschiebung der Spitzen der Diakaustik verschiedener Strahlenbündel, hierdurch Änderung des Reliefs des dioptrischen und katoptrischen Bildes und ferner eine mannigfaltige minimale Deformation der Netzhaut. Stöhr glaubt durch detaillierte Rechnungen die Möglichkeit seiner Auffassung darzutun und durch Untersuchung von Beobachtern mit aphakischen Augen die Tatsächlichkeit seiner Voraussetzungen nachzuweisen. Zu überraschenden Versuchen, z. B. stereoskopischer Knickung von Geraden hat ihn seine Theorie jedenfalls geführt, und sie verdient also schon deshalb Beachtung. So sehr mir aber seine Auffassung des Auges und seiner Teile als lebender Organismen sympathisch ist, habe ich mich doch noch nicht überzeugen können, daß seine Annahmen zur Erklärung komplizierterer Fälle des Raumsehens überall ausreichen24).
24) Seither ist noch erschienen: A. Stöhr, Grundfragen der psycho-physiologischen Optik, Leipzig u. Wien, 1904. — Die bezeichneten Fragen werden daselbst weiter diskutiert.
Der leichte Übergang vom pseudoskopischen Sehen ebener Figuren zum monokularen räumlichen Sehen derselben wird wohl über ersteres noch weitere Aufklärung verschaffen. Folgende Tatsachen bestärken diese Vermutung. Eine ebene Linearzeichnung, monokular betrachtet, erscheint gewöhnlich eben. Macht man aber die Winkel veränderlich und leitet die Bewegung ein, so streckt sich jede derartige Zeichnung sofort in die Tiefe. Man sieht dann gewöhnlich einen starren Körper in einer Drehung begriffen, wie ich dies bei einer früheren Gelegenheit27) beschrieben habe. Die bekannten Lissajousschen Schwingungsfiguren, welche bei Wechsel des Phasenunterschiedes auf einem gedrehten Zylinder zu liegen scheinen, bieten ein schönes Beispiel des betreffenden Vorganges.
17.
Es ist also keine Frage, daß uns das Sehen starrer Körper
mit den festen Abständen ihrer ausgezeichneten Punkte viel geläufiger
ist als das Aussondern der Tiefe, welches sich immer erst durch eine absichtliche
Analyse ergibt. Demnach können wir erwarten, daß überall,
wo eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, die vermöge
der kontinuierlichen Übergänge und des gemeinsamen Farben Charakters
zur Einheit verschmilzt, eine räumliche Veränderung zeigt, diese
mit Vorliebe als Bewegung eines starren Körpers gesehen wird. Ich
muß aber gestehen, daß mich diese Auffassung wenig befriedigt.
Vielmehr glaube ich, daß auch hier eine elementare Gewohnheit des
Sehorgans zugrunde liegt, welche nicht erst durch die bewußte individuelle
Erfahrung entstanden ist, sondern welche im Gegenteil schon das Auffassen
der Bewegungen starrer Körper erleichtert hat. Würden wir z.
B. annehmen, daß jede Verkleinerung der Querdimension einer optischen
Empfindungsmasse, welcher die Aufmerksamkeit zugewendet wird, eine entsprechende
Vergrößerung der Tiefendimensionen herbeizuführen strebt,
und umgekehrt, so wäre dieser Prozeß ganz analog demjenigen,
dessen schon oben gedacht (s. o.) und der mit der Erhaltung der Energie
verglichen wurde. Die berührte Ansicht ist entschieden viel
einfacher und zur Erklärung ebenfalls ausreichend. Man kann sich auch
leichter vorstellen, wie eine so elementare Gewohnheit erworben, wie sie
in der Organisation ihren Ausdruck finden, und wie die Stimmung für
dieselbe vererbt werden kann.
Als Gegenstück zu der Drehung starrer Körper,
welche uns das Sehorgan vorspiegelt, will ich hier noch eine andere Beobachtung
anführen. Wenn man ein Ei oder ein Ellipsoid mit matter gleichmäßiger
Oberfläche über den Tisch rollt, jedoch so, daß es sich
nicht um die Achse des Rotationskörpers dreht, sondern hüpfende
Bewegungen ausführt, so glaubt man bei binokularer Betrachtung einen
flüssigen Körper, einen großen schwingenden Tropfen, vor
sich zu haben. Noch auffallender ist die Erscheinung, wenn ein Ei, dessen
Längsachse horizontal liegt, um eine vertikale Achse in mäßig
rasche Rotation versetzt wird. Dieser Eindruck verschwindet sofort, wenn
auf der Oberfläche des Eies Flecken angebracht werden, deren Bewegung
man verfolgen kann. Man sieht dann den gedrehten starren Körper.
Die in diesem Kapitel gegebenen Erklärungen
sind von Vollständigkeit gewiß noch weit entfernt, doch glaube
ich, daß meine Ausführungen ein exakteres und eingehenderes
Studium der besprochenen Erscheinungen anregen und anbahnen können.