1.
Auch in bezug auf die Tonempfindungen müssen wir uns vorzugsweise auf die psychologische Analyse beschränken. Es kann hier ebenfalls nur der Anfang einer Untersuchung geboten werden.
2) Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung.
2.
H. Berg3) hat, um es kurz zu sagen, nach dem Vorgange Darwins versucht, die Musik aus dem Brunstgeheul der Affen herzuleiten. Man müßte verblendet sein, wenn man das Verdienstvolle und Aufklärende der Ausführungen Darwins und Bergs verkennen wollte. Auch heute noch kann die Musik sexuelle Saiten berühren, auch heute noch wird sie zur Liebeswerbung tatsächlich benutzt. Auf die Frage aber, worin das Angenehme der Musik liegt, gibt Berg keine befriedigende Antwort. Und da er musikalisch auf dem Helmholtzschen Standpunkt der Vermeidung der Schwebungen steht und annimmt, daß die am wenigsten unangenehm heulenden Männchen den Vorzug erhielten, so darf man sich vielleicht wundern, warum die klügsten dieser Tiere nicht lieber ganz schwiegen.
3) H. Berg, Die Lust an der Musik. Berlin 1879.
Wenn die Beziehung irgend einer biologischen Erscheinung zur Arterhaltung aufgedeckt und dieselbe phylogenetisch hergeleitet wird, so ist damit viel getan. Keineswegs darf man aber glauben, daß auch schon alle die Erscheinung betreffenden Probleme gelöst seien. Niemand wird wohl das Angenehme der spezifischen Wollustempfindung dadurch erklären wollen, daß er deren Zusammenhang mit der Arterhaltung nachweist. Viel eher wird man zugeben, daß die Art erhalten wird, weil die Wollustempfindung angenehm ist. Mag die Musik immerhin unsern Organismus an die Liebeswerbungen der Urahnen erinnern; wenn sie zur Werbung benutzt wurde, mußte sie schon positiv Angenehmes enthalten, welches gegenwärtig allerdings durch jene Erinnerung verstärkt werden kann. Wenn der Geruch einer verlöschenden Öllampe mich fast jedesmal in angenehmer Weise an die Laterna magica erinnert, die ich als Kind bewunderte, so ist dies ein ähnlicher Fall aus dem individuellen Leben. Doch riecht darum die Lampe an sich nicht weniger abscheulich. Und wer durch Rosenduft an ein angenehmes Erlebnis erinnert wird, glaubt darum nicht, daß der Rosenduft nicht schon vorher angenehm gewesen sei. Derselbe hat durch die Assoziation nur gewonnen4). Kann nun die erwähnte Auffassung schon das Angenehme der Musik überhaupt nicht genügend erklären, so vermag sie zur Beantwortung von Spezialfragen, wie z. B., warum in einem gegebenen Fall eine Quarte einer Quinte vorgezogen wird, wohl noch weniger beizutragen.
4) Auf die Bedeutung der Assoziation für die Ästhetik hat namentlich Fechner hingewiesen.
3.
Man würde überhaupt die Tonempfindungen etwas einseitig beurteilen, wenn man nur das Gebiet der Sprache und Musik berücksichtigen wollte. Die Tonempfindungen vermitteln nicht allein die Mitteilung, die Äußerung von Lust und Schmerz, die Unterscheidung der Stimmen von Männern, Frauen, Kindern. Sie bieten nicht allein Merkzeichen der Anstrengung, der Leidenschaft des Sprechenden oder Rufenden. Wir unterscheiden durch dieselben auch große und kleine schallende Körper, die Tritte großer und kleiner Tiere. Gerade die höchsten Töne, welche das Stimmorgan des Menschen nicht selbst erzeugt, sind für die Beurteilung der Richtung, aus welcher der Schall kommt, mutmaßlich sehr wichtig5). Ja diese letztern Funktionen der Tonempfindungen sind wahrscheinlich in der Tierwelt älter als diejenigen, welche erst im geselligen Leben der Tiere eine Rolle spielen. Wie man sich durch Neigung eines Kartonblattes vor dem Ohr überzeugen kann, werden nur jene Geräusche, welche sehr hohe Töne enthalten, das Sausen und Zischen einer Gasflamme, eines Dampfkessels oder Wasserfalles, je nach der Lage des Kartonblattes durch Reflexion modifiziert, während tiefe Töne ganz unbeeinflußt bleiben. Die beiden Ohrmuscheln können also nur durch ihre Wirkung auf hohe Töne als Richtungszeiger verwendet werden6).
6) Ich hatte Gelegenheit zu beobachten, wie zahme Hamster, welche gegen tiefe und laute Geräusche ganz unempfindlich waren, jedesmal plötzlich erschreckt und ungestüm in ihr Versteck fuhren, sobald man durch Reiben von Stroh oder Zerknittern von Papier ein hohes Geräusch hervorbrachte. Auch einige Monate alte Kinder sind für solche Geräusche sehr empfindlich.
Den wesentlichen Fortschritt in bezug auf die Analyse der Gehörsempfindungen, welcher durch Helmholtz7) in Fortführung der gewichtigen Vorarbeiten8) von Sauveur, Rameau, R. Smith, Young, Ohm u. a. bewirkt worden ist, wird jedermann freudig anerkennen. Wir erkennen mit Helmholtz das Geräusch als eine Kombination von Tönen, deren Zahl, Höhe und Intensität mit der Zeit variiert. In dem Klange hören wir mit dem Grundton n im allgemeinen noch die Obertöne oder Partialtöne 2n, 3n, 4n usw., deren jeder einfachen pendelförmigen Schwingungen entspricht. Werden zwei Klänge, deren Grundtönen die Schwingungszahlen n und m entsprechen, melodisch und harmonisch verbunden, so kann bei bestimmten Verhältnissen9) von n und m teilweise Koinzidenz der Partialtöne eintreten, wodurch im ersteren Falle die Verwandtschaft der Klänge bemerklich, im zweiten Falle eine Verminderung der Schwebungen herbeigeführt wird. Alles dies wird nicht zu bestreiten sein, wenn es auch nicht als erschöpfend anerkannt wird.
7) Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen, I. Aufl., Brannschweig
1863.
8) Vgl. "Zur Geschichte der Akustik" in ,,Populärwissenschaftliche
Vorlesungen, S. 48.
5.
Nach einem besonderen Gehörorgan für Geräusch zu suchen, scheint für jeden, der mit Helmholtz annimmt, daß alle Geräusche sich in länger oder kürzer anhaltende Tonempfindungen auflösen lassen, vorläufig überflüssig. Von dieser Inkonsequenz ist Helmholtz auch bald wieder zurückgekommen. Mit der Frage nach der Beziehung des Geräusches (insbesondere des Knalles) zum Ton habe ich mich vor langer Zeit (Winter 1872/73) beschäftigt und gefunden, daß sich alle Übergänge zwischen beiden aufweisen lassen. Ein Ton von 128 ganzen Schwingungen, den man durch den kleinen Ausschnitt einer großen, langsam rotierenden Scheibe hört, schrumpft zu einem kurzen trockenen Schlag (oder schwachen Knall) von sehr undeutlicher Tonhöhe zusammen, wenn seine Dauer auf 2—3 Schwingungen reduziert wird, während bei 4—5 Schwingungen die Höhe noch ganz deutlich ist. Anderseits bemerkt man an einem Knall, selbst wenn derselbe von einer aperiodischen Luftbewegung herrührt (Funkenwelle, explodierende Knallgasblase), bei genügender Aufmerksamkeit eine Tonhöhe, wenngleich keine sehr bestimmte. Man überzeugt sich auch leicht, daß an einem von der Dämpfung befreiten Klavier durch große explodierende Knallgasblasen vorzugsweise die tiefen, durch kleine die hohen Saiten zum Mitschwingen erregt werden. Hierdurch scheint es mir nachgewiesen, daß dasselbe Organ die Ton- und die Geräuschempfindung vermitteln kann. Man wird sich vorzustellen haben, daß eine schwächere, kurz dauernde aperiodische Luftbewegung alle, aber vorzugsweise die kleinen, leichter erregbaren, eine stärkere, längere anhaltende auch die größeren trägeren Endorgane erregt, welche dann bei ihrer geringeren Dämpfung, länger ausschwingend, sich bemerklich machen, und daß selbst bei verhältnismäßig schwachen periodischen Luftbewegungen durch Häufung der Effekte an einem bestimmten Gliede der Reihe der Endorgane die Reizung hervortritt10). Qualitativ ist die Empfindung, welche ein tiefer oder hoher Knall erregt, dieselbe, nur intensiver und von kürzerer Dauer, als diejenige, welche das Niederdrücken einer großen Anzahl benachbarter Klaviertasten in tiefer oder hoher Lage erregt. Auch fallen bei der einmaligen Reizung durch Knall die an die periodische intermittierende Reizung gebundenen Schwebungen weg.
Helmholtz' Arbeit, welche bei ihrem Auftreten zunächst allgemeiner
Bewunderung begegnete, erfuhr in späteren Jahren vielfache kritische
Angriffe, und es scheint fast, als ob die anfängliche Überschätzung
dem Gegenteil gewichen wäre. Physiker, Physiologen und Psychologen
hatten ja durch beinahe vier Dezennien Zeit, die drei Seiten, welche diese
Theorie darbietet, zu mustern, und es wäre wohl ein Wunder gewesen,
wenn sie die schwachen Stellen nicht erspäht hätten. Ohne auf
Vollständigkeit Anspruch zu machen, wollen wir nun die hauptsächlichsten
kritischen Bedenken in Augenschein nehmen, zunächst die von physikalischer
und physiologischer Seite vorgebrachten unter einem, dann jene der Psychologen.
Helmholtz hat, von psychologischen und physikalischen
Gesichtspunkten geleitet, angenommen, daß das innere Ohr aus einem
System von Resonatoren besteht, welches die Glieder der Fourierschen
Reihe, die der dargebotenen Schwingungsform entspricht, als Teiltöne
heraushört. Nach dieser Auffassung kann auch das Phasenverhältnis
der Teilschwingungen auf die Empfindung keinen Einfluß üben.
Dem entgegen versuchte der hochverdiente Akustiker König11)
nachzuweisen, daß durch die bloße Phasenverschiebung der pendelförmigen
Teilschwingungen der sinnliche Eindruck (die Klangfarbe) geändert
werde. Aber L. Hermann12)
konnte zeigen, daß bei Umkehrung des Bewegungssinnes am Phonographen
keine Änderung der Klangfarbe sich ergibt. Nach Hermann erzeugen
auch die einzelnen sinusförmigen Streifen der Königschen
Wellensirene keine einfachen Töne, und Königs Schlüsse
gründeten sich also auf eine nicht zutreffende Voraussetzung13).
Diese Schwierigkeit kann demnach als beseitigt gelten.
11) R. König, Quelques experiénces d'acoustique. Paris 1882.
12) L. Hermann, Zur Lehre von der Klangwahrnehmung. Pflügers Archiv, Bd. 56 (1894), S. 467.
Die physikalische Resonanztheorie scheint, wenigstens in der ursprünglichen Form, nicht haltbar; Hermann16) glaubt sie aber durch eine physiologische Resonanztheorie ersetzen zu können. Auf diese, sowie auf die neue physikalische Hörtheorie von Ewald kommen wir noch zurück.
16) Hermann, Pflüger's Archiv, Bd. 56, S. 493.
7.
Wir besprechen nun die Einwendungen, welche vorzugsweise von psychologischen Gesichtspunkten ausgehen. Ziemlich allgemein hat man das positive Moment bei Erklärung der Konsonanz vermißt, indem man sich mit dem bloßen Mangel an Schwebungen als zureichendem Merkmal der Harmonie nicht zufrieden geben wollte. Auch A. v. Oettingen17) vermißt die Angabe des für jedes Intervall charakteristischen positiven Elementes (S. 30) und will den Wert eines Intervalles nicht von der physikalischen Zufälligkeit des Gehaltes der Klänge an Obertönen abhängig machen. Er glaubt das positive Element in der Erinnerung (S. 40, 47) an den gemeinsamen Grundton (die Tonica) zu finden, als dessen Partialtöne die Klänge des Intervalles oft aufgetreten sind, oder in der Erinnerung an den gemeinsamen Oberton (die Phonica), welcher beiden zukommt. In bezug auf den negativen Teil der Kritik muß ich v. Oettingen vollkommen beistimmen. Die ,,Erinnerung" deckt aber das Bedürfnis der Theorie nicht, denn Konsonanz und Dissonanz sind nicht Sache der Vorstellung, sondern der Empfindung. Physiologisch halte ich also v. Oettingens Auffassung für nicht zutreffend. In v. Oettingens Aufstellung des Prinzipes der Dualität aber (der tonischen und phonischen Verwandtschaft der Klänge), sowie in seiner Auffassung der Dissonanz als eines mehrdeutigen Klanges (S. 244) scheinen mir wertvolle positive Leistungen zu liegen18).
17) A. v. Oettingen, Harmoniesystem in dualer Entwicklung. Dorpat 1866.
Sehr eingehend hat Stumpf in verschiedenen Schriften die Helmholtzsche Lehre kritisiert19). Er beanstandet zunächst die zwei verschiedenen Definitionen, durch Wegfall der Schwebungen und durch Koinzidenz der Partialtöne, die Helmholtz von der Konsonanz gibt. Die erstere sei bei melodischer Folge, die letztere bei harmonischer Verbindung nicht anwendbar und nicht charakteristisch. Ein nach Art der Schwebungen intermittierender reiner Dreiklang ist keine Dissonanz. Anderseits lassen sich Beispiele von Zusammenklang weit abliegender Töne geben, bei welchen die Schwebungen unmerklich werden, und die dennoch stark dissonieren. Verteilt man zwei Stimmgabeltöne auf beide Ohren, so treten die Schwebungen jedenfalls sehr zurück, ohne daß der Unterschied zwischen Konsonanz und Dissonanz geringer würde. Auch subjektiv gehörte Töne, etwa des Ohrenklingens, kann man als Dissonanzen empfinden, ohne natürlich Schwebungen zu hören. Endlich erweisen sich bloß vorgestellte Töne als konsonant und dissonant, ohne daß hierbei die Vorstellung der Schwebungen eine wesentliche Rolle spielen würde. Die Koinzidenz der Partialtöne endlich fällt weg, wo keine Obertöne vorhanden sind, ohne daß deshalb der Unterschied zwischen Dissonanz und Konsonanz verschwinden würde. Von den Ausführungen Stumpfs gegen die Erklärung der Konsonanz durch unbewußtes Zählen, welche wohl nur mehr wenige Anhänger finden wird, wollen wir absehen20). Ebenso wird man gern zugeben, daß die Annehmlichkeit keine hinreichend charakteristische Eigenschaft der Konsonanz ist. Dieselbe kann unter Umständen. ebensowohl der Dissonanz zukommen.
20) Solche wurden versucht von Leibniz, Euler, in neuerer Zeit von Oppel, dann von Lipps (Psychologische Studien 1885) und endlich in umfangreichen Schriften von A. J. Polak (Über Zeiteinheit in bezug auf Konsonanz, Harmonie und Tonalität,. Leipzig 1900, — Über Tonrhythmik und Stimmführung, Leipzig 1902, — Die Harmonisierung indischer, türkischer und japanischer Melodien, Leipzig 1905).
22) C. Stumpf, Beiträge zur Akustik, Heft l, S. 50.
9.
Ich selbst habe schon in einer 186323) erschienenen Abhandlung und auch später24) einige kritische Bemerkungen über die Helmholtzsche Theorie gemacht, und 1866 in einer kurz vor der Oettingenschen erschienenen kleinen Schrift25) sehr bestimmt einige Forderungen bezeichnet, welchen eine vollständigere Theorie zu genügen hätte. Weitere Ausführungen habe ich in der ersten Auflage dieser Schrift (1886) gegeben.
23) Mach, Zur Theorie des Gehörorgans. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1863.
Gehen wir von der Vorstellung aus, daß eine
Reihe von physikalisch oder physiologisch abgestimmten Endorganen existiert,
deren Glieder bei steigender Schwingungszahl nacheinander im Maximum ansprechen,
und schreiben wir jedem Endorgan seine besondere (spezifische) Energie
zu. Dann gibt es so viele spezifische Energien als Endorgane und ebensoviele
für uns durch das Gehör unterscheidbare Schwingungszahlen.
Wir unterscheiden aber nicht bloß die Töne,
wir ordnen sie auch in eine Reihe. Wir erkennen von drei Tönen verschiedener
Höhe den mittleren ohne weiteres als solchen. Wir empfinden unmittelbar,
welche Schwingungszahlen einander näher, welche ferner liegen. Das
ließe sich für naheliegende Töne noch leidlich erklären.
Denn wenn wir die Schwingungsweiten, die einem bestimmten Ton zukommen,
symbolisch durch die Ordinaten der Kurve abc, Figur 35, darstellen,
und diese Kurve uns allmählich im Sinne des Pfeiles verschoben denken,
so werden naheliegenden Tönen, weil stets mehrere Organe zugleich
ansprechen, auch immer schwache gemeinsame Reizungen zukommen. Allein auch
ferner liegende Töne haben eine gewisse Ähnlichkeit, und auch
an dem höchsten und tiefsten Ton erkennen wir noch eine solche. Nach
dem uns leitenden Forschungsgrundsatze müssen wir also in allen Tonempfindungen
gemeinsame Bestandteile annehmen. Es kann also nicht so viele spezifische
Energien geben, als es unterscheidbare Töne gibt. Für das Verständnis
der Tatsachen, die wir hier zunächst im Auge haben, genügt die
Annahme von nur zwei Energien, die durch verschiedene Schwingungszahlen
in verschiedenem Verhältnis ausgelöst werden. Eine weitere Zusammensetzung
der Tonempfindungen ist aber durch diese Tatsachen nicht ausgeschlossen
und wird durch die später zu besprechenden Erscheinungen sehr wahrscheinlich.
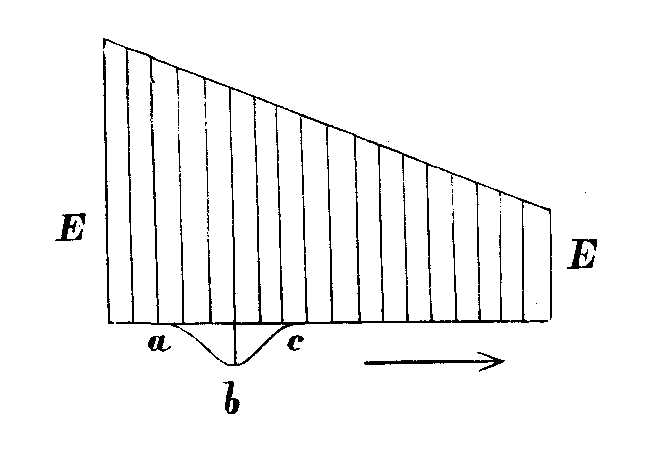
Die aufmerksame psychologische Analyse der Tonreihe führt unmittelbar zu dieser Ansicht. Aber auch wenn man für jedes Endorgan zunächst eine besondere Energie annimmt, und bedenkt, daß diese Energien einander ähnlich sind, also gemeinsame Bestandteile enthalten müssen, gelangt man auf denselben Standpunkt. Nehmen wir also an, nur um ein bestimmtes Bild vor uns zu haben, daß bei dem Übergang von den kleinsten zu den größten Schwingungszahlen die Tonempfindung ähnlich variiert wie die Farbenempfindung, wenn man vom reinen Rot, etwa durch allmähliche Zumischung von Gelb, zum reinen Gelb übergeht. Hierbei können wir die Vorstellung, daß für jede unterscheidbare Schwingungszahl ein besonderes Endorgan vorhanden ist, vollkommen aufrecht erhalten, nur werden durch verschiedene Organe nicht ganz verschiedene Energien, sondern immer dieselben zwei in verschiedenem Verhältnis ausgelöst26).
Wie kommt es nun, daß so viele gleichzeitig erklingende Töne
unterschieden werden, und nicht zu einer Empfindung verschmelzen, daß
zwei ungleich hohe Töne nicht zu einem Mischton von mittlerer Höhe
zusammenfließen? Dadurch, daß dies tatsächlich nicht geschieht,
ist die Ansicht, die wir uns zu bilden haben, weiter bestimmt. Wahrscheinlich
verhält es sich ganz ähnlich, wie bei einer Reihe von Mischfarben
von Rot und Gelb, welche an verschiedenen Stellen des Raumes auftreten,
die ebenfalls unterschieden werden und nicht zu einem Eindruck zusammenfließen.
In der Tat stellt sich eine ähnliche Empfindung ein, wenn man von
der Beachtung eines Tones übergeht zur Beachtung eines anderen, wie
beim Wandern eines fixierten Punktes im Sehfeld. Die Tonreihe befindet
sich in einem Analogon des Raumes, in einem beiderseits begrenzten Raum
von einer Dimension, der auch keine Symmetrie darbietet, wie etwa eine
Gerade, die von rechts nach links senkrecht zur Medianebene verläuft.
Vielmehr ist derselbe analog einer vertikalen Geraden, oder einer Geraden,
welche in der Medianebene von vorn nach hinten verläuft. Während
außerdem die Farben nicht an die Raumpunkte gebunden sind, sondern
sich im Raum bewegen können, weshalb wir die Raumempfindungen so leicht
von den Farbenempfindungen trennen, verhält es sich in Bezug auf die
Tonempfindung anders. Eine bestimmte Tonempfindung kann nur an einer bestimmten
Stelle des besagten eindimensionalen Raumes vorkommen, die jedesmal fixiert
werden muß, wenn die betreffende Tonempfindung klar hervortreten
soll. Man kann sich nun vorstellen, daß verschiedene Tonempfindungen
in verschiedenen Teilen der Tonsinnsubstanz auftreten, oder daß neben
den beiden Energien, deren Verhältnis die Färbung der hohen und
tiefen Töne bedingt, noch eine dritte, einer Innervation ähnliche
besteht, welche beim Fixieren der Töne auftritt. Auch beides zugleich
könnte stattfinden. Zur Zeit dürfte es weder möglich noch
schon notwendig sein, hierüber zu entscheiden.
Daß das Gebiet der Tonempfindungen eine Analogie
zum Raum darbietet, und zwar zu einem Raum, der keine Symmetrie aufweist,
drückt sich schon unbewußt in der Sprache aus. Man spricht von
hohen und tiefen Tönen, nicht von rechten und linken, wiewohl unsere
Musikinstrumente letztere Bezeichnung sehr nahe legen.
11.
In einer meiner ersten Arbeiten27) habe ich die Ansicht vertreten, daß das Fixieren der Töne mit der veränderlichen Spannung des Tensor tympani zusammenhänge. Diese Ansicht kann ich meinen eigenen Beobachtungen und Experimenten gegenüber nicht aufrecht erhalten. Die Raumanalogie fällt hiermit jedoch nicht, sondern es ist nur das betreffende physiologische Element erst aufzufinden. Die Annahme, daß die Vorgänge im Kehlkopf (beim Singen) zur Bildung der Tonreihe beitragen, habe ich in der Arbeit von 1863 ebenfalls berührt, aber nicht haltbar gefunden. Das Singen ist zu äußerlich und zufällig mit dem Hören verbunden. Ich kann Töne weit über die Grenzen meiner Stimme hinaus hören und mir vorstellen. Wenn ich eine Orchesteraufführung mit allen Stimmen höre, oder wenn mir dieselbe als Halluzination entgegentritt, so kann ich mir unmöglich denken, daß mir das Verständnis des ganzen Stimmengewebes durch meinen einen Kehlkopf, der noch dazu gar kein geübter Sänger ist, vermittelt wird. Ich halte die Empfindungen, die man beim Hören von Musik gelegentlich zweifellos im Kehlkopf bemerkt, für nebensächlich, so wie ich mir in meiner musikalisch geübteren Zeit rasch zu jedem gehörten Klavier- oder Orgelstück nebenbei die gegriffenen Tasten vorstellte. Wenn ich mir Musik vorstelle, höre ich immer deutlich die Töne. Aus den die Musikaufführungen begleitenden motorischen Empfindungen allein wird keine Musik, so wenig der Taube, der die Bewegungen der Spieler im Orchester sieht, Musik hört. Ich kann also in diesem Punkte Strickers Ansicht nicht zustimmen. (Vergl. Stricker, Du langage et de la musique. Paris 1885.)
12.
Die Analogie zwischen dem Fixieren von Raumpunkten und dem Fixieren von Tönen habe ich wiederholt durch Experimente erläutert, die ich hier nochmals anführen will. Dieselbe Kombination von zwei Tönen klingt verschieden, je nachdem man den einen oder den anderen beachtet. Die Kombinationen 1 und 2 haben einen merklich verschiedenen Charakter, ja nachdem man den obern oder untern Ton fixiert. Wer die Aufmerksamkeit nicht willkürlich zu leiten vermag, helfe sich dadurch, daß er den einen Ton später eintreten läßt (3, 4). Dieser zieht dann die Aufmerksamkeit auf sich. Bei einiger Übung gelingt es, eine Harmonie (wie 5) in ihre Bestandteile aufzulösen, und diese (etwa wie bei 6) einzeln herauszuhören. Diese und die folgenden Experimente werden der anhaltenden Töne wegen besser und überzeugender mit der Physharmonika, als mit dem Klavier ausgeführt.
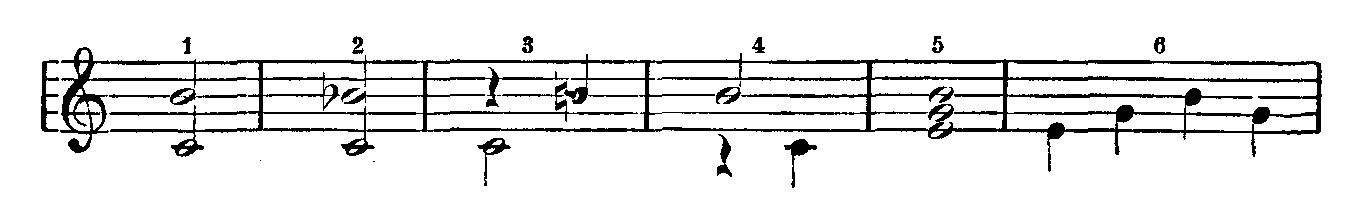

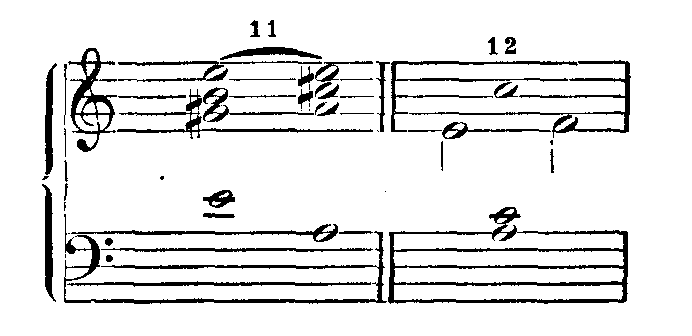
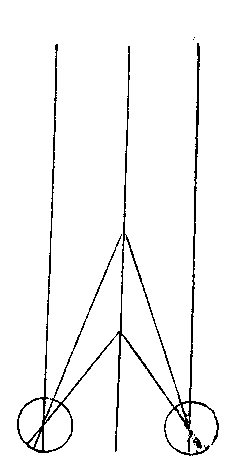
28) Vgl. meine "Einleitung in die Helmholtzsche Musiktheorie", S. 29.
29) Vgl. meine "Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen", S.
58.
13.
Nach der bisher gewonnenen Ansicht bleibt eine in dem folgenden zu betrachtende
wichtige Tatsache unverständlich, deren Erklärung aber von einer
vollständigeren Theorie unbedingt gefordert werden muß. Wenn
zwei Tonfolgen von zwei verschiedenen Tönen ausgehen und nach denselben
Schwingungszahlenverhältnissen fortschreiten, so erkennen wir in beiden
dieselbe Melodie ebenso unmittelbar durch die Empfindung, als wir an zwei
geometrisch ähnlichen, ähnlich liegenden Gebilden die gleiche
Gestalt erkennen. Gleiche Melodien in verschiedener Lage können als
Tongebilde von gleicher Tongestalt oder als ähnliche Tongebilde bezeichnet
werden. Man kann sich überzeugen, daß dieses Erkennen nicht
an die Verwendung geläufiger musikalischer Intervalle oder oft verwendeter
einfacherer Schwingungszahlenverhältnisse gebunden ist. Wenn man an
einer Violine oder überhaupt an einem mehrsaitigen Instrument, die
einzelnen leeren Saiten in beliebige unharmonische Stimmung bringt, dann
auf dem Griffbrett ein ganz beliebig in komplizierten Verhältnissen
geteiltes Papier befestigt, so kann man dieselben Teilungspunkte in beliebiger
Folge, erst auf der einen, dann auf den anderen Saiten greifen, oder schleifend
verbinden. Obgleich nun das Gehörte gar keinen musikalischen Sinn
hat, erkennt man auf jeder Saite dieselbe Melodie wieder. Das Experiment
würde sich nicht überzeugender gestalten, wenn man die Teilung
in irrationalen Verhältnissen vornehmen wollte. Dies gelingt ja in
Wirklichkeit nur annähernd. Der Musiker könnte immer noch behaupten,
er höre den bekannten musikalischen Intervallen nahe liegende oder
zwischen denselben liegende. Nicht abgerichtete Singvögel bedienen
sich nur ausnahmsweise der musikalischen Intervalle.
Schon bei einer Folge von nur zwei Tönen wird
die Gleichheit des Schwingungszahlenverhältnisses unmittelbar erkannt,
die Tonfolgen c—f, d—g, e—a usw., welche alle dasselbe Schwingungszahlenverhältnis
(3 : 4) darbieten, werden alle unmittelbar als gleiche Intervalle,
als Quarten erkannt. Dies ist die Tatsache in ihrer einfachsten Form. Das
Merken und Wiedererkennen der Intervalle ist das Erste, was sich der angehende
Musiker aneignen muß, wenn er mit seinem Gebiet vertraut werden will.
E. Kulke hat in einer kleinen, sehr lesenswerten
Schrift30) eine hierauf bezügliche
Mitteilung über die originelle Unterrichtsmethode von P. Cornelius
gemacht, die ich hier nach Kulkes mündlicher Mitteilung noch
ergänzen will. Um die Intervalle leicht zu erkennen, ist es nach Cornelius
zweckmäßig, sich einzelne Tonstücke, Volkslieder usw. zu
merken, welche mit diesen Intervallen beginnen. Die Tannhäuser-Ouvertüre
beginnt z. B. mit einer Quart. Höre ich eine Quarte, so bemerke ich
sofort, daß die Tonfolge der Beginn der Tannhäuser - Ouvertüre
sein könnte, und erkenne daran das Intervall. Ebenso kann die Fidelio
- Ouvertüre No. 1 als Repräsentant der Terz verwendet werden,
usw. Dieses vortreffliche Mittel, welches ich bei akustischen Demonstrationen
erprobt und sehr wirksam gefunden habe, ist anscheinend eine Komplikation.
Man könnte meinen, es müßte leichter sein, ein Intervall,
als eine Melodie zu merken. Doch bietet eine Melodie der Erinnerung mehr
Hilfen, so wie man ein individuelles Gesicht leichter merkt und mit einem
Namen verknüpft, als einen bestimmten Winkel oder eine Nase. Jeder
Mensch merkt sich Gesichter und verknüpft sie mit Namen; Leonardo
da Vinci hat aber die Nasen in ein System gebracht
30) E. Kulke, Über die Umbildung der Melodie. Ein Beitrag zur Entwicklungslehre. Prag (Calve) 1884.
14.
So wie jedes Intervall in der Tonfolge in charakteristischer Weise sich
bemerklich macht, ebenso verhält es sich in der harmonischen Verbindung.
Jede Terz, jede Quart, jeder Molldreiklang oder Durdreiklang hat seine
eigentümliche Färbung, an welcher er unabhängig von der
Höhe des Grundtons und unabhängig von der Zahl der Schwebungen,
welche ja mit dieser Höhe rasch zunimmt, erkannt wird.
Eine Stimmgabel, die man vor ein Ohr hält,
hört man fast nur mit diesem Ohr. Bringt man zwei etwas gegen einander
verstimmte, stoßende Stimmgabeln vor dasselbe Ohr, so sind die Stöße
sehr deutlich. Stellt man aber die eine Gabel vor das eine, die andere
vor das andere Ohr, so werden die Stöße sehr schwach. Zwei in
einem harmonischen Intervall stehende Gabeln klingen stets etwas rauher
vor einem Ohr. Der Charakter der Harmonie bleibt aber auch bewahrt, wenn
man vor je ein Ohr eine Gabel stellt31).
Auch die Disharmonie bleibt bei diesem Experiment sehr deutlich. Harmonie
und Disharmonie sind jedenfalls nicht durch die Schwebungen allein bestimmt.
Sowohl bei der melodischen als bei der harmonischen Verbindung zeichnen
sich die Töne, welche in einfachen Schwingungszahlenverhältnissen
stehen, 1) durch Gefälligkeit und 2) durch eine für jenes Verhältnis
charakteristische Empfindung aus. Was die Gefälligkeit betrifft, so
kann nicht in Abrede gestellt werden, daß dieselbe teilweise durch
das Zusammenfallen der Partialtöne und bei harmonischer Verbindung
auch durch das hiermit verbundene Zurücktreten der Schwebungen bei
bestimmten Schwingungszahlenverhältnissen aufgeklärt ist. Der
unbefangene Musikerfahrene ist aber nicht ganz befriedigt. Ihn stört
die zu bedeutende Rolle, welche der zufälligen Klangfarbe eingeräumt
wird, und er merkt, daß die Töne noch in einer positiven Kontrastbeziehung
stehen, wie die Farben, nur daß bei Farben keine so genauen gefälligen
Verhältnisse angegeben werden können.
Die Bemerkung, daß wirklich eine Art Kontrast
unter den Tönen besteht, drängt sich beinahe von selbst auf.
Ein konstanter glatter Ton ist etwas sehr Unerfreuliches und Farbloses,
wie eine gleichmäßige Farbe, in welche sich unsere ganze Umgebung
hüllt. Erst ein zweiter Ton, eine zweite Farbe wirkt belebend. Läßt
man einen Ton, wie beim Experimentieren mit der Sirene, langsam in die
Höhe schleifen, so geht ebenfalls aller Kontrast verloren. Derselbe
besteht hingegen zwischen weiter abstehenden Tönen, und nicht nur
zwischen den sich unmittelbar folgenden, wie das nebenstehende Beispiel
erläutern mag. Der Gang 2 klingt ganz anders nach 1 als allein, 3
klingt anders als 2, und auch 5 anders als 4 unmittelbar nach 3.

16.
Wenden wir uns nun zu dem zweiten Punkt, der charakteristischen Empfindung,
welche jedem Intervall entspricht, und fragen wir, ob dieselbe nach der
bisherigen Theorie erklärt werden kann. Wenn ein Grundton n
mit seiner Terz m melodisch oder harmonisch verbunden wird, so fällt
der 5. Partialton des ersten Klanges (5n) mit dem vierten des zweiten
Klanges (4m) zusammen. Dies ist das Gemeinsame, was nach der Helmholtzschen
Theorie allen Terzverbindungen zukommt. Kombiniere ich die Klänge
C
und E oder F und A und stelle in dem folgenden Schema
ihre Partialtöne dar, so koinzidieren in der Tat in dem einen Fall
die mit ![]() , in dem andern
die mit
, in dem andern
die mit ![]() bezeichneten Partialtöne, in beiden Fällen der fünfte Partialton
des tieferen mit dem vierten Partialton des höheren Klanges. Dieses
Gemeinsame besteht aber nur für den physikalisch analysierenden Verstand,
und hat mit der Empfindung nichts zu schaffen. Für die Empfindung
koinzidieren in dem ersten Fall die ?, in dem zweiten die ?, also ganz
verschiedene Töne. Gerade dann, wenn wir für jede unterscheidbare
Schwingungszahl eine zugehörige spezifische Energie annehmen, müssen
wir fragen, wo bleibt der jeder Terzverbindung gemeinsame Empfindungsbestandteil?
bezeichneten Partialtöne, in beiden Fällen der fünfte Partialton
des tieferen mit dem vierten Partialton des höheren Klanges. Dieses
Gemeinsame besteht aber nur für den physikalisch analysierenden Verstand,
und hat mit der Empfindung nichts zu schaffen. Für die Empfindung
koinzidieren in dem ersten Fall die ?, in dem zweiten die ?, also ganz
verschiedene Töne. Gerade dann, wenn wir für jede unterscheidbare
Schwingungszahl eine zugehörige spezifische Energie annehmen, müssen
wir fragen, wo bleibt der jeder Terzverbindung gemeinsame Empfindungsbestandteil?
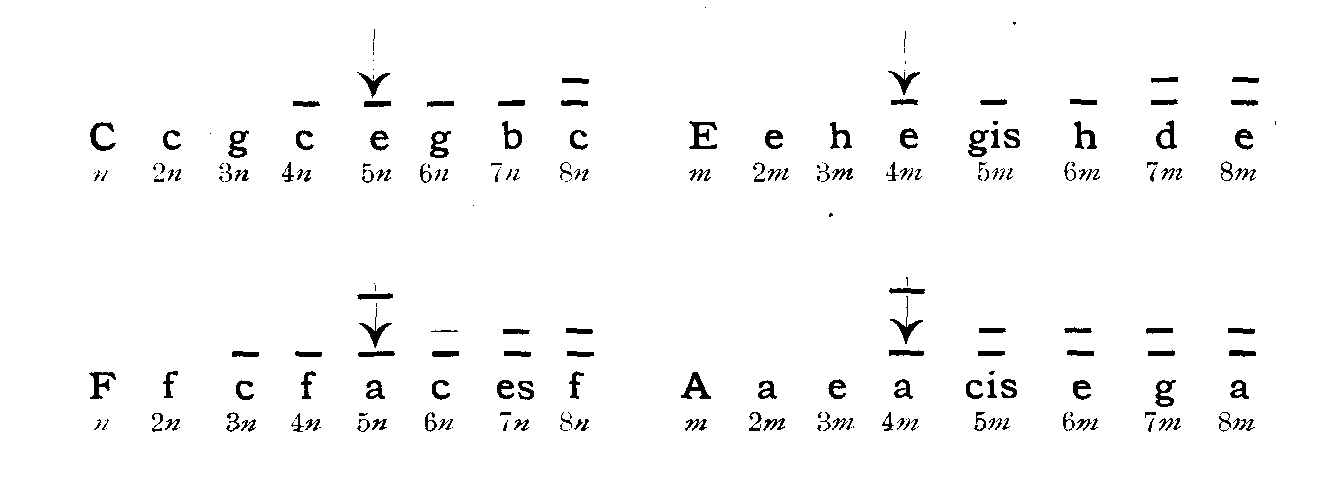
32) Euler, Tentamen novae theoriae musicae. Petropoli 1739, S. 36.
Bis hierher habe ich meine Ausführungen mit der Überzeugung
vorgebracht, daß ich nicht nötig haben werde, einen wesentlichen
Schritt zurück zu tun. Dieses Gefühl begleitet mich nicht in
gleichem Maße bei der Entwicklung der folgenden Hypothese, die sich
mir im wesentlichen vor langer Zeit dargeboten hat. Sie mag aber wenigstens
dazu dienen, die Forderung, die ich an eine vollständigere Theorie
der Tonempfindungen glaube stellen zu müssen, auch von der positiven
Seite zu beleuchten und zu erläutern. Ich will meine Ansicht zunächst
so darstellen, wie dies in der ersten Auflage dieser Schrift geschehen
ist.
Für ein Tier von einfacher Organisation sei
die Wahrnehmung leiser periodischer Bewegungen des Mediums, in dem es sich
befindet, eine wichtige Lebensbedingung. Wird der Wechsel der Aufmerksamkeit
(wegen der zu großen Organe, in welchen so rapide Änderungen
nicht mehr eintreten können) zu träge und die Oszillationsperiode
zu kurz, die Amplitude zu klein, als daß die einzelnen Phasen der
Reizung ins Bewußtsein fallen könnten, so wird es noch möglich
sein, die gehäuften Empfindungseffekte des oszillatorischen Reizes
wahrzunehmen. Das Gehörorgan wird dem Tastorgan den Rang ablaufen34).
Ein schwingungsfähiges Endorgan (ein Hörhaar) spricht nun vermöge
seiner physikalischen Eigenschaften nicht auf jede Schwingungszahl an,
aber auch nicht auf eine, sondern gewöhnlich auf mehrere weit von
einander abliegende35). Sobald also das
ganze Kontinuum der Schwingungszahlen zwischen gewissen Grenzen für
das Tier von Wichtigkeit wird, genügen nicht mehr einige wenige Endorgane,
sondern es stellt sich das Bedürfnis nach einer ganzen Reihe solcher
Organe von abgestufter Stimmung ein. Als ein solches System wurde von Helmholtz
zunächst das Cortische Organ, dann die Basilarmembran angesehen.
Schwerlich wird nun ein Glied dieses Systems nur
auf eine Schwingungszahl ansprechen. Wir müssen vielmehr erwarten,
daß es viel schwächer in abgestufter Intensität (vielleicht
durch Knoten abgeteilt) auch auf die Schwingungszahlen 2n, 3n,
4n usw., und ebenso auch auf die Schwingungszahlen ![]() ,
, ![]() ,
, ![]() usw. anspricht. Da die Annahme einer besondern Energie für jede Schwingungszahl
sich als unhaltbar gezeigt hat, so stellen wir uns dem Obigen gemäß
vor, daß zunächst nur zwei Empfindungsenergien, sagen wir Dumpf
(D) und Hell (H) ausgelöst werden. Die betreffende Empfindung
wollen wir (ähnlich wie dies bei Mischfarben geschieht) symbolisch
durch pD + qH darstellen, oder wenn wir p + q = 1 setzen, und q als eine
Funktion f(n) der Schwingungszahl ansehen 36),
durch
usw. anspricht. Da die Annahme einer besondern Energie für jede Schwingungszahl
sich als unhaltbar gezeigt hat, so stellen wir uns dem Obigen gemäß
vor, daß zunächst nur zwei Empfindungsenergien, sagen wir Dumpf
(D) und Hell (H) ausgelöst werden. Die betreffende Empfindung
wollen wir (ähnlich wie dies bei Mischfarben geschieht) symbolisch
durch pD + qH darstellen, oder wenn wir p + q = 1 setzen, und q als eine
Funktion f(n) der Schwingungszahl ansehen 36),
durch
Die auftretende Empfindung soll nun der Schwingungszahl
des oszillatorischen Reizes entsprechen, an welchem Glied der Reihe der
Endorgane der Reiz auch angreifen mag. Hierdurch wird die frühere
Darstellung nicht wesentlich gestört. Denn indem das Glied Rn
am stärksten auf n und viel schwächer auf 2n, 3n oder ![]() ,
, ![]() anspricht, indem Rn auch auf einen aperiodischen Anstoß
mit n ausschwingt, wird doch die Empfindung [1 - f(n)]D + f(n)H überwiegend
an das Glied Rn gebunden bleiben.
anspricht, indem Rn auch auf einen aperiodischen Anstoß
mit n ausschwingt, wird doch die Empfindung [1 - f(n)]D + f(n)H überwiegend
an das Glied Rn gebunden bleiben.
36) Will man eine recht einfache Darstellung haben, so setzt man f (n) = k. logn.
Gut konstatierte Fälle von Doppelthören
(vgl. Stumpf Tonpsychologie I, S. 266 fg.) könnten uns nötigen,
das Auslösungsverhältnis von D und H als vom Endorgan und nicht
von der Schwingungszahl abhängig zu betrachten, was aber unsere Auffassung
ebenfalls nicht stören würde.
Ein Glied Rn spricht also stark auf n,
schwächer aber auch auf 2n, 3n ... und ![]() ,
, ![]() ... mit den diesen Schwingungszahlen zugehörigen Empfindungen an.
Es ist aber doch sehr unwahrscheinlich, daß die Empfindung genau
dieselbe bleibt, ob Rn auf n oder ob
... mit den diesen Schwingungszahlen zugehörigen Empfindungen an.
Es ist aber doch sehr unwahrscheinlich, daß die Empfindung genau
dieselbe bleibt, ob Rn auf n oder ob ![]() auf n anspricht. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß jedesmal, wenn
die Glieder der Organreihe auf einen Partialton ansprechen, die Empfindung
eine schwache Zusatzfärbung erhält, die wir symbolisch für
den Grundton durch Z1, für die Obertöne durch, Z2,
Z3 ... für die Untertöne durch
auf n anspricht. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß jedesmal, wenn
die Glieder der Organreihe auf einen Partialton ansprechen, die Empfindung
eine schwache Zusatzfärbung erhält, die wir symbolisch für
den Grundton durch Z1, für die Obertöne durch, Z2,
Z3 ... für die Untertöne durch ![]() ,
, ![]() ... darstellen wollen. Hiernach wäre also die Tonempfindung etwas
reicher zusammengesetzt als dies der Formel [1 - f(n)]D + f(n)H entspricht.
Die Empfindungen, welche die Reihe der Endorgane, durch die Grundtöne
gereizt, gibt, bilden also ein Gebiet mit der Zusatzfärbung Z1,
die Reizung derselben Reihe durch den ersten Oberton gibt ein besonderes
Empfindungsgebiet mit der Zusatzfärbung Z2 usw. Die Z können
entweder unveränderliche Bestandteile sein, oder selbst wieder aus
zwei Bestandteilen U und V bestehen, und durch
... darstellen wollen. Hiernach wäre also die Tonempfindung etwas
reicher zusammengesetzt als dies der Formel [1 - f(n)]D + f(n)H entspricht.
Die Empfindungen, welche die Reihe der Endorgane, durch die Grundtöne
gereizt, gibt, bilden also ein Gebiet mit der Zusatzfärbung Z1,
die Reizung derselben Reihe durch den ersten Oberton gibt ein besonderes
Empfindungsgebiet mit der Zusatzfärbung Z2 usw. Die Z können
entweder unveränderliche Bestandteile sein, oder selbst wieder aus
zwei Bestandteilen U und V bestehen, und durch
| Die Glieder der Reihe der Endorgane : | Rp | R4p | R5p | R20 p | |
| Wenn die Klänge
4p und 5p keine Obertöne enthalten
|
sprechen an auf die Schwingungszahlen : | 4p, 5p | 4p | 5p | |
| mit den Zusatzempfindungen: | Z4 Z5 | Z1 | Z1 | ||
| Wenn die Klänge 4p und 5p Obertöne enthalten | sprechen außerdem an auf die Schwingungszahlen: | 20p = 5 (4p) | 20p = 4 (5p) | ||
| mit den Zusatzempfindungen: | Z5 | Z4 |
Bei der Terzverbindung treten also die für die
Terz charakteristischen Zusatzempfindungen Z4, Z5
und ![]() ,
, ![]() hervor, auch wenn die Klänge gar keine Obertöne enthalten, und
erstere (Z4, Z5) werden noch verstärkt,
wenn in den Klängen entweder in der freien Luft oder doch im Ohr Obertöne
vorkommen. Das Schema läßt sich leicht für jedes beliebige
Intervall verallgemeinern.37)
hervor, auch wenn die Klänge gar keine Obertöne enthalten, und
erstere (Z4, Z5) werden noch verstärkt,
wenn in den Klängen entweder in der freien Luft oder doch im Ohr Obertöne
vorkommen. Das Schema läßt sich leicht für jedes beliebige
Intervall verallgemeinern.37)
18.
Die Hypothese des mehrfachen Ansprechens der Reihe der Endorgane, sowie
jene der Zusatzfärbungen, habe ich ausdrücklich als solche bezeichnet
und habe dieselbe lediglich zu dem Zweck vorgebracht, um den Sinn der Postulate,
welche sich durch die psychologische Analyse ergeben, zu erläutern
und andere vielleicht zu einem glücklicheren Griff anzuregen. Ich
kann mich also nicht wundern, wenn andere diesem Versuche nicht ohne weiteres
zustimmen. Daß aber diese Hypothese nutzlos sei und ihren Zweck verfehle,
wie Stumpf 38) sagt, kann ich nicht
erkennen. Das Zusammentreffen der Zusatzfärbungen Z4,
Z5, bezw. ![]() ,
, ![]() in einem Nerv ist nicht bloß ein physischer, sondern auch ein psychophysischer
Umstand. Die Empfindung einer Mischfärbung durch ein Element wird
kaum gleichgültig sein. Es scheint mir vielmehr, daß das, was
ich suche: die Erklärung der bestimmten Färbung der Intervalle,
und auch das, was Stumpf sucht: die Erklärung der Verschmelzung,
durch die von mir angenommene partielle Koinzidenz auch ohne Obertöne
wirklich dargestellt würde. Wenn ferner Stumpf sagt, daß
bei Klängen mit Obertönen für Helmholtz keine Schwierigkeit
besteht, die Ähnlichkeit gleicher Intervalle zu verstehen, so beruht
dies auf einem Verkennen dessen, was ich gegen Helmholtz vorgebracht
habe. Niemand wird befriedigt sein, wenn man ihm sagt, daß bei zwei
Terzen gleich starke Obertöne zusammenfallen, da es sich doch um qualitativ
ähnliche Empfindungen handelt. Wäre das Wiedererkennen eines
melodischen Terzenschrittes unmittelbar verständlich, so brauchte
man für das Erkennen der harmonischen Terzen Verbindung natürlich
keine besondere Erklärung zu suchen. Da aber Stumpf selbst
die melodischen Schritte durch die harmonische Verbindung für charakterisiert
hält, so würde diese Auffassung einen Zirkel einschließen.
Auch nach meiner Darlegung leitet die Tatsache der melodischen und harmonischen
Auswahl bestimmter Schwingungszahlenverhältnisse auf dasselbe Problem.
Meine Hypothese lehnt sich an die Resonanztheorie an, und ist nach Stumpfs
Ansicht schon deshalb zu verwerfen. Letzterer Punkt soll noch besonders
zur Sprache gebracht werden.
in einem Nerv ist nicht bloß ein physischer, sondern auch ein psychophysischer
Umstand. Die Empfindung einer Mischfärbung durch ein Element wird
kaum gleichgültig sein. Es scheint mir vielmehr, daß das, was
ich suche: die Erklärung der bestimmten Färbung der Intervalle,
und auch das, was Stumpf sucht: die Erklärung der Verschmelzung,
durch die von mir angenommene partielle Koinzidenz auch ohne Obertöne
wirklich dargestellt würde. Wenn ferner Stumpf sagt, daß
bei Klängen mit Obertönen für Helmholtz keine Schwierigkeit
besteht, die Ähnlichkeit gleicher Intervalle zu verstehen, so beruht
dies auf einem Verkennen dessen, was ich gegen Helmholtz vorgebracht
habe. Niemand wird befriedigt sein, wenn man ihm sagt, daß bei zwei
Terzen gleich starke Obertöne zusammenfallen, da es sich doch um qualitativ
ähnliche Empfindungen handelt. Wäre das Wiedererkennen eines
melodischen Terzenschrittes unmittelbar verständlich, so brauchte
man für das Erkennen der harmonischen Terzen Verbindung natürlich
keine besondere Erklärung zu suchen. Da aber Stumpf selbst
die melodischen Schritte durch die harmonische Verbindung für charakterisiert
hält, so würde diese Auffassung einen Zirkel einschließen.
Auch nach meiner Darlegung leitet die Tatsache der melodischen und harmonischen
Auswahl bestimmter Schwingungszahlenverhältnisse auf dasselbe Problem.
Meine Hypothese lehnt sich an die Resonanztheorie an, und ist nach Stumpfs
Ansicht schon deshalb zu verwerfen. Letzterer Punkt soll noch besonders
zur Sprache gebracht werden.
38) Stumpf, Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft, Heft l, S. 17, 18
19.
Über die physikalischen Vorgänge beim Hören, bezw. die Funktion der Teile des mittleren Ohres ist schon sehr viel diskutiert worden. Trotzdem scheint es, daß eine unbefangene Revision der physikalischen Hörtheorie sehr notwendig ist. Man hat gefragt, ob die Gehörknöchelchen als Ganzes schwingen, oder ob die Schallwellen durch dieselben hindurchziehen. E. H. Weber hat sich für die erstere Ansicht entschieden, welche experimentell von Politzer bestätigt und theoretisch wohl von mir zuerst begründet worden ist39). Wenn nämlich die Dimensionen der Knöchelchen gegen die Länge der in Betracht kommenden Schallwellen in deren Material sehr klein ist, wie es wirklich zutrifft, so ist es keine Frage, daß in der ganzen Ausdehnung der Knöchelchen nahezu dieselbe Bewegungsphase auftreten, demnach sich die Knöchelchen als Ganzes bewegen müssen. Man dachte sich nun die Bewegung der Gehörknöchelchen auf die Labyrinthflüssigkeit übertragen. Allein pathologische Erfahrungen lehren, daß man, wenn nur das Labyrinth in Ordnung ist, auch ohne Mitwirkung der Gehörknöchelchen und des Trommelfelles noch recht gut hört. Diese Teile scheinen nur von Wichtigkeit zu sein, wenn es sich um die Übertragung der leisesten Luftbewegungen auf das Labyrinth handelt. Da scheint die Reduktion des auf die ganze Trommelfellfläche entfallenden Druckes auf die kleine Steigbügelfußplatte notwendig. Sonst können die Schallwellen auch durch die Kopfknochen auf das Labyrinth übertragen werden. Durch Aufsetzen von tönenden Körpern (Stimmgabeln) auf verschiedene Stellen des Kopfes überzeugt man sich davon, daß die Richtung der auf das Labyrinth eindringenden Schallwellen keine besondere Rolle spielt. Alle Dimensionen des schallperzipierenden Apparates sind wieder so klein gegen die hörbaren Schallwellen, die Schallgeschwindigkeit in den Knochen und der Labyrinthflüssigkeit so groß, daß wieder in einem Moment nur merklich dieselbe Wellenphase in der ganzen Ausdehnung des Labyrinthes Platz greifen kann. Das Obige führt darauf, nicht die Bewegungen und die Bewegungsrichtung, sondern die Druckvariationen, welche im Labyrinth nahezu synchron auftreten, als empfindungserregend, als den maßgebenden Reiz zu betrachten.
40) Ewald, Eine neue Hörtheorie, Bonn 1899.
Bald nach Erscheinen der vierten Auflage dieses Buches, in welcher ich meine Zweifel betreffend die Membranschwingungen in Flüssigkeiten in den vorstehenden Zeilen geäußert hatte, trat Ewald41) mit den Experimenten an seiner "camera acustica" hervor. Es gelang ihm, eine in Wasser versenkte zarte Membran, ungefähr von den Dimensionen der Basilarmembran, akustisch in stehende Schwingungen mit deutlichen, der Tonhöhe entsprechenden, Knotenabteilungen zu versetzen. Hiermit war meine Vermutung als falsch erwiesen und ich hatte Grund zu überlegen, worin ich geirrt hatte. Da fielen mir nun die sehr kleinen Knotenabteilungen ein, die ich vor Jahren selbst an Flüssigkeitsmembranen erhalten hatte42). Ich erinnerte mich ferner der Friesachschen43) Versuche mit in Wasser versenkten Saiten. Aus letzteren ergab sich nämlich, daß das Eintauchen in Flüssigkeiten wie eine Vergrößerung der Masse der Saite sich äußert, indem die Flüssigkeit nur in der nächsten Umgebung der Saite, in sehr kurzen Bahnen synchron hin- und herströmend, diese Schwingung begleitet. Es ist also ganz wohl denkbar, daß die Labyrinthflüssigkeit als Ganzes hin- und herschwingt, und daß dennoch in derselben die vielmal kleinere Fortpflanzungsgeschwindigkeit in der Membran in stehenden Schwingungen der letzteren zu Tage tritt. Ist aber die Existenz solcher Membranschwingungen nachgewiesen, so gewinnen Ewalds theoretische Ideen sehr an Wert. Ich möchte hier noch auf zwei Mitteilungen von A. Stöhr44) hinweisen, die mir entwicklungsfähige Gedankenkeime zu enthalten scheinen.
41) Ewald, Pflügers Archiv, 1903, Bd. 93, S. 485.
42) Optisch-akustische Versuche, Prag 1872, S. 93.
43) Friesach, Ber. d. Wiener Akademie 1867, Bd. 36, 2. Abt., S. 316.
Die Schwierigkeit, die Resonanztheorie physikalisch zu begründen, ist wohl von allen, die sich mit derselben beschäftigt haben, mehr oder minder gefühlt worden, wie mir scheint, nicht am wenigsten von deren Urheber. Zugleich erkannte man aber, daß mit dem Aufgeben derselben dasjenige Motiv, welches das Verständnis der Klanganalyse, die Durchsichtigkeit der Lehre von den Tonempfindungen bedingt, verloren geht. Daher die krampfhaften Bemühungen, die Resonanztheorie zu halten. L. Hermann45) scheint mir nun das richtige Wort ausgesprochen zu haben, wenn er meint, daß ohne irgend eine Resonanztheorie nicht auszukommen sei, daß diese aber nicht notwendig eine physikalische sein müsse, sondern auch eine physiologische sein könne. Man kann mit Hermann die plausible Annahme machen, daß die nervösen Endorgane selbst für Reize von einer bestimmten Periode besonders empfindlich sind46). Es müssen nicht gerade Elastizitätskräfte sein, welche das Organ in seine Gleichgewichtslage zurücktreiben, sondern man kann sich einen elektrischen, chemischen usw. Gleichgewichtszustand denken, und Abweichungen von demselben, die sich wie + und - verhalten. Unter diesen Organen kann ferner eine Verbindung bestehen, wodurch eines auf das andere erregend wirken kann. Es eröffnet sich so die begründete Aussicht, den Verlust der physikalischen Resonanztheorie zu ersetzen. Auf die vollständige und genaue Wiedergabe der Hermannschen Ausführungen muß ich verzichten, und muß mich begnügen, auf dessen Abhandlungen zu verweisen.
45) Hermann, Pflügers Archiv, Bd. 56, S. 494, 495 ff., 1894.
21.
Bei ihrem Auftreten erschien die Helmholtzsche Lehre von den
Tonempfindungen als eine schöne, vollendete, mustergültige Leistung.
Dennoch haben fundamentale Aufstellungen derselben der Kritik nicht Stand
halten können. Und diese Kritik war keineswegs eine mutwillige, wie
daraus genügend hervorgeht, daß die Ausführungen der verschiedenen
Kritiker trotz aller individueller Eigentümlichkeit auf dieselben
Punkte und nach denselben Richtungen hinweisen. Das Hauptproblem erscheint
durch die Kritik fast auf den Stand vor Helmholtz zurückgeschraubt.
Es könnte dies tragisch wirken, wenn es überhaupt erlaubt wäre,
diese Sache vom Standpunkte einer Person zu betrachten.
Wir können aber die Helmholtzsche Leistung
trotz ihrer angreifbaren Seiten nicht unterschätzen. Außer dem
reichlichen positiven Gewinn, den wir dieser Arbeit verdanken, ist Bewegung
in die Fragen gekommen, sie hat den Forschern zu andern Versuchen Mut gemacht,
eine Menge von neuen Untersuchungen ist angeregt, neue Aussichten sind
eröffnet, mögliche Irrwege definitiv für immer verschlossen
worden. Leichter knüpft ja ein neuer Versuch und die Kritik an eine
schon vorhandene positive Arbeit an.
Helmholtz hat sich wohl darin getäuscht,
daß er meinte, diese Aufgabe, welche dem Psychologen, Physiologen
und Physiker reichlich Arbeit gibt, hauptsächlich nach physikalischen
Gesichtspunkten bewältigen zu können. Haben doch seine befreundeten
Zeitgenossen, welche um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit ihm die
physikalische Physiologenschule begründeten, auch erkennen müssen,
daß das Stückchen anorganischer Physik, welches wir beherrschen,
bei weitem noch nicht die ganze Welt ist. Die "Lehre von den Tonempfindungen"
ist ein genialer Wurf, der Ausdruck einer künstlerischen Intuition,
welcher uns, wenn auch nur symbolisch, durch eine physikalische Analogie,
durch ein Bild die Wege weist, die die weitere Untersuchung einzuschlagen
hat. Wir müssen deshalb acht geben, daß wir mit den zu beseitigenden
Mängeln nicht auch wertvollen Besitz über Bord werfen. Aus welchen
Gründen Helmholtz selbst von der Kritik so wenig Notiz genommen
hat, weiß ich nicht. Mit seiner letztwilligen Verfügung aber,
nach welcher der Text der "Tonempfindungen" nach seinem Tode unverändert
bleibt, scheint er mir das Richtige getroffen zu haben.
22.
Für denjenigen, welcher die Dinge vom Standpunkte der Entwickelungslehre
zu betrachten pflegt, ist die moderne Musik in ihrer hohen Ausbildung,
sowie die spontan und plötzlich auftretende musikalische Begabung,
auf den ersten Blick eine höchst sonderbare rätselhafte Erscheinung.
Was hat diese Gehörsentwickelung mit der Arterhaltung zu schaffen?
Geht sie nicht weit über das Notwendige oder überhaupt nur Nützliche
hinaus? Was soll uns die feine Unterscheidung der Tonhöhen? Was nützt
uns der Sinn für die Intervalle, für die Klangfärbungen
des Orchesters?
Eigentlich kann man in bezug auf jede Kunst dieselbe
Frage stellen, ob sie ihren Stoff aus diesem oder jenem Sinnesgebiet schöpft.
Die Frage besteht auch bezüglich der scheinbar weit über das
notwendige Maß hinausgehenden Intelligenz eines Newton, Euler
usw. Die Frage liegt nur am nächsten bezüglich der Musik, welche
gar kein praktisches Bedürfnis zu befriedigen, meist nichts darzustellen
hat. Sehr verwandt mit der Musik ist aber die Ornamentik. Wer sehen will,
muß Richtungen der Linien unterscheiden können. Wer sie fein
zu unterscheiden vermag, dem kann sich aber, gewissermaßen als ein
Nebenprodukt seiner Ausbildung, das Gefühl für die Gefälligkeit
der Kombinationen von Linien ergeben. So verhält es sich auch mit
dem Sinn für Farbenharmonie nach Entwicklung des Unterscheidungsvermögens
für Farben, so wird es auch mit der Musik sich verhalten.
Wir müssen uns auch gegenwärtig halten,
daß das, was wir Talent und Genie nennen, so groß uns auch
dessen Wirkungen erscheinen, in der Begabung nur eine kleine Differenz
gegen das Normale darstellt. Auf etwas größere psychische Stärke
in einem Gebiet reduziert sich das Talent. Zum Genie wird dasselbe durch
die über die Jugendzeit hinaus erhaltene Fähigkeit der Anpassung,
durch die Erhaltung der Freiheit, sich außerhalb der Schablone zu
bewegen. Die Naivität des Kindes entzückt uns und macht uns fast
immer den Eindruck des Genies. Gewöhnlich schwindet aber dieser Eindruck
bald, und wir merken, daß dieselben Äußerungen, welche
wir gewohnt sind, als Erwachsene auf Rechnung der Freiheit zu setzen, beim
Kinde noch auf Mangel an Festigkeit beruhten.
Talent und Genie treten, wie Weismann treffend
hervorgehoben hat47), in der Folge der
Generationen nicht allmählich und langsam hervor, sie können
auch nicht das Resultat einer gehäuften Übung der Vorfahren sein,
sie zeigen sich spontan und plötzlich. Mit dem eben Besprochenen zusammengehalten,
wird dies auch verständlich, wenn wir bedenken, daß die Deszendenzen
nicht genau den unmittelbaren Vorfahren gleichen, sondern etwas variierend
die Eigenschaften derselben und auch fernerer Vorfahren und Verwandten
bald etwas abgeschwächt, bald etwas gesteigert aufweisen. Die Vergleichung
mehrerer Kinder desselben Elternpaares ist da sehr lehrreich. Den Einfluß
der Abstammung auf psychische Anlagen zu leugnen, wäre ebenso unvernünftig,
als im Sinne der modernen bornierten oder perfiden Rassenfanatiker, alles
darauf zurückzuführen. Hat doch jeder an sich erfahren, welche
reichen psychischen Erwerbungen er der kulturellen Umgebung, dem Einfluß
längst entschwundener Geschlechter, sowie der Zeitgenossen verdankt.
Die Entwicklungsfaktoren werden eben im postembryonalen Leben nicht plötzlich
unwirksam48).
47) Weismann, Über die Vererbung, Jena 1883, S. 43.