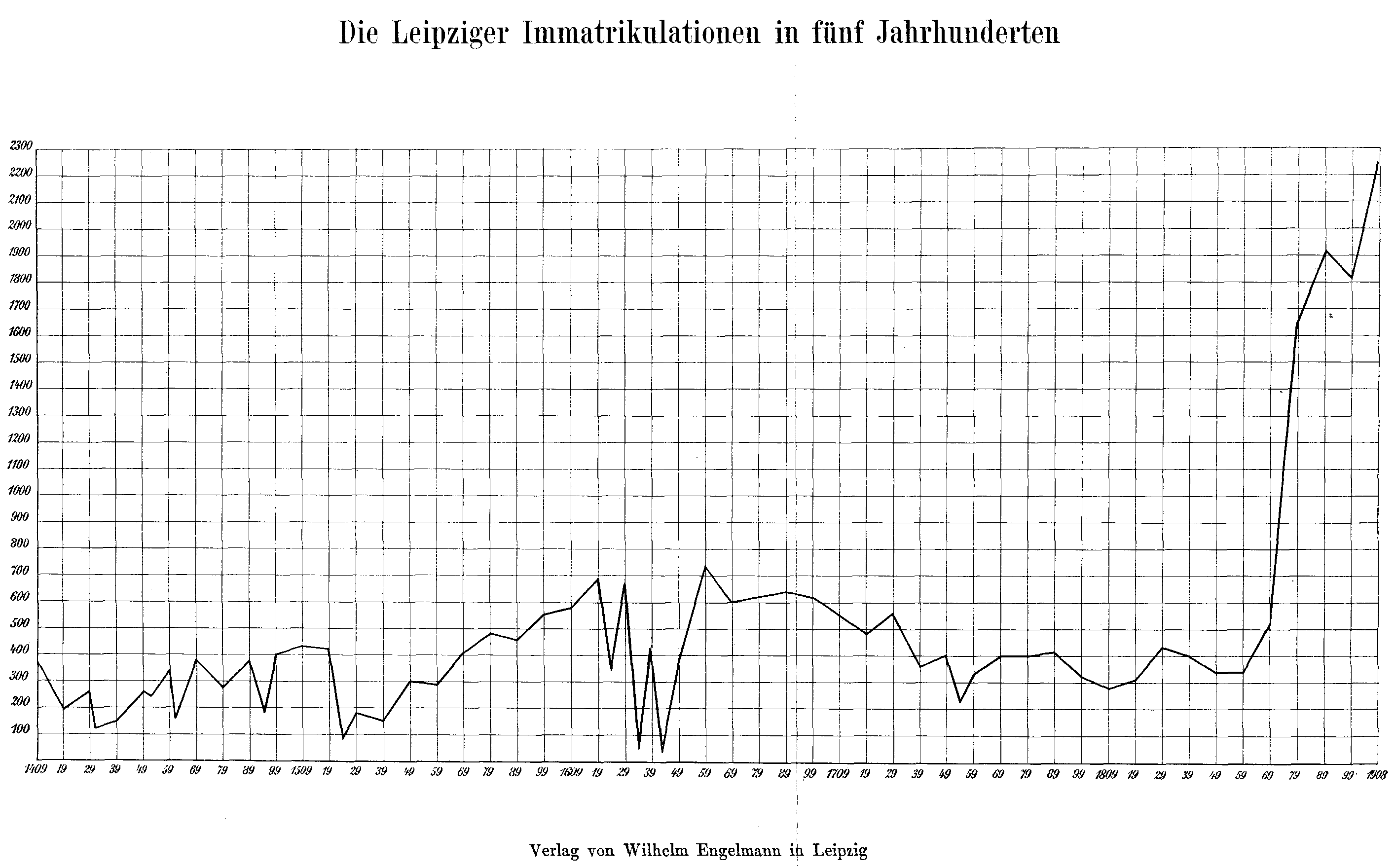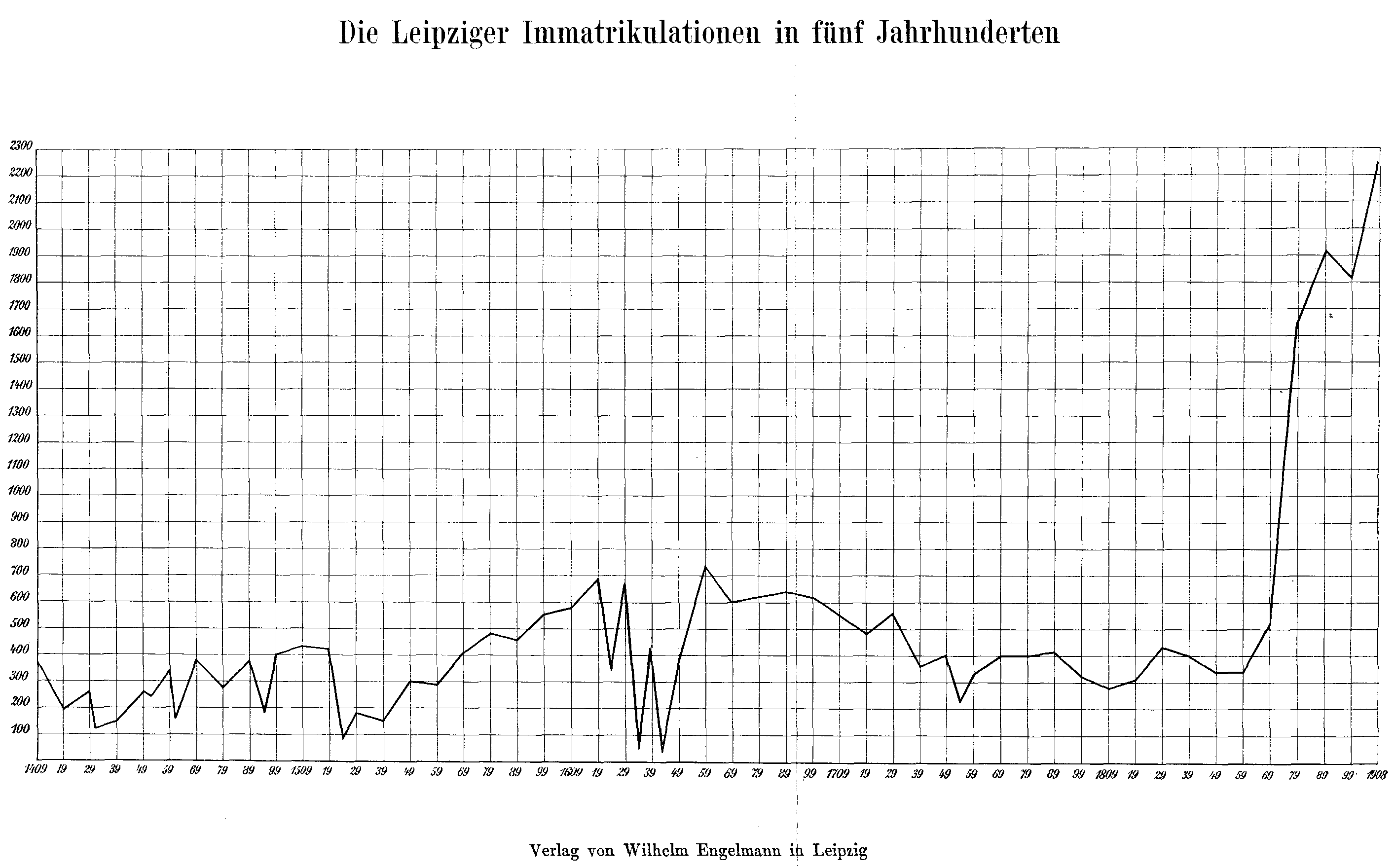
Die Leipziger Immatrikulationen und die Organisation der alten Hochschule.
Mit einer Kurventafel.
Von Gelehrten, die sich mit der Geschichte unserer Universitäten beschäftigt haben, ist mehrfach versucht worden, die Zahlenverhältnisse der Studierenden an diesen hohen Schulen in den älteren Zeiten ihres Bestehens, über die uns keine direkten Aufzeichnungen überliefert sind, zu ermitteln. Für die Beurteilung des geistigen Lebens in den verschiedenen Perioden und an den verschiedenen Orten würde ja ein solches Bild von hohem Werte sein, so sehr man dabei auch die allgemeinen Bevölkerungsverhältnisse mit in Rücksicht zu ziehen hätte, über die bekanntlich die Grundlagen statistischer Feststellungen in älterer Zeit zum Teil ebenfalls höchst mangelhafte sind. Mit ihnen verglichen ist vielleicht sogar das Material, das uns die Universitätsmatrikel der meisten deutschen Hochschulen bis zu ihren Anfängen hinauf bieten, ein verhältnismäßig vollkommenes zu nennen. Denn hier pflegen die Zugänge an Schülern und Lehrern von Jahr zu Jahr mit ziemlich großer Gewissenhaftigkeit verzeichnet zu sein. Freilich ist aber daraus über die wirkliche Frequenz der Hochschulen unmittelbar nichts zu entnehmen; sondern, um das zu können, müßten wir außerdem auch die Zahl der von Semester zu Semester Abgehenden oder mindestens die der Studienjahre kennen, die der einzelne durchschnittlich auf der Universität zu verbringen pflegte. Da uns diese Daten unbekannt sind, so pflegt man gewisse Voraussetzungen über die mittlere Dauer des Studiums, oder wohl auch die in einzelnen, freilich sehr seltenen Fällen ausgeführten Zählungen der zu einem bestimmten Zeitpunkt Anwesenden den Schlüssen über die Frequenz unserer Hochschule zu den verschiedenen Zeiten ihres Bestehens zugrunde zu legen1). Daß in allen diesen Fällen die Ergebnisse höchst unsicher sind, ist selbstverständlich. Auch kann man sich dem Eindruck nicht ganz verschließen, daß der heutige Statistiker, wenn er solche Wahrscheinlichkeitserwägungen anstellt, bei aller Rücksicht auf die so weit abweichenden Zustände des Gelehrtenunterrichts früherer Zeiten, doch immer noch, ohne es zu wollen, allzu geneigt ist, jene Zeiten an dem Maße unseres heutigen Universitätslebens zu messen. Das ist aber in doppelter Weise irreführend. Nicht nur sind die Verhältnisse zu verschiedenen Zeiten außerordentlich abweichende, sondern es fehlt auch selbst zu einer und derselben Zeit nicht an lokalen Eigentümlichkeiten, die namentlich das Verhältnis zwischen den relativ beständigeren Mitgliedern der Hochschule und den fluktuierenderen Bestandteilen zu einem äußerst wechselnden machen. Das einzige, was sich daher als Resultat solcher statistischer Erwägungen festhalten läßt, ist wohl dies, daß wir im allgemeinen die Frequenzziffern der älteren deutschen Universitäten viel niedriger anzunehmen haben, als man nach früheren Schätzungen vermutete, und daß sie 400–600 wohl selten überstiegen haben werden. Wenn demnach das Album der Leipziger Universität gleich für das erste Semester 1409/10 neben 35 Baccalaren und 50 Magistern 356 Scholaren verzeichnet, so dürften diese Zahlen ziemlich annähernd der gewöhnlichen Frequenzziffer deutscher Universitäten entsprechen, wie sich diese nach der großen Katastrophe der Prager Hochschule im Jahre 1409 gestalteten. Nur Prag selbst, als die älteste Gründung auf deutschem Boden (1348), und nächst ihm Wien (1365) scheinen ihrem großen Pariser Vorbild näher gekommen zu sein. Die Zahl 2500, die für Prag vor der Auswanderung angegeben wird, mag daher nicht zu hoch gegriffen sein, da, abgesehen von der Gründung Leipzigs, die Ausgewanderten aus der böhmischen Hauptstadt sich in nicht unerheblicher Zahl über andere deutsche Universitäten verteilten. Daß diese einen solchen Zuwachs infolge der Prager Katastrophe kaum erkennen lassen, ist kein Beweis hiergegen, da jene Ausgewanderten nach der Sitte der vagierenden Scholaren wahrscheinlich längere Zeit hin und her zogen und sich über ein ziemlich weites Gebiet verbreiteten. Auch die Angabe, daß annähernd 2000 von Prag weggezogen seien, ist daher möglicherweise nicht zu hoch gegriffen, so sehr man bei solchen abgerundeten Zahlen bekanntlich mit der Neigung zu Übertreibungen zu rechnen hat. Unverhältnismäßig groß erscheint nur gegenüber den späteren Einzeichnungen in unsere Leipziger Matrikel die Zahl der Magister und Baccalaren, die zusammen beinahe den vierten Teil der Ankömmlinge ausmachen. Man darf wohl daraus schließen, daß die älteren, graduierten Mitglieder die Führer der Separation waren, wie sie denn auch auf allen deutschen Hochschulen, ebenso wie in Paris, allein die eigentliche Korporation bildeten, in die den Scholaren erst durch ihre Graduierung der Zutritt eröffnet wurde. Darin bestand zugleich ein wichtiger Gegensatz zu den italienischen Universitäten, auf denen die Scholaren selbst den Stamm der Korporation ausmachten.
Hieraus erhellt, daß von einer "mittleren Studienzeit" und von einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer an der gleichen Hochschule bei den älteren Universitäten überhaupt kaum die Rede sein kann. Variiert doch die letztere zwischen der ganzen Lebensdauer, die ein als Kind immatrikuliertes Mitglied der Universität angehören konnte, und einem Semester oder einem Bruchteil eines solchen, die einer jener nirgends lange ausharrenden fahrenden Scholaren am gleichen Ort blieb. Charakteristisch ist in dieser Beziehung besonders der Unterschied der Sommer- und Wintersemester, der nicht bloß in Leipzig, sondern auch in Erfurt, Frankfurt a. 0., Heidelberg und demnach vermutlich bei allen Universitäten zu bemerken ist. Er besteht darin, daß die Zahl der Immatrikulationen im Sommer meist viel beträchtlicher ist als im Winter. In Leipzig sinkt sie im Winter in einigen Fällen bis auf die Hälfte des vorangehenden oder folgenden Sommers. Der Unterschied selbst bleibt aber in der gleichen Richtung bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts bestehen, wo er nun allmählich dem umgekehrten, noch heute zu beobachtenden Wechsel Platz macht: Leipzig wird, wie alle Universitäten in Großstädten, zur Winteruniversität, deren Bevölkerung im Sommer teilweise nach den Sommeruniversitäten der kleineren Städte, besonders Süddeutschlands, abflutet. Ausnahmen von der ersten Regel finden sich in früheren Zeiten höchstens da, wo andere den Bestand der Universität erschütternde Ereignisse, wie Krieg oder Pest, vorübergehend ihre Wirkungen ausüben. Da nun bei den sämtlichen älteren Hochschulen jener Unterschied der Sommer- und Winterfrequenz in der gleichen Richtung wiederkehrt, so hat er offenbar allgemeingültige Ursachen, die mit dem heutigen Hin- und Herfluten zwischen Winter- und Sommeruniversitäten nichts zu tun haben. Diese letztere Erscheinung findet ihren naheliegenden Kommentar in dem im letzten halben Jahrhundert zu so großen Dimensionen angewachsenen Sommerfrischleben der Großstädter. In den früheren Jahrhunderten leerten sich dagegen die Hochschulen im Winter ebenso wie die Landstraßen von den fahrenden Gesellen verschiedenster Gattung. Der Unterhalt in der Universitätsstadt wurde für den ärmeren Scholaren kostspieliger. Die rauhe Jahreszeit trieb ihn an den väterlichen Herd zurück, worauf er sich dann im nächsten Sommer einer neuen oder auch wieder der gleichen Universität zuwandte; daher denn auch z. B. in Leipzig die Abnahme im Winter mehr auf Rechnung der Sachsen als der Ausländer kam. Wahrscheinlich werden übrigens die der Korporation fester angegliederten Scholaren an solchem Hin- und Zurückwandern verhältnismäßig wenig beteiligt gewesen sein, da es die Vorbereitung zu den für das Aufrücken unter die Graduierten erforderlichen Examinibus und Disputationen empfindlich hindern mußte. Bedenkt man aber, wie ungeregelt das Studium und die Zulassung zu demselben waren, und wie viele höchst mangelhaft vorbereitet zur Universität kamen, so wird die Menge jener fluktuierenden Elemente sicherlich keine geringe gewesen sein; und gar manche von ihnen mögen, nachdem sie an verschiedenen Universitäten herumgezogen waren, irgendwo sonst, in einem Kloster oder in einem bürgerlichen Beruf, Unterkunft gefunden haben oder auch auf der Landstraße verdorben sein. Dazu kommt, daß die Korporation den Kreis derer, die zu Baccalaren und namentlich zu Magistern promoviert werden wollten, schon deshalb einschränken mußte, da der Magister kein bloßer Titel war, sondern eo ipso die Berechtigung in sich schloß, in der Artistenfakultät zu lehren, die Magisterwürde aber außerdem die Vorbedingung zum Eintritt in eine der höheren Fakultäten bildete, innerhalb deren die Lehrberechtigung wiederum von der Verleihung des rite erworbenen Lizentiaten- und Doktortitels abhing. Auf diese Weise waren diese höheren Fakultäten streng gegen die Artisten- oder heutige philosophische Fakultät abgegrenzt, deren Mitglieder zu den ihnen obliegenden Vorlesungen über die allgemeinen, nach dem Aristotelischen Schema gegliederten Wissenschaften, wenn Bedürfnis vorhanden war, auch noch einzelne Baccalaren zuzogen. So erstreckte sich um die engere Korporation ein weiterer Kreis von "Assessores", die im allgemeinen ebenfalls zu den dauernden Mitgliedern der Universität gehörten, von den korporativen Rechten aber ausgeschlossen waren, und die also einigermaßen den Privatdozenten oder Repetenten heutiger Hochschulen zu vergleichen sind. Zwischen den Magistern der philosophischen und den Doktoren und Lizentiaten der höheren Fakultäten waren aber diese Rechte derart verteilt, daß in der Würde der Lehrfächer und der Lehrberechtigung die drei höheren Fakultäten über der philosophischen standen, daß dagegen in der körperschaftlichen Organisation und politischen Repräsentation der Universität die letztere den ersteren vorging. Darum war noch lange jedes Mitglied einer der höheren Fakultäten berechtigt, auch aus dem Umkreis der philosophischen Fächer Vorlesungen zu halten. Führte doch schon der Besitz der Magisterwürde, die zugleich die Bedingung zu einer höheren Fachprofessur war, dieses Recht mit sich. So gehörten noch im 18. Jahrhundert die beiden hervorragendsten philosophischen Lehrer und Schriftsteller der Leipziger Universität, der eine, Christian Crusius, der theologischen, der andere, Ernst Platner, der medizinischen Fakultät an. Der Rektor aber wurde ursprünglich aus den Mitgliedern der Artistenfakultät wechselnd nach der Reihenfolge der vier Nationen gewählt. Sie bildeten so die Teile der politischen Korporation, welcher der Rektor vorstand, während die Fakultäten unter ihren Dekanen die Lehrgemeinschaft der Universität zusammensetzten. Gerade die strenge Fixierung dieser beiden Gemeinschaften, der Universitas der Nationen und des Studium generale der Fakultäten, hat in Leipzig und hat wohl in ähnlicher Weise auch auf den andern älteren Universitäten Deutschlands dazu beigetragen, daß trotz einzelner Reibereien und selbst ernsterer Kämpfe zwischen den Fakultäten, wie einen solchen z. B. Halle noch im 18. Jahrhundert erlebte, der Friede im ganzen gewahrt blieb.
So ist es gekommen, daß sich in Deutschland das alte Studium generale mit seinen vier Fakultäten bis in unsere moderne Hochschule gerettet hat. wogegen das gemeinsame Vorbild dieser deutschen Gründungen, Paris, durch den Zwist der Fakultäten frühe schon der Auflösung der Universität in Fachschulen erlegen ist. In Deutschland war es im allgemeinen der fürstliche Absolutismus, der solche Separation hinderte. Der Wille des Fürsten wies die Streitenden zur Ruhe, und wo ein Einzelner als der Störenfried erschien, da wurde er seines Amtes entsetzt oder sogar, wie Christian Wolff, des Landes verwiesen. Was anderwärts der Wille des Fürsten, das bewirkte jedoch in Leipzig, das sich seiner alten Autonomie erfreute, wohl vor allem der fortwährende Kampf gegen äußere Feinde, in erster Linie gegen die Stadt, den "Inimicus" schlechthin, wie sie zeitweise in den ersten Jahrhunderten genannt wurde, und zum Teil auch gegen die Regierung, der gegenüber die Hochschule ihre Selbständigkeit zu wahren suchte.
So hat hier die aus den eigenartigen Bedingungen ihrer Gründung stammende korporative Autonomie wiederum den konservativen Geist, und beide zusammen haben den Frieden zwischen den in der Universität zusammengehaltenen Gliedern gesichert. Hierin findet dann aber auch die lange Bewahrung der Einteilung in die vier Nationen ihre politische Rechtfertigung. Die philosophische Fakultät repräsentierte die Einheit der Hochschule. Als solche bedurfte sie eines in der Organisation dieser Einheit gelegenen Gegengewichts gegen die zentrifugalen Kräfte der vier Fakultäten. Ein solches gaben die vier Nationen, die, ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer Fakultät, den Lehrkörper samt den Schülern nach dem Prinzip der Landeszugehörigkeit, im übrigen aber, da sich dieses Prinzip mit einer annähernd gleichmäßigen Teilung niemals strenge vereinigen ließ, ziemlich willkürlich gliederten. Darum nun die ganze Verwaltung der Hochschule und ihrer Repräsentation nach außen auf den Nationen, die Regelung der Stadien im Einzelnen und besonders der Fachbetrieb auf den Fakultäten aufgebaut war. Indem für die Bursen und Konvikte, für die Wahl des Rektors und für die von diesem vorzunehmende Einzeichnung in die Matrikel nur die Nationen, nicht die Fakultäten maßgebend waren, konnte die Universität ihre Einheit und die auf sie gegründete Autonomie nur bewahren, indem sie zugleich an diesen Nationen festhielt.
Hieraus erklärt es sich, daß unsere Matrikelbände auch noch über einen letzten Punkt keine Auskunft geben, der neben einer Gesamtziffer der Studierenden von Interesse sein würde: über die Fakultätszugehörigkeit. Dies gilt wegen der oben erwähnten Berechtigung aller Lehrer der Hochschule, in der Facultas artium zu dozieren, bis zu einem gewissen Grade auch für die Professoren. Daß von dieser Berechtigung vielfach Gebrauch gemacht wurde, ersieht man aus manchen einzelnen Mitteilungen. So gehörte Kaspar Borner der theologischen Fakultät an; er las aber mit Vorliebe über die Geometrie des Euklid. Dieses Übergreifen der Fakultäten reicht noch in das 18. Jahrhundert und selbst in den Anfang des 19. hinein. In jenem ist sie, dem Zug dieses Zeitalters zu universeller Bildung folgend, sogar besonders verbreitet. Zugleich bricht aber allmählich und allerdings nicht ohne ein gewisses Widerstreben der höheren Fakultäten, namentlich der theologischen, die Tendenz durch, dieses Übergreifen zu einer allgemeinen Berechtigung zu erweitern, so daß jedes ordentliche Mitglied einer Fakultät auch über Gegenstände einer andern lehren dürfe. Reste dieser Auffassung sind noch heute, namentlich hinsichtlich der allgemeineren, in das Gebiet der Philosophie herüberreichenden Lehrgegenstände stehen geblieben.
Obgleich nun nach dem Vorangegangenen die Matrikel unserer Hochschulen, namentlich in älterer Zeit, auf keine der Fragen, über die wir uns an sie um Auskunft wenden möchten, eine solche direkt oder indirekt geben können, und obgleich daher alle Annahmen über durchschnittliche Dauer des Studiums, Gesamtfrequenz der Universitäten, Zugang zu den sogenannten gelehrten Berufen teils völlig in der Luft stehen, teils nachweislich falsch sind, so entbehren doch die Immatrikulationsziffern selbst keineswegs eines allgemeineren kulturgeschichtlichen Interesses. Aus so verschiedenen, für uns nicht mehr zu sondernden Faktoren sich diese Zahlen zusammensetzen, in ihrer Gesamtwirkung liegt immerhin ein gewisses Maß für die Stärke, in der in den verschiedenen Zeiten die Tendenz nach gelehrter Bildung wirksam gewesen ist und den Strom derer, die sich der einzelnen Universität zuwandten, in seiner Zu- und Abnahme geregelt hat. Dabei zeigt dann freilich die nähere Verfolgung dieser Zahlen selbst, wie verkehrt es sein würde, wenn wir in Bausch und Bogen, unsern heutigen Anschauungen folgend, Immatrikulierte und "Studierende" einander gleichsetzen wollten. Abgesehen davon, daß, wie oben bemerkt, von außen gekommene und eventuell ganz vorübergehend an der Universität weilende Magister und Doktoren ebenfalls immatrikuliert wurden, und von dem wichtigen Unterschied der Studierenden, die dauernd in die Korporation einzutreten strebten, und derer, die als fahrende Schüler kamen und gingen, bieten namentlich die Minorennen, die zu Zeiten einen sehr ansehnlichen Teil der Gesamtheit ausmachten, ein ganz Ungewisses Kontingent zu der Immatrikulationsziffer. Die Matrikel älterer Zeit vereinigt so im wesentlichen vier Bedeutungen in sich: sie ist erstens ein Verzeichnis derer, die als Lehrende und Lernende dauernd in die Korporation eintreten; sie ist zweitens eine Liste derer, die sich zu ganz vorübergehendem Studium an der Universität aufhalten. Sie ist sodann drittens ein Verzeichnis solcher, die die Wohltat oder Ehre einer Aufnahme in die Mitgliederliste erwerben wollen, ohne darum notwendig eine Teilnahme an den Studien zu beabsichtigen; und sie nimmt viertens gelegentlich den Charakter eines Fremdenbuchs an, in das ein durchreisender Gelehrter oder sonst eine ausgezeichnete Persönlichkeit ihren Namen einschreibt. Unter diesen Bestandteilen stehen schon die beiden ersten, aus denen sich das Kontingent der eigentlichen Studierenden zusammensetzt, unter so verschiedenen Bedingungen, daß die Berechnung einer mittleren Studienzeit um so fragwürdiger wird, als wir von dem Zahlenverhältnis beider Bestandteile so gut wie nichts wissen, und als dieses Verhältnis je nach den Zeitbedingungen wahrscheinlich sehr großen Schwankungen unterworfen gewesen ist. Dazu kam endlich, daß die Universität, da sie nicht bloß "Studium", sondern auch politische Korporation war, auch inaktive Mitglieder aufnehmen konnte, ähnlich wie eine Handwerkerzunft, der man gelegentlich angehörte, ohne von dem Handwerk etwas zu verstehen, und daß zu Zeiten, wie die Kinderimmatrikulationen lehren, die Zahl dieser entweder immer inaktiv bleibenden oder erst später unter die Studierenden eintretenden Mitglieder eine ungewöhnliche Höhe erreichte. Hierbei mögen denn die Immatrikulationsgelder ein nicht unwillkommenes Emolument der meist sehr knapp oder gar nicht besoldeten Mitglieder der Artistenfakultät gebildet haben. Man darf das wohl aus der Sorgfalt schließen, mit der z. B. die Leipziger Rektoren deren Höhe besonders in den Fällen verzeichnen, wo ein reicher Scholar eine über der gewöhnlichen Taxe stehende Gabe darbrachte. Allzu ängstlich wird man daher auch in einer Zeit, in der sich in diesen gemilderten Formen das Trinkgeldwesen bis hoch hinauf in die Gelehrtenkreise erstreckte, mit der Zulassung zur Immatrikulation nicht gewesen sein, zumal da es an Vorbedingungen wissenschaftlicher Art noch ganz fehlte. Alle diese Faktoren, aus denen sich die Immatrikulationsziffer zusammensetzt, müssen vollends ununterscheidbar zusammenfließen, wenn man die Frequenzziffern verschiedener Hochschulen, die natürlich nicht alle zur gleichen Zeit unter den nämlichen Bedingungen standen, zu Durchschnittswerten vereinigt, oder wenn man die letzteren über einen größeren Zeitraum ausdehnt. Wie wenig übrigens in der älteren Zeit, wenn man je einmal zahlenmäßige Feststellungen vornahm, an die Fragen gedacht wurde, die für uns heute bei einer Statistik des Gelehrtenunterrichts im Vordergrund stehen, dafür bilden die spärlichen Anfänge einer solchen Statistik, die sich in den Bänden unserer Matrikel finden, einen sprechenden Beleg. Sie beziehen sich nämlich stets nur auf die Gesamtzahl der Immatrikulierten vom Beginn der Gründung an. Zum erstenmal geschieht es im Winter 1517/18, daß der regierende Rektor auf den Gedanken gerät, alle bis dahin Immatrikulierten zusammenzuzählen und sie, wie eine Nachprüfung lehrt, nicht ganz, aber doch annähernd richtig auf 34319 feststellt. Sein Beispiel findet in den folgenden Jahren dann und wann Nachahmung. Vom Anfang des 17. bis in das zweite Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts kommen endlich mehrere Perioden, wo diese Bestimmungen der Gesamtziffer seit der Gründung alljährlich wiederholt werden: so 1600–1609, 1615–1671, 1681–1720, in welchem letzteren Jahr die Gesamtziffer glücklich auf 133 253 angewachsen ist. An eine Sonderung nach Nationen oder Fakultäten, an eine Ausscheidung der in diesen Zeiten nicht geringen Anzahl der Minorennen wird dabei durchaus nicht gedacht. Es ist offenbar nur die Freude an der großen Zahl, gleichgültig was sie bedeutet, von der man beseelt ist. Dies ist um so bezeichnender, als es zumeist die Zeiten des Tiefstandes der Studien an unserer Universität sind, z. B. die Zeiten während des Kriegs, wo die Zahl der in einem Semester Immatrikulierten etwa auf ein Dutzend herabsinkt oder nur durch die Hinzurechnung der Kinder auf eine respektable Höhe sich erhebt, in denen die Häupter der Hochschule in diesen statistisch wertlosen Gesamtziffern schwelgen. Vom Jahre 1720 an verschwinden diese Zählungen völlig. Niemand denkt aber überhaupt in diesen ganzen fünf Jahrhunderten bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts je einmal daran, die wirkliche Frequenz eines Semesters zu ermitteln oder wenigstens durch die Verzeichnung der Abgänge eine solche Ermittelung möglich zu machen. Bei diesem Mangel an Interesse ist daher vollends auf schätzungsweise Angaben gar kein Wert zu legen. Hier treibt die Lust an großen Zahlen, die sich bei jener Bestimmung der Gesamtziffer von 1409 an immerhin noch einer gewissen zwecklosen Nüchternheit befleißigt, ihr verwegenstes Spiel, und es kommt ihr gelegentlich wohl nicht darauf an, die Hunderte in Tausende zu verwandeln. Umgekehrt aber, wo je einmal auf Veranlassung eines Fürsten unternommen wurde – in Leipzig scheint ein solcher Fall nicht vorgekommen zu sein – die Zahl der anwesenden Akademiker wirklich zu zählen, da ist es nicht ausgeschlossen, daß die Beteiligten dies, ähnlich wie es so manchmal bei allgemeinen Volkszählungen oder andern statistischen Erhebungen geschah, als eine unbequeme und vielleicht sogar bedenkliche Zudringlichkeit empfanden, so daß nun in der umgekehrten Richtung mehr oder minder erhebliche Fehler sich einstellten. Zudem sind solche Zählungen so seltene Ereignisse, daß sie an und für sich allgemeine Schlüsse nicht zulassen.
So bleiben denn die Immatrikulationszahlen selbst in ihrem unmittelbaren Bestand schließlich das einzige hinreichend zuverlässige Hilfsmittel, um für die Bewegung innerhalb der Hochschulen einigermaßen quantitativ vergleichbare Resultate zu gewinnen. Diese unmittelbaren Matrikelzahlen bieten dabei immerhin zugleich die Möglichkeit, den Einfluß einzelner Bedingungen zu würdigen, die in jene Bewegung bestimmend eingreifen. Wir haben eben hier einen jener Fälle vor uns, wo die vergleichende singuläre Beobachtung wertvoller ist als die Massenbeobachtung, die die spezifischen Motive der Erscheinungen verschwinden läßt, ohne dafür durch irgendein eindeutiges Kollektivergebnis zu entschädigen.
Im Hinblick hierauf habe ich schon in den Jahren 1889/90 ein Verzeichnis der Immatrikulationsziffern der Leipziger Universität seit ihrem Gründungsjahre angelegt, und dasselbe ist seitdem in dankenswerter Weise von unserem Universitätssekretariat bis zur Gegenwart weitergeführt worden. Da sich die Leipziger Matrikel, die überdies in zwei Exemplaren vorhanden ist, durch lückenlose Vollständigkeit auszeichnet, so eignet sie sich schon aus diesem Grunde wohl vor andern zu einer solchen Einzelbetrachtung2). Für die Verhältnisse in den früheren Jahrhunderten ist aber Leipzig wegen der eigentümlichen Ausnahmestellung, die es durch seine lang bewährte Autonomie und durch sein zähes Festhalten an alten Traditionen einnimmt, für die Verhältnisse der älteren Hochschulorganisation und ihre Wirkungen wohl besonders lehrreich. Ich gebe zunächst auf der beiliegenden Kurventafel eine Übersicht über die Gesamtbewegung der Immatrikulationen während der fünf Jahrhunderte. Es sind in dieser Kurve, um sie nicht allzu umfangreich zu gestalten, je fünf Jahre zu einem Mittelwert zusammengefaßt. Dieser Zeitraum ist einerseits klein genug, um die verschiedenen, zeitweise besonders charakteristischen Schwankungen nicht verschwinden zu lassen, und anderseits groß genug, um ganz zufällige unregelmäßige Bewegungen auszuschalten3).
3) Nachdem das obige längst niedergeschrieben
war, erhielt ich die Bogen der zum Jubiläum verfaßten Schrift
von Prof. Franz Eulenburg über die Statistik unserer Universität,
in welcher auf S. 3 ebenfalls eine Kurve der Immatrikulationsbewegungen
von der Gründung an mitgeteilt ist. Da sich die folgenden Betrachtungen
zumeist in andern Richtungen als die Eulenburgs bewegen, zum Verständnis
derselben aber ein Gesamtbild der Immatrikalationsbewegung erforderlich
ist, so teile ich trotzdem die, wie eben bemerkt, schon vor zwanzig Jahren
entworfene Kurve mit, die sich übrigens, im Unterschied von der Eulenburgs,
nicht bloß bis 1830, sondern bis 1908 erstreckt.
Jene beiden Perioden des annähernd gleichförmigen Verlaufs der Immatrikulationsfrequenz, deren eine der Gründung unmittelbar folgt und deren andere ungefähr mit dem 18. Jahrhundert einsetzt, umschließen nun aber einen mittleren, wesentlich dem 16. und 17. Jahrhundert angehörenden Verlauf, der sich nahezu symmetrisch in eine mit dem 16. beginnende aufsteigende und eine mit dem 17. zusammenfallende absteigende Hälfte teilt, beide voneinander geschieden durch eine tiefe, von einigen rasch vorübergehenden Erhebungen unterbrochene Senkung zwischen den Jahren 1618 und 1648, die also ziemlich genau der Zeit des großen Krieges entspricht. Eine Art Vorbereitung zu der ersten, aufsteigenden Periode bildet der um die Wende der beiden ersten Jahrhunderte liegende, etwa zwanzigjährige Zeitraum (1498–1518), der das Maximum des bis dahin von der Hochschule erreichten Zugangs bezeichnet und zugleich durch die während seiner Dauer gleichförmige Erhaltung des Zuflusses auffällt. Man wird nicht fehlgehen, wenn man diese erste Blütezeit weniger der Hochschule selbst als der günstigen Lage der Stadt zuschreibt, die in diesem Zeitraum mit besonderer Macht ihre Attraktionskraft ausübte. Hier war 1480 die erste Buchdruckerei errichtet worden, der bald andere folgten, hier waren im Jahre 1497 die drei großen Messen durch besondere kaiserliche Privilegien geschützt worden. Kein Wunder, daß in dieser rasch zu einem Zentralsitz des Büchermarktes sich entwickelnden Handelsstadt die studierende Jugend von allen Seiten zusammenströmte. Doch dieser erste Aufschwung dauert nicht lang. Von 1517 an beginnen die Immatrikulationen rapid zu fallen. Die reformatorische Bewegung zieht offenbar die wißbegierigen Scholaren nach dem nahen Wittenberg. Das Jahr der berühmten Disputation zwischen Luther und Eck 1519 bezeichnet den deutlichen Beginn dieses Niedergangs, der in den Jahren 1523 bis 1532 den größten Tiefstand erreicht. Von da an erhebt sich wieder die Kurve in der gewöhnlichen Form kleinerer periodischer Schwingungen, um bis zu einem abermaligen, alles Bisherige übertreffenden Maximum anzusteigen, das ungefähr mit dem Ende des 16. Jahrhunderts zusammenfällt. Es ist die Gewinnung jenes festen Besitzstandes unter Kurfürst Moritz (1541–53), der die Hochschule zur wohlhabendsten in Deutschland macht, und es ist zugleich der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung der sächsischen Lande unter Moritz und seinem Nachfolger August (1553–86), der diese Blüte erklärlich macht. Von den kriegerischen Ereignissen der Zeit, den Kämpfen der ernestinischen und albertinischen Linie, dem schmalkaldischen Krieg wird dieser Aufschwung nicht merklich berührt. Zugleich lehrt aber dieser Verlauf eindringlich, wie wenig man aus einem solchen äußeren Aufschwung auf die innere Blüte einer Hochschule schließen darf. Gerade die Jahre, in denen der Zustrom der Immatrikulierten jedes bis dahin erreichte Maß übersteigt, die Jahre 1617–1619, fallen in die Zeit wissenschaftlichen Verfalls und scholastischer Erstarrung, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einsetzt und im folgenden den großen Krieg überdauert. Schon beginnt aber hier eine andere Erscheinung hervorzutreten, die zum Teil in dieser und noch mehr in der folgenden Periode die Bedeutung der Immatrikulationsziffern in Frage stellt: das ist die Inskription der Minderjährigen, auf die wir unten zurückkommen werden.
Zwischen dem ersten aufsteigenden Teil dieses mittleren Verlaufs der Immatrikulationskurve und dem zweiten absteigenden, der dem 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts angehört, liegt nun als ein tief einschneidender Niedergang die Zeit des 30jährigen Kriegs. Sie bildet keinen gleichförmigen Tiefstand, sondern ist in unserer Kurve durch zwei starke, wenn auch nur sehr kurz dauernde Erhebungen unterbrochen. Sie fallen bemerkenswerterweise nicht etwa mit Zeiten des Nachlasses der Kriegswirren, sondern umgekehrt mit solchen Zeiten zusammen, in denen, wie zu Beginn des Kriegs und um die Jahre 1630 und folgende Mitteldeutschland und speziell Leipzig in besonderem Maße in Mitleidenschaft gezogen waren. Auch diese Erscheinung hängt, wie wir sehen werden, mit dem verstärkten Zustrom der Minderjährigen gerade in den Zeiten äußerster Gefährdung der persönlichen Sicherheit zusammen. Unmittelbar nach der Beendigung des Krieges setzt dann die zweite Hälfte dieses annähernd symmetrischen Kurvenverlaufs sofort mit dem Anstieg zu einem zweiten Maximum ein, welches etwa um 1679 erreicht wird und dessen Höhe abermals alle vorangegangenen Gipfelpunkte überragt: es ist wohl die natürliche Reaktion auf den vorangegangenen Verfall der gelehrten Studien, die sich hier äußert, ohne daß freilich auch diese Reaktion wieder mit einer besonderen Blütezeit der Universitätsstudien selbst verbunden wäre. Auch die Gründung der freier gerichteten neuen Hochschule in Halle unter der Mitwirkung der aus Leipzig vertriebenen großen Lehrer Thomasius und Francke hindert die Fortdauer dieses äußeren Aufschwungs nicht im geringsten. Erst der siebenjährige Krieg (1756 ff.), der besonders in seinem Beginn Sachsen stark in Mitleidenschaft setzte, macht sich durch eine tiefere Senkung bemerklich, die nun zugleich in die fernere, wieder in größerer Stetigkeit verlaufende Periode des endenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts übergeht. Zwei Unterperioden vermehrten Zustroms treten jetzt hervor. Die eine, etwas längere, von 1660 bis 1690 dauernd, steht wohl unter der Wirkung des um die Mitte des Jahrhunderts besonders in Leipzig herrschenden literarischen Lebens, das übrigens, wie es bei solchen geistigen Bewegungen nicht selten geschieht, auf den Zufluß zur Universität am stärksten da zu wirken begann, wo es selbst schon im Schwinden begriffen war. Das zweite viel kürzere Ansteigen gehört der Friedenszeit von 1820 bis 1848 an, in der wohl auf allen deutschen Universitäten der Zugang zum Studium zunahm. Ihm folgt dann in der Reaktionsperiode (von 1850–60) ein sehr gleichförmig anhaltender Rückgang, dem 1860–70 ein rasches und endlich von 1870 an jenes rapide Ansteigen folgt, an dem bekanntlich alle deutschen Universitäten, besonders aber die der Großstädte, teilgenommen haben. Kaum braucht darauf hingewiesen zu werden, wie von diesen Wandlungen der durch seine relative, wenn auch kurze Stabilität zwischen 1850 und 60 gekennzeichnete Rückgang in noch andern Erscheinungen der Reaktionszeit seine Parallelen findet: in dem uns aus der Lebensgeschichte hervorragender Persönlichkeiten bekannten Übergang zu praktischen Berufen, in dem Zuströmen der Jugend zu den technischen Hochschulen und zur kaufmännischen Laufbahn usw., Erscheinungen, mit denen wiederum das Aufkommen materialistischer und pessimistischer philosophischer Richtungen auf das engste zusammenhängt. Es ist, wie das hier der parallele Verlauf der Ordinaten zur Abszissenlinie sprechend andeutet, eine Zeit der Stagnation, in der sich mancherlei Künftiges vorbereitet, im ganzen aber eine skeptische Stimmung gegen den vorangegangenen übermächtigen Doktrinarismus vorwaltet, die, in die Reihen der Jugend vordringend, diese den praktischen und gewinnbringenden Beschäftigungen sich zuwenden läßt. Nicht minder bezeichnend ist es aber, wie der nun folgende politische Aufschwung dieses Bild völlig umkehrt und jenes Zuströmen zu den akademischen Studien veranlaßt, unter dessen überwältigendem Eindruck wir heute noch stehen.
Fassen wir schließlich die Ermittelungen über die Immatrikulationen der verschiedenen Perioden in einigen Zahlen zusammen, so ergibt sich zunächst als Gesamtzahl der Immatrikulierten in den fünf Jahrhunderten 1409–1908: 263 496.
Davon kommen:
auf das erste Jahrhundert (1409–1508): 30 275,
auf das zweite Jahrhundert (1509–1608): 38 092,
auf das dritte Jahrhundert (1609–1708): 59 493,
auf das vierte Jahrhundert (1709–1808): 38 606,
auf das fünfte Jahrhundert (1809–1908):
96 636.
Von der letzteren Zahl kommen:
auf die erste Hälfte (1809–1858): 17 451,
auf die zweite Hälfte (1859–1908): 79 679,
davon auf die Jahre 1870–1908: 72 054.
Diese Zahlen legen zusammen mit den bei der Betrachtung unserer Kurve hervortretenden Verhältnissen die Erwägung dreier Einflüsse nahe, von denen man im allgemeinen vermuten darf, daß ihnen eine allgemeinere Bedeutung zukomme. Der eine besteht in den Veränderungen der Volkszahl und des allgemeinen Wohlstandes, die wir, weil sie beide stets eng aneinander gebunden sind, hier zusammenfassen dürfen. Der zweite bezieht sich auf die Zusammensetzung der Zahl der Immatrikulierten aus verschiedenartigen Elementen, deren Beziehung zur Hochschule eine abweichende Bedeutung besitzen kann. Hierbei kommen namentlich die Verhältnisse der alten Hochschule in ihrer Verbindung des Studium generale und der politischen Korporation in Betracht. Als Einflüsse dritter Art treten hierzu endlich die Beziehungen zu andern Schulen, die teils das Studium auf der Universität vorbereiten, teils mit ihm in Konkurrenz stehen können.
Daß unter diesen drei Einflüssen der erste, das Wachstum der Bevölkerung und ihres Wohlstandes, zu Zeiten eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich nicht zu bezweifeln. Besonders an zwei Stellen in dem Gesamtverlauf unserer Kurve tritt das deutlich hervor: an dem starken Anstieg zu Ende des 16. Jahrhunderts und an dem rapiden, alle bisherigen Maße übersteigenden Wachstum von den Jahren 1860 und besonders von 1870 an. Aber daß dieses Moment in beiden Fällen das einzige sei, wird angesichts der zwischenliegenden Perioden in hohem Grade zweifelhaft. Hier zeigt insbesondere der enorme Anstieg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, daß der Zudrang zum Studium auch noch von Ursachen ganz anderer Art bestimmt sein kann. Wächst er doch in den entvölkerten und durch den vorangegangenen Krieg zum Teil in bittere Not geratenen Landen zuweilen zu einer Höhe an, die in den Zeiten des Wohlstandes lange nicht erreicht worden ist. Es mag eine Reihe von Ursachen sein, die hier im gleichen Sinne zusammenwirken: der Drang, die durch den Krieg gerissenen Lücken besonders in den gelehrten Berufen wieder auszufüllen, die unbegrenzte Möglichkeit des Fortkommens, die die freien Berufe dem Mittellosen bieten, endlich der durch natürliche Reaktion in einer kriegsmüden Bevölkerung erwachende Trieb nach den Künsten des Friedens. Welches unter diesen Motiven obwalten möge, sie alle sind von einem Wechselspiel der Affekte abhängig, in das die Bedingungen des materiellen Daseins nur durch die in Zeiten des Mangels besonders lebhaften Regungen der Hoffnung und Sorge eingreifen. Nach dem großen Krieg mag der völlig besitzlose, auf gut Glück in die Welt ziehende Schüler am ehesten noch hoffen, unter dem Schutz der Kirche oder des Staats sein Glück zu finden.
Wie sehr übrigens Motive, die von solchen direkten Anreizungsmitteln zum gelehrten Studium weit abliegen, den Zufluß zur Hochschule bestimmen können, dafür bietet die ältere Zeit einen augenfälligen Beleg in jener Zuwanderung von Kindern, die in manchen Jahren die Immatrikulationsziffern völlig illusorisch machen können. Bilden doch diese Kinder, die gerade in der Zeit ihres stärksten Zustroms offenbar nur in einem höchst äußerlichen Verband zur Hochschule stehen, zeitweise die große Majorität der Inskribierten, während diejenigen, die nach ihrem Lebensalter wirklich studiert haben können, beinahe verschwinden, so daß während ganzer Semester ein völliger Stillstand des Studiums eingetreten sein muß. Wahrscheinlich ist in Leipzig der Zustrom der Minorennen stärker als irgendwo sonst, woran teils die Lage in einem besonders häufig vom Krieg heimgesuchten Gebiet, teils auch die alte korporative Selbständigkeit der Universität beigetragen haben mag. Infolge dessen bietet nun aber das Album unserer Hochschule wohl auch die günstigste Gelegenheit, diese Erscheinung in ihrem Zusammenhang mit äußeren Bedingungen zu verfolgen. Zwei Erklärungen sind es, die man im allgemeinen für jenes Zuströmen der Minorennen zu geben versucht hat. Nach der einen, wohl verbreitetsten ist es eine unmittelbare Folge der reformatorischen Bewegung, die durch die Aufhebung zahlreicher Dom- und Klosterschulen die Zöglinge des höheren Studiums gewissermaßen obdachlos gemacht und sie gezwungen habe, schon vor der Grenze, wo sie das schwurfähige Alter erreicht, als das in der Regel das 14. Lebensjahr galt, die Universität aufzusuchen. Doch, mag auch hierin teilweise jenes Phänomen begründet sein, ganz gibt es darüber keine Rechenschaft. Denn abgesehen davon, daß gerade im Reformationszeitalter die von einzelnen Humanisten gegründeten Lateinschulen hier einen Ersatz schufen, sind es durchaus nicht die Zeiten, wo unmittelbar nach der Säkularisation der Kirchengüter die im höheren Unterricht gerissenen Lücken am stärksten fühlbar werden mußten, sondern es sind die späteren, in denen jene Lücken allmählich wieder ausgefüllt wurden, wo der Strom der Kinder zur Hochschule am stärksten wird. Noch weniger haltbar ist wohl die zweite Erklärung: nach ihr sei die vorzeitige Immatrikulation eine Maßregel gewesen, durch die der künftige Student den Quälereien des sogenannten "Pennalismus" entgehen wollte, jenen scherzhaften Bräuchen gegenüber den Neulingen, von denen sich spärliche Reste noch in unsere heutigen Studentenverbindungen gerettet haben, und die in der barbarischen Sitte des 16. Jahrhunderts bisweilen zu lebensgefährlichen Mißhandlungen ausarteten4). Abgesehen davon, daß es sehr zweifelhaft ist, ob der in absentia Immatrikulierte damit den tollen Begrüßungszeremonien entgehen konnte, wenn er wirklich eintraf und nachträglich seinen Schwur leistete, dieser Erklärung widersprechen auch die sonstigen Verhältnisse. Für die Zeiten hoher Frequenz zu Ende des 16. Jahrhunderts konnte sie bei Einzelnen, die sich auf diese Weise gewissermaßen unbemerkt in die Korporation einschleichen wollten, allenfalls zutreffen, für die ersten Jahrzehnte des 17., wo der größte Strom der Minorennen zu Zeiten mit dem Mindeststand sonstiger Inskriptionen zusammenfällt, ist dieses Motiv ausgeschlossen. Wie sollte das Dutzend älterer Studenten, das in den schwersten Kriegswochen wo möglich selber aus der Stadt geflohen war, durch seine rohen Willkommsspäße einen solchen Schrecken verbreitet haben, daß sich Hunderte von Kindern zur Immatrikulation drängten, und dies gerade dann, wenn die Bedrängnis durch die herankommenden Kriegshorden am größten war? Hier ist es ganz augenfällig, daß es die Universität als politische Korporation ist, bei der man Schutz sucht. Ob der Schutz ein sehr wirksamer gewesen sei, den diese privilegierte Korporation bot, kann man ja bezweifeln. Jedenfalls standen ihr aber seit ihrer Gründung verbriefte Rechte zur Seite, die ihre Mitglieder gegen die Aushebung zum Kriegsdienst schützten. Wurden solche Privilegien auch manchmal von werbenden und pressenden Führern der Landsknechte wenig geachtet, der ruhige Bürger griff zu jedem Mittel, das Aussicht auf Sicherstellung seiner Kinder gegen solche Vergewaltigung bot. Übrigens begegnet uns noch im folgenden 18. Jahrhundert in den Zeiten, wo in den deutschen Universitätsstädten die Werbetrommel gerührt wurde, die nämliche Erscheinung: für Halle wird sie durch ein Dekret Friedrich Wilhelms I. vom Jahre 1731 direkt bezeugt. In diesem Erlaß wird den Bürgern von Halle ausdrücklich verboten, ihre Kinder bei der Universität einschreiben zu lassen, um sie dadurch von der Werbung zu befreien5). Dazu war die Versicherungsprämie, die man in Gestalt der Inskriptionsgebühren an den Rektor zu zahlen hatte, mäßig genug; und die Universität selbst mochte sich in diesen knappen Zeiten, in denen die sonstigen regelmäßigen Einnahmen so oft ausblieben, diesen Nebenerwerb wohl gefallen lassen. Unsere Leipziger Matrikel bewahrt ein rührendes Zeugnis für den nicht geringen Wert, den die Rektoren in ihrer schweren Bedrängnis durch die Kriegsnot dieser Einnahmequelle beimaßen. Bis dahin hatte man in der Matrikel eines jeden Semesters zuerst die älteren Studenten, die "jurati", aufgeführt, und ihnen dann anhangsweise die Kinder als "non jurati" folgen lassen. Da entschloß sich ein Rektor, diese Ordnung umzukehren: er stellt die Schar der Kinder voran und läßt ihnen das bescheidene Häuflein derer, die den Schwur geleistet, folgen. Dies ist dann mehrere Jahre auch von den folgenden Rektoren beibehalten worden, bis die unverhältnismäßige Zuwanderung der Kinder wieder normaleren Verhältnissen Platz gemacht hatte.
5) W. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität
zu Halle. 1894. l, S. 349.
Im Gegensatze zu diesem Schutz, den die korporative Selbständigkeit der Hochschulen gewährt, und der sich seiner Natur nach nur als ein vorübergehender und von dem Stadium als solchem gänzlich unabhängiger geltend macht, ist nun umgekehrt der dritte der oben erwähnten äußeren Einflüsse, das Verhältnis zu andern teils vorbereitenden, teils in Konkurrenz mit der Universität tretenden Schulen, durchweg ein dauernderer. Auch ist er nur dem Studium als solchem zugewandt, unabhängig von dem korporativen Charakter der Universität. In zwei einander entgegengesetzten Erscheinungen sehen wir ihn hervortreten: einerseits in dem relativ niedrigen Stand der Immatrikulationen im 18. und im Anfang des 19. Jahrhunderts; und anderseits in dem gewaltigen Aufschwung, den der Zugang zu den Studien im letzten Drittel des verflossenen Jahrhunderts genommen hat. Sicherlich würde man fehlgehen, wollte man annehmen, im Jahrhundert der Aufklärung sei die Neigung zu den gelehrten Studien selbst gegenüber dem vorangegangenen des großen Krieges geringer geworden. Vielmehr ist es wohl ein entgegengesetztes Motiv, das wir hier zur Wirkung gelangen sehen. Es ist die in dieser Zeit eintretende starke Zunahme der gelehrten Mittelschulen, die die Universitäten mehr und mehr entlasten, indem sie die Vorbereitung zu ihnen übernehmen. Blieb auch der Zugang zur Hochschule noch lange ein ungeregelter, so bildete sich doch im Anschluß an jene Vorbereitungsschulen von selbst die Gewohnheit aus, erst nach der Absolvierung eines Gymnasiums oder Pädagogiums zur Universität überzugehen. Dadurch verteilte sich aber nicht nur die Zahl der Aspiranten gelehrter Berufe auf eine größere Reihe von Jahren, sondern die größere Zahl jener, die aus irgend welchen Gründen die herkömmliche Gelehrtenlaufbahn frühzeitig unterbrachen, um in andere Berufe überzugehen, fiel nun der Gymnasial-, nicht der Universitätszeit zu. Dem gegenüber bietet endlich das enorme Anwachsen der Studierenden auf allen deutschen Hochschulen seit 1870 wiederum einen interessanten Beleg dafür, daß, wo die Erscheinungen unter einem so komplizierten Zusammenfluß äußerer und innerer Bedingungen stehen wie hier, übereinstimmenden Ursachen unter abgeänderten Umständen entgegengesetzte Wirkungen folgen können. Die Zahl der Mittelschulen, die ein Jahrhundert vorher den Zugang zur Universität zum Teil gehemmt hatten, ist seit 1870 enorm gewachsen, namentlich indem zugleich der Kreis dieser Schulen sich erweiterte. Aber jetzt hat im Gegenteil diese wachsende Möglichkeit einer Vorbereitung zur Hochschule einen der wichtigsten Faktoren gebildet, die sich an der Entstehung des neuesten Aufschwungs der Universitätsstudien beteiligten. Einen solchen Faktor bildet die Zunahme der Mittelschulen und ihrer zur Vorbereitung auf die Universität berechtigenden Gattungen in doppelter Weise: einmal insofern, als nach den neueren Studienordnungen die erweiterte Berechtigung eine unmittelbare Vorbedingung für den gesteigerten Zugang bildet, und sodann dadurch, daß die nach Zahl und Art vermehrten Vorbereitungsschulen zugleich ebenso viele Reize ausüben, die zahlreiche Bevölkerungselemente zu dem gelehrten Studium hinüberziehen, denen dies zuvor unmöglich oder sehr erschwert gewesen war. So sind hier die wachsende Zahl der Mittelschulen, der weitere Umfang und die größere Mannigfaltigkeit ihrer Formen und endlich der ungeheure Zudrang zur Hochschule Parallelerscheinungen, in denen ein über immer weitere Kreise des deutschen Volkes sich ausbreitendes Streben zum Ausdruck gelangt: das Streben nach höherer Bildung und nach einer durch sie vermittelten Hebung der gesellschaftlichen Stellung.