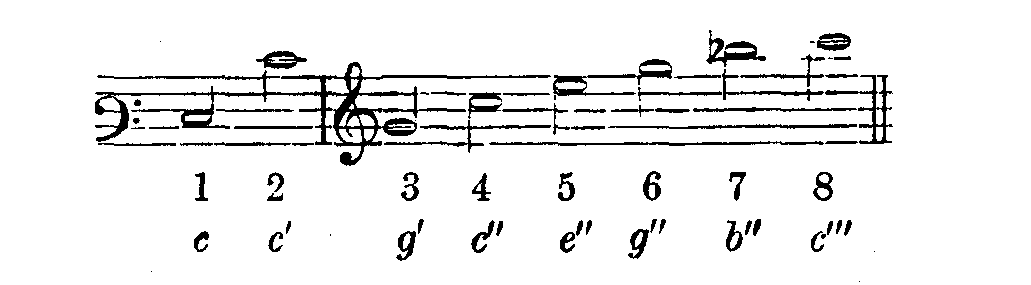
Von der Zerlegung der Klänge durch das Ohr.
Es ist in den vorausgehenden Abschnitten schon mehrfach erwähnt worden, daß musikalische Klänge auch durch das menschliche Ohr allein, ohne daß irgend welche Unterstützung durch besondere Apparate nötig wäre, in eine Reihe von Partialtönen zerlegt werden, die den einfachen pendelartigen Schwingungen der Luftmasse entsprechen, also in dieselben Bestandteile, in welche die Bewegung der Luft auch durch mittönende elastische Körper zerlegt wird. Wir gehen jetzt daran, die Richtigkeit dieser Behauptung zu erweisen.
Jemand, der zum ersten Male sich bemüht die Obertöne musikalischer Klänge aufzusuchen, wird gewöhnlich beträchtliche Schwierigkeit finden sie überhaupt auch nur zu hören.
Die Analyse unserer Sinnesempfindungen, wenn sie sich nicht entsprechenden Unterschieden der äußeren Objekte anschließen kann, stößt auf eigentümliche Hindernisse, deren Natur und Bedeutung wir weiter unten näher besprechen werden. Es muß in der Regel die Aufmerksamkeit des Beobachters durch besondere, passend gewählte Hilfsmittel auf die wahrzunehmende Erscheinung hingeleitet werden, bis er sie genau kennt; nachdem dies gelungen ist, kann er dann später jeder Unterstützung entbehren. Ähnliche Schwierigkeiten treten auch der Beobachtung der Obertöne eines Klanges entgegen. Ich lasse hier zunächst die Beschreibung solcher Verfahrungsweisen folgen, mittels deren es einem ungeübten Beobachter am leichtesten ist die Obertöne zuerst kennen zu lernen. Ich bemerke dabei, daß ein musikalisch geübtes Ohr die Obertöne nicht notwendig leichter und sicherer hört, als ein ungeübtes. Es kommt hier viel mehr auf eine gewisse Abstraktionskraft des Geistes an, auf eine gewisse Herrschaft über die Aufmerksamkeit, als auf musikalische Übung. Doch hat ein musikalisch geübter Beobachter darin einen wesentlichen Vorzug vor dem ungeübten, daß er sich leicht vorstellt, wie die Töne klingen müssen, welche er sucht, während der Ungeübte sich diese Töne immer wieder angeben muß, um ihren Klang frisch in der Erinnerung zu haben.
Zunächst ist zu bemerken, daß man in der Regel die ungeradzahligen Partialtöne, also die Quinten, Terzen, Septimen u. s. w. des Grundtons leichter hört, als die geradzahligen, welche Oktaven entweder des Grundtons oder anderer tieferer Partialtöne sind, wie man auch in einem Akkorde leichter hört, ob Quinten und Terzen darin sind, als Oktaven. Der zweite, vierte und achte Partialton sind höhere Oktaven des Grundtons, der sechste eine höhere Oktave des dritten, der Duodecime; diese zu unterscheiden erfordert schon einige Übung. Unter den ungeradzahligen, welche leichter zu hören sind, steht durch ihre Stärke meistens voran der dritte Ton, die Duodecime des Grundtons oder Quinte seiner ersten höheren Oktave, dann folgt der fünfte Partialton als Terz und meist schon sehr schwach der siebente als kleine Septime der zweiten höheren Oktave des Grundtons, wie das folgende Notenbeispiel zeigt, welches die Partialtöne des Klanges c angibt:
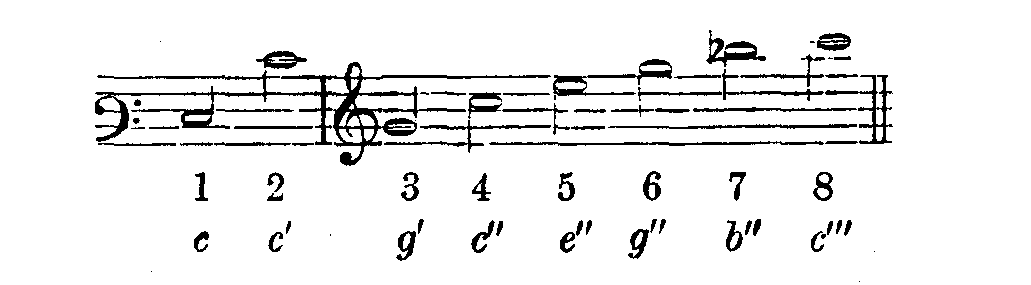
Man schlage auf einem Klaviere zuerst das g' des obigen Notenbeispiels an, und indem man die Taste g' sinken läßt, so daß deren Saiten nicht mehr fortklingen können, gleich darauf kräftig die Note c, in deren Klange g' der dritte Partialton ist, und halte die Aufmerksamkeit fest gerichtet auf die Tonhöhe des eben gehörten g', so wird man diesen Ton nun auch aus dem Klange c heraushören. Ebenso wenn man zuerst ganz leise den fünften Ton e", dann c anschlägt. Oft werden diese Obertöne deutlicher, wenn man die Saite ausklingen läßt, indem sie, wie es scheint, langsamer an Stärke abnehmen, als der Grundton. Der siebente und neunte Partialton b" und d'" sind auf den Klavieren von neuerer Konstruktion meist schwach oder gar nicht vorhanden. Stellt man dieselben Versuche am Harmonium an, namentlich an einem seiner schärferen Register, so hört man den siebenten Ton meist noch gut, auch wohl den neunten.
Um den oft gehörten Einwand zu widerlegen, daß der Beobachter sich nur einbilde, den Oberton in der Klangmasse zu hören, weil er ihn kurz vorher isoliert gehört hat, will ich hier nur anführen, daß wenn man an einem gut nach gleichschwebender Temperatur gestimmten Klaviere das e" erst als Partialton von c hört, dann direkt anschlägt, man ganz deutlich hören kann, daß es im letzteren Falle etwas höher ist. Das ist Folge der Stimmung nach gleichschwebender Temperatur: Da also ein Unterschied der Tonhöhe zwischen beiden Tönen erkannt wird, ist sicherlich der eine nicht Fortsetzung im Ohre oder Erinnerung des anderen. Andere Tatsachen, welche dieselbe Meinung vollständig widerlegen, folgen später.
Noch geeigneter als das beschriebene Verfahren am Klaviere ist es, an irgend einem beliebigen Saiteninstrumente, Klavier, Monochord, Violine, den Ton, welchen man zu hören wünscht, zuerst als Flageoletton der Saite hervorzubringen, indem man diese anschlägt oder streicht, während man einen Knotenpunkt des betreffenden Tons auf der Saite berührt. Dadurch wird die Ähnlichkeit des zuerst gehörten Tons mit dem entsprechenden Teiltone der Klangmasse noch größer, und das Ohr findet deshalb letzteren leichter heraus. An den Monochorden pflegt sich ein geteilter Maßstab neben der Saite zu befinden, mit dessen Hilfe man die Lage der Knotenpunkte leicht berechnen kann. Die Knotenpunkte für den dritten Ton teilen, wie schon im vorigen Abschnitt bemerkt ist, die Saite in drei gleiche Teile, die für den fünften in fünf u. s. w. Am Klavier und an der Violine findet man die Lage dieser Punkte leicht durch den Versuch, indem man die Saite in der Nähe des gesuchten Knotenpunktes, dessen Lage man ja nach dem Augenmaße annähernd bestimmen kann, leise mit dem Finder berührt, dann die Saite anschlägt oder streicht, und den Finger so lange hin- und herschiebt, bis der verlangte Flageoletton kräftig und rein klingend zum Vorschein kommt. Indem man nun die Saite zum Tönen bringt bald mit Berührung des Knotenpunktes, bald ohne solche Berührung, bekommt man bald den gesuchten Oberton allein als Flageoletton, bald die ganze Klangmasse der Saite, und erkennt verhältnismäßig leicht, daß auch in dieser der betreffende Oberton enthalten ist. Bei dünnen Saiten, welche die hohen Obertöne stark geben, ist es mir auf diese Weise gelungen, die Obertöne bis zum sechszehnten hinauf einzeln zu erkennen. Die noch höheren Obertöne kommen zu nahe an einander zu liegen, als daß sie das Ohr noch leicht von einander scheiden könnte.
Namentlich empfehle ich bei solchen Versuchen folgendes Verfahren. Man berühre den Knotenpunkt der Saite am Klavier oder Monochord mit den Haaren eines kleinen Malerpinsels, schlage an, und entferne unmittelbar danach auch den Pinsel von der Saite. Hat man den Pinsel fest an die Saite gelegt, so hört man entweder allein den betreffenden Oberton als Flageoletton, oder doch den Grundton nur schwach daneben. Wiederholt man nun den Anschlag der Saite, indem man die Berührung des Pinsels immer leiser und leiser macht, und zuletzt den Pinsel ganz entfernt, so wird neben dem Obertone auch der Grundton der Saite mehr und mehr hörbar, bis man zuletzt den vollen natürlichen Klang der freien Saite hat. Dadurch gewinnt man eine Reihe allmäliger Übergänge zwischen dem isolierten Obertone und dem zusammengesetzten Klange, in welchen der erstere leicht vom Ohre festgehalten wird. Durch dieses zuletzt beschriebene Verfahren ist es mir meist gelungen, auch ganz ungeübten Hörern die Existenz der Obertöne zu demonstrieren.
Schwerer als an Saiteninstrumenten, am Harmonium und an den schärferen Registern der Orgel ist es im Anfang die Obertöne der meisten Blasinstrumente und der menschlichen Stimme wahrzunehmen, weil man hier nicht so bequem den Oberton in gleichartiger Klangfarbe schwach vorher hören lassen kann. Doch gelingt es bei einiger Übung bald, mittels eines Klaviertons das Ohr auf den Oberton hinzuleiten, den es hören soll. Verhältnismäßig am schwersten zu isolieren sind die Partialtöne der menschlichen Stimme ans später anzuführenden Gründen. Übrigens sind die Obertöne der Stimme schon von Rameau1) unterschieden worden, und zwar ohne alle künstliche Unterstützung. Man verfahre folgendermaßen: Eine Baßstimme lasse man die Note es aushalten, und zwar auf den Vokal O ; man schlage schwach das b' des Klaviers, als dritten Partialton der Note es, an und lasse es verklingen, während man aufmerksam darauf hin hört. Scheinbar wird die Note b' des Klaviers nicht verklingen, sondern anhalten, auch wenn man zuletzt die Taste losläßt, indem das Ohr unvermerkt von dem Tone des Klaviers hinübergleitet auf den gleichlautenden Partialton des Sängers, und diesen für die Fortsetzung des Klaviertons hält Aber sobald die Taste losgelassen ist, und der Dämpfer auf der Saite liegt, ist es unmöglich, daß diese noch weiter töne. Will man den entsprechenden Versuch für den fünften Oberton von es, nämlich g'', machen, so ist es besser, wenn der Sänger den Vokal A wählt.
1) Nouveau Système de Musique théorique.
Paris 1726. Préface.
Ein anderes sehr gutes Mittel zu diesem Zwecke, welches für die Klänge aller musikalischen Instrumente angewendet werden kann, geben die im vorigen Abschnitte beschriebenen Resonanzkugeln ab. Wenn man an das Ohr die Resonanzkugel setzt, welche irgend einem bestimmten Obertone, z. B. g' des Klanges c, entspricht, und dann den Klang c angibt, so hört man das g' durch die Kugel um Vieles verstärkt. Daß man in diesem Falle das g' hört und unterscheidet, beweist nun noch nicht, daß das Ohr an und für sich ohne Hilfe der mittönenden Kugel den Ton g' im Klange c hören würde. Aber wohl kann man diese Verstärkung durch die Kugel benutzen, um das Ohr auf den Ton, den es hören soll, aufmerksam zu machen. Wenn man nachher die Kugel allmählig wieder vom Ohre entfernt, so wird das g schwächer; indessen die Aufmerksamkeit, welche einmal darauf gerichtet worden ist, bleibt nun leichter an diesen Ton gefesselt, und der Beobachter hört diesen Ton nun auch in dem natürlichen unveränderten Klange der angegebenen Note mit nicht unterstütztem Ohre. Es soll also die Resonanzkugel hierbei nur dazu dienen, das Ohr aufmerksam zu machen auf den Ton, den es hören soll.
Jemand, der oft dergleichen Versuche anstellt um die Obertöne zu hören, lernt sie immer leichter finden, endlich auch, ohne daß er irgend ein besonderes Hilfsmittel anwendet. Doch ist immer eine gewisse ungestörte Konzentration der Aufmerksamkeit nötig, um die Analyse der Klänge durch das Ohr allein auszuführen, und es ist deshalb ohne Hilfe der Resonanzröhren doch nicht möglich, mit dem Ohr allein eine genaue Vergleichung verschiedener Klangfarben zu vollenden, namentlich nicht in Beziehung auf die schwächeren Obertöne. Wenigstens muß ich gestehen, daß meine eigenen Versuche, die Obertöne der menschlichen Stimme aufzusuchen und ihre Unterschiede für die verschiedenen Vokale festzustellen, ziemlich ungenügend geblieben sind, bis ich die Resonatoren zu Hilfe nahm.
Wir gehen jetzt dazu über zu beweisen, daß das menschliche Ohr die Klänge wirklich nach dem Gesetze der einfachen Schwingungen zerlegt. Da die Stärke der Empfindung verschiedener Töne nicht genau genug verglichen werden kann, müssen wir uns darauf beschränken nachzuweisen, daß, wenn bei der Zerlegung der Klangmasse in einfache Schwingungen, wie sie durch die theoretische Berechnung oder das Mittönen zu Stande gebracht wird, einzelne Obertöne fehlen, das Ohr solche Obertöne ebenfalls nicht wahrnimmt.
Am geeignetsten für diese Beweisführung sind wieder die Klänge
der Saiten, weil sie, je nach der Art der Erregung und der Stelle, welche
erregt wird, mannigfache Abänderungen der Klangfarbe zulassen, und
weil für diese Klänge auch die theoretische oder experimentelle
Zerlegung am leichtesten und vollständigsten ausgeführt werden
kann. Es hat zuerst Thomas Young2) nachgewiesen, daß
wenn man eine Saite zupft oder schlägt oder, wie wir hinzufügen
können, streicht in einem solchen Punkte ihrer Länge, welcher
Knotenpunkt irgend eines ihrer Flageolettöne ist, daß dann diejenigen
einfachen Schwingungsformen der Saite, welche in dem angegriffenen Punkte
einen Knoten haben, in der Gesamtbewegung der Saite nicht enthalten sind.
Greifen wir also eine Saite gerade in der Mitte ihrer Länge an, so
fehlen alle den geradzahligen Partialtönen entsprechenden einfachen
Schwingungen, weil alle diese in der Mitte der Saite einen Knotenpunkt
haben. Es gibt dies einen eigentümlich hohlen oder näselnden
Klang der Saite. Greifen wir die Saite in 1/3 ihrer
Länge an, so fehlen die Schwingungen, die dem dritten, sechsten, neunten
Teilton entsprechen; greifen wir in 1/4 ihrer Lange
an, so fehlen die des vierten, achten, zwölften Teiltons u. s. w.
3).
3) Siehe Beilage Nro. III.
Wenn man in 1/3 oder 2/3 der Länge der Saite c den Finger anlegt und die Taste anschlägt, hört man den Flageoletton g'; ist der Dämpfer von der Saite g' gehoben, so klingt diese nach. Reißt man nun die Saite c mit dem Nagel an derselben Stelle in 1/3 oder 2/3 ihrer Länge, so tönt das g' nicht nach; wohl aber wenn man die Saite c an irgend einer anderen Stelle ihrer Länge mit dem Nagel reißt.
Ebenso erweist sich bei der Beobachtung mit Resonanzkugeln das c' in dem Klange der Saite c als fehlend, wenn man diese in ihrem Mittelpunkte gerissen hat, das g', wenn man sie in 1/3 oder 2/3 ihrer Länge gerissen hat. Die Analyse des Saitenklanges durch mittönende Saiten oder Resonatoren bestätigt also durchaus die von Thomas Young aufgestellte Regel.
Für die Saitenschwingungen haben wir aber noch eine direktere Art der Analyse, als die durch Mittönen. Wenn wir nämlich eine schwingende Saite leise mit dem Finger oder einem Haarpinsel für einen Augenblick berühren, so dämpfen wir alle diejenigen einfachen Schwingungen, welche in dem berührten Punkte der Saite keinen Knotenpunkt haben. Diejenigen Schwingungen aber, welche dort einen Knotenpunkt haben, werden nicht gedämpft und bleiben allein bestehen. Ist also eine Saite in irgend welcher Weise zum Tönen gebracht worden, und will ich wissen, ob die der Duodecime des Grundtons entsprechende Bewegung der Saite unter den einfachen Schwingungen vorhanden ist, aus denen die Gesamtbewegung der Saite zusammengesetzt zu denken ist, so brauche ich nur einen der Knotenpunkte dieser Schwingungsform in 1/3 oder 2/3 der Saitenlänge zu berühren; sogleich werden alle anderen Töne schweigen, und die Duodecime wird allein stehen bleiben, wenn sie vorhanden war. War sie aber nicht vorhanden, und auch keiner ihrer Obertöne, weder der sechste, neunte, zwölfte etc. Flageoletton der Saite, so wird nach der Berührung des Fingers absolutes Schweigen eintreten.
Man drücke auf die Taste einer Saite des Klaviers, um sie von ihrem Dämpfer zu befreien. Man zupfe die Saite in ihrer Mitte und berühre unmittelbar darauf dieselbe Stelle mit dem Finger, so wird die Saite vollständig schweigen, ein Beweis davon, daß das Zupfen in der Mitte keinen der geradzahligen Partialtöne des Saitenklanges hervorgebracht hat. Man zupfe in 1/3 und berühre unmittelbar nachher in 1/3 oder 2/3; die Saite wird wiederum schweigen, als Beweis, daß der dritte Partialton fehlte. Man zupfe an irgend einem anderen Punkte, als einem der genannten, so wird man den zweiten Partialton erhalten, wenn man die Saite in der Mitte berührt, den dritten, wenn man in 1/3 oder 2/3 ihrer Länge berührt.
Die Übereinstimmung dieser Art zu prüfen mit den Ergebnissen der Prüfung durch Mittönen ist zunächst wohl geeignet, auch experimentell den Satz festzustellen, den wir im vorigen Abschnitte nur durch die Ergebnisse der mathematischen Theorie gestützt hatten, daß nämlich das Mittönen eintrete oder nicht eintrete, je nachdem die entsprechenden einfachen Schwingungen in der zusammengesetzten Bewegung vorhanden seien oder nicht. Wir sind bei der letztbeschriebenen Art, einen Saitenton zu analysieren, ganz unabhängig von der Theorie des Mittönens, und die einfachen Schwingungen der Saiten sind eben durch ihre Knotenpunkte charakterisiert. durch diese erkennbar. Wenn beim Mittönen die Klänge zerlegt würden nach irgend welchen anderen Schwingungsformen als nach einfachen Schwingungen, so würde diese Übereinstimmung nicht stattfinden können.
Nachdem durch die beschriebenen experimentellen Prüfungen die Richtigkeit des von Thomas Young gefundenen Gesetzes festgestellt ist, bleibt uns nur noch übrig die Zerlegung der Saitenklänge durch das unbewaffnete Ohr vorzunehmen, um auch hier die völligste Übereinstimmung zu finden 4). Sobald wir die Saite in einem ihrer Knotenpunkte zupfen oder anschlagen, fallen diejenigen Obertöne des Saitenklanges, denen der genannte Knotenpunkt angehört, auch für das Ohr fort, während sie gehört werden, wenn man die Saite an irgend einer anderen Stelle zupft. Zupft man also z. B. die Saite c in 1/3 ihrer Länge, so hört man den Partialton g' nicht, zupft man sie nur wenig entfernt von dieser Stelle, so hört man ihn ganz deutlich. Das Ohr zerlegt also den Saitenklang genau in dieselben Bestandteile, wie er durch Mittönen zerlegt wird, also in einfache Töne nach Ohm's Definition dieses Begriffs. Auch diese Versuche können übrigens dazu dienen zu zeigen, daß es keine Täuschung der Phantasie ist, wenn man die Obertöne hört, wie Leute zuweilen glauben, welche sie zum ersten Male hören. Denn man hört sie eben nicht, wenn sie nicht da sind.
4) S. Brandt in Poggendorffs Annalen der Physik Bd. CXII, S. 324, wo diese Tatsache nachgewiesen ist.
Es ist dies Verfahren sogar besonders gut geeignet, um die Obertöne der Saiten hörbar zu machen, namentlich bei folgender Abänderung desselben. Man schlage zuerst in rhythmischer Folge abwechselnd den dritten und vierten Ton der Saite allein an, indem man diese dabei in den betreffenden Knotenpunkten dämpft, und bitte den Hörer, sich die Art einfacher Melodie zu merken, welche dadurch entsteht. Dann schlage man die Saite ohne Dämpfung abwechselnd und in derselben rhythmischen Folge in diesen Knotenpunkten an, und erzeuge so dieselbe Melodie in den Obertönen;. diese wird der Hörer jetzt leicht wiedererkennen. Natürlich muß man, um den dritten Ton zu haben, den Knotenpunkt des vierten anschlagen und umgekehrt.
Der Klang einer gezupften Saite ist übrigens noch merkwürdig als ein besonders auffallendes Beispiel, wie das Ohr eine Bewegung in eine lange Reihe von Partialtönen zerlegt, welche das Auge und die Vorstellung in viel einfacherer Weise aufzufassen vermögen. Eine Saite, welche durch einen spitzen Stift, oder mit dem Fingernagel zur Seite gezogen ist, hat, ehe sie losgelassen wird, die Form von Fig. 18A. Sie geht dann durch die Reihe der Formen Fig. 18 B, C, D, E, F über in die Form G, die Umkehrung von A, und dann ebenso wieder zurück. So schwankt sie hin und her zwischen den Formen A und G. Alle diese Formen sind, wie man sieht, aus drei geraden Linien zusammengesetzt, und wollte man die Geschwindigkeit der einzelnen Saitenpunkte durch Schwingungskurven ausdrücken, so würden diese ähnlich ausfallen. Unmittelbar überträgt nun die Saite kaum einen merklichen Teil ihrer Bewegung an die Luft; denn eine Saite, deren Enden auf zwei ganz unbeweglichen Unterlagen ruhen, z. B. auf metallenen Stegen, die an der Mauer des Zimmers befestigt sind, gibt kaum einen hörbaren Ton. Der Schall der Saite gelangt an die Luft vielmehr nur durch dasjenige ihrer Enden, welches mittels eines Steges auf einen nachgiebigen Resonanzboden gestützt ist. Der Klang der Saite hängt also auch wesentlich nur von der Bewegung dieses Endes ab, beziehlich von dem Drucke, den es auf den Resonanzboden ausübt. Wie die Größe dieses Druckes mit der Zeit periodisch wechselt, ist in Fig. 19 (a. f. S.) dargestellt. Die Linie hh soll der Höhe des Druckes entsprechen, welchen das Ende a der Saite, während sie ruht, auf den Steg ausübt. Längs hh denke man sich Längen abgetragen, die der fortlaufenden Zeit entsprechen, die vertikalen Höhen der gebrochenen Linie über oder unter hh stellen die den betreffenden Zeitpunkten entsprechenden Erhöhungen und Verminderungen des Druckes dar. Der Druck der Saite gegen den Resonanzboden wechselt also, wie die Figur es darstellt, zwischen einem höheren und einem niederen Werte. Eine Zeit lang herrscht der höhere Druck ohne sich zu ändern, dann tritt plötzlich der niedere ein, der dann ebenfalls eine gewisse Zeit lang unverändert anhält. Die Buchstaben a bis g, Fig. 19, entsprechen den Zeitpunkten der Saitenformen A bis G, Fig. 18. Dieser Wechsel zwischen einem höheren Druckgrade und einem niederen ist es, welcher den Schall in der Luftmasse hervorbringt. Man muß sich billig wundern, daß eine Bewegung, die durch ein so einfaches und leicht aufzufassendes Verhältnis erzeugt wird, vom Ohre in eine so komplizierte Summe von Partialtönen zerlegt wird. Für das Auge und den Begriff ist die Wirkung der Saite auf den Resonanzboden so außerordentlich einfach darzustellen. Was hat die einfache gebrochene Linie der Fig. 19 zu tun mit Wellenlinien, welche in der Ausdehnung einer ihrer Perioden 3,4,5 bis 16 und mehr Wellenberge und Täler zeigen? Es ist dies eines der schlagendsten Beispiele, wie verschieden Auge und Ohr eine periodische Bewegung auffassen.
Es gibt weiter keinen tönenden Körper, dessen Bewegungen unter abgeänderten Umständen wir so vollständig theoretisch berechnen und mit der Wirklichkeit vergleichen könnten, wie dies bei den Saiten der Fall ist. Beispiele, in denen sich die Theorie noch mit der Zerlegung durch das Ohr vergleichen läßt, sind folgende :
Ich habe eine Methode aufgefunden, durch welche es möglich ist
einfache pendelartige Schwingungen in der Luft zu erzeugen. Eine angeschlagene
Stimmgabel gibt keine harmonischen Obertöne, oder höchstens dann
Spuren davon, wenn sie in so übermäßig starke Schwingungen
versetzt ist, daß die Schwingung nicht mehr ganz genau nach dem Gesetze
des Pendels vor sich geht. Dagegen geben die Stimmgabeln sehr hohe unharmonische
Nebentöne, die das eigentümliche helle Klingen der Gabel im Augenblick
des Anschlagens hervorbringen, und nachher bei den meisten Gabeln schnell
erlöschen. Hält man die tönende Gabel zwischen den Fingern,
so geht sehr wenig von ihrem Tone an die Luft über, nur dicht vor
das Ohr gebracht hört man ihn. Statt sie in den Fingern zu halten,
kann man sie auch in ein festes dickes Brettchen einschrauben, auf dessen
untere Seite man als Polster einige Stücke von Kautschukröhren
geklebt hat. Stellt man ein solches Brettchen auf einen Tisch, so leiten
die Kautschukröhren, auf denen es steht, den Schall nicht an die Tischplatte
über, und man hört von dem Tone der Stimmgabel so gut wie nichts.
Nähert man nun den Zinken der Gabel eine Resonanzröhre5)
von flaschenförmiger Gestalt, deren Luftmasse angeblasen denselben
Ton gibt wie die Gabel, so gerät die Luft der Resonanzröhre in
Mitschwingen, und der Ton der Gabel wird dadurch in großer Stärke
auch an die äußere Luft übertragen. Nun sind die höheren
Nebentöne der Resonanzröhren ebenfalls unharmonisch zum Grundton,
und in der Regel werden die Nebentöne der Röhre weder den harmonischen
noch den unharmonischen Nebentönen der Gabeln entsprechen, was sich
übrigens auch in jedem einzelnen Falle genau kontrollieren läßt,
wenn man die Nebentöne der Röhren durch stärkeres Anblasen
und die der Stimmgabeln mit Hilfe mitschwingender Saiten, wie gleich beschrieben
werden soll, aufsucht. Wenn nun von den Tönen der Gabel nur ein einziger,
nämlich der Grundton, einem Tone der Röhre entspricht, so wird
auch nur dieser durch Mitschwingung verstärkt, und nur dieser wird
zur Luftmasse und zum Ohre des Beobachters geleitet. Die Untersuchung der
Luftbewegung durch die Resonatoren zeigt in diesem Falle, daß wirklich
bei nicht allzu starker Bewegung der Gabel jeder andere Ton neben dem Grundtone
fehlt, und auch das unbewaffnete Ohr hört in. solchem Falle nur einen
einzigen Ton, nämlich den gemeinsamen Grundton der Stimmgabel und
Röhre ohne begleitende Obertöne.
5) Entweder eine Flasche von passender Größe, die man durch Eingießen von Wasser oder Öl leicht genauer stimmen kann, oder eine Röhre von Pappe, die an einem Ende. ganz verschlossen ist, am anderen eine kleine runde Öffnung behält. S. Maße solcher Resonanzröhren in Beilage IV.
Noch in anderer Weise kann man den Ton einer Stimmgabel von Nebentönen reinigen, indem man sie nämlich mit ihrem Stiele auf eine Saite aufsetzt, und sie dem Stege der Saite so weit nähert, daß einer der eigenen Töne des Saitenstücks, welches zwischen der Gabel und dem Stege abgegrenzt ist, dem Stimmgabelton gleich wird. Dann gerät die Saite kräftig in Schwingung, und leitet den Ton der Stimmgabel in großer Stärke an ihren Resonanzboden und zur Luft, während man den Ton nur ganz schwach oder gar nicht hört, so lange das genannte Saitenstück nicht im Einklange ist mit dem Tone der Gabel. Auf diese Weise kann man leicht die Saitenlängen finden, welche dem Grundton und den Obertönen der Stimmgabel entsprechen, und so die Tonhöhe, namentlich der letzteren, genau bestimmen. Führt man diesen Versuch mit gewöhnlichen, in ihrer ganzen Länge gleichartigen Saiten aus, so hält man wohl die unharmonischen Nebentöne der Stimmgabel vom Ohre ab, aber nicht die zuweilen schwach vorhandenen harmonischen, welche bei starker Schwingung der Gabeln hörbar werden können. Will man daher diesen Versuch ausführen, um reine pendelartige Schwingungen der Luft zu erzeugen, so ist es vorteilhafter, einen Punkt der Saite etwas zu belasten, wenn auch nur durch ein angeschmolzenes Tröpfchen Siegellack. Dadurch werden die höheren Töne der Saite selbst unharmonisch zum Grundton, und es trennen sich auf der Saite die Punkte, wo man die Stimmgabel aufsetzen muß, um entweder ihren Grundton oder dessen höhere Oktave (wenn sie vorhanden ist) hörbar zu machen.
In den meisten anderen Fällen ist die mathematische Analyse der Schallbewegungen noch nicht so weit fortgeschritten, daß wir mit Sicherheit angeben könnten, welche Obertöne und wie stark sie da sein müssen. Bei den Kreisplatten und gespannten Membranen, welche angeschlagen sind, würde es theoretisch geben, aber deren unharmonische Nebentöne sind so zahlreich und liegen so nahe an einander, daß die meisten Beobachter an der Aufgabe sie zu trennen wohl scheitern möchten. Bei den elastischen Stäben dagegen liegen die Töne weit auseinander, sind unharmonisch und deshalb leicht einzeln mit dem Ohre zu erkennen. Die Töne eines an beiden Enden freien Stabes sind, wenn wir die Schwingungszahl des Grundtons mit l bezeichnen, und diesen Ton selbst mit c:
Erster Ton ..... 1,0000 c
Zweiter Ton .... 2,7576 fis' - 0,2
Dritter Ton ..... 5,4041 f" + 0,1
Vierter Ton ..... 13,3444 a'" - 0,1
Wo wir die theoretische Analyse der Bewegung nun auch nicht ausführen können, können wir doch immer mittels der Resonatoren und anderer mitschwingender Körper jeden einzelnen wahrgenommenen Klang zerlegen, und diese Zerlegung, welche durch die Gesetze des Mittönens bestimmt ist, vergleichen mit der des unbewaffneten Ohres. Das letztere ist natürlich viel weniger empfindlich als das mit dem Resonator bewaffnete, und es ist häufig nicht möglich Töne, die der Resonator schwach angibt, zwischen anderen stärkeren ohne Resonator zu erkennen. Dagegen findet, soweit meine Erfahrungen reichen, insofern vollständige Übereinstimmung statt, als das Ohr alle von den Resonatoren stark angegebenen Töne auch ohne sie wahrnimmt, und dagegen keinen Oberton empfindet, den der Resonator gar nicht angibt. Ich habe in dieser Beziehung namentlich mit menschlichen Stimmen und mit dem Harmonium viele Versuche angestellt, die alle die angegebene Regel bestätigen.
Durch die angegebenen Erfahrungen wird nun der von G. S. Ohm aufgestellte und verteidigte Satz als richtig erwiesen, daß das menschliche Ohr nur eine pendelartige Schwingung der Luft als einen einfachen Ton empfindet, und jede andere periodische Luftbewegung zerlegt in eine Reihe von pendelartigen Schwingungen, und die diesen entsprechende Reihe von Tönen empfindet.
Wenn wir also unserer früher gegebenen Definition gemäß die Empfindung, welche eine periodische Luftbewegung im Ohre erregt, mit dem Namen eines Klanges belegen, die Empfindung, welche eine einfache pendelartige Luftbewegung erregt, mit dem Namen eines Tones, so ist der Regel nach die Empfindung eines Klanges aus der Empfindung mehrerer Töne zusammengesetzt. Insbesondere werden wir nun als Klang bezeichnen den Schall, den ein einzelner tönender Körper hervorbringt, während der Schall, welcher von mehreren gleichzeitig erklingenden Instrumenten hervorgebracht wird, als Zusammenklang zu bezeichnen ist. Wenn also eine einzelne Note auf einem musikalischen Instrumente angegeben wird, sei es auf einer Violine, Trompete, Orgel oder von einer Singstimme, so ist sie in genauer Sprechweise als ein Klang der genannten Tonwerkzeuge zu bezeichnen. Die bisherige Ausdrucksweise, eine solche Note als einen Ton jener Instrumente zu bezeichnen, würde nur zulässig sein, wo man von der Zusammensetzung des Klanges absehen kann, und nur seinen Grundton berücksichtigen will. In der Tat ist meistenteils der Grundton stärker als die Obertöne, und man beurteilt nach ihm allein deshalb auch in der Regel die Tonhöhe des Klanges. Wirklich auf einen Ton reduziert sich der Klang einer Tonquelle nur in sehr wenigen Fällen, z. B. bei den Stimmgabeln, deren Ton durch eine Resonanzröhre in der beschriebenen Weise an die Luft übertragen wird, und außerdem ist der Klang weiter gedackter und schwach angeblasener Orgelpfeifen fast frei von Obertönen und nur von Luftgeräusch begleitet.
Es ist bekannt, daß diese Verbindung mehrerer Töne zu einem Klange, welche von der Natur in den Klängen der meisten musikalischen Instrumente hervorgebracht ist, auf den Orgeln auch künstlich durch besondere mechanische Vorrichtungen nachgeahmt wird. Die Klänge der Orgelpfeifen sind verhältnismäßig arm an Obertönen; wo es darauf ankommt ein Register von scharf durchdringender Klangfarbe und großer Gewalt der Tonstärke herzustellen, genügen die weiten Pfeifen (Principalregister und Weitgedackt) nicht, weil ihr Ton zu mild, zu arm an Obertönen ist, die engen (Geigenregister und Quintaten) nicht, weil ihr Ton zwar scharfer, aber auch schwächer ist. Für solche Gelegenheiten, namentlich um den Gesang der Gemeinde zu begleiten, dienen nun die Mixturregister. In diesen Registern ist jede Taste mit einer größeren oder kleineren Reihe von Pfeifen verbunden, die sie gleichzeitig öffnet, und welche den Grundton und eine gewisse Anzahl der ersten Obertöne des Klanges der betreffenden Note geben. Sehr gewöhnlich ist es, die höhere Oktave mit dem Grundtone zu verbinden, demnächst die Duodecime. Die zusammengesetzteren Mixturen (Cornett) geben die ersten sechs Partialtöne, also außer den ersten beiden Oktaven des Grundtons und der Duodecime auch noch die höhere Terz und die Oktave der Duodecime. Es ist dies die Reihe der Obertöne, soweit sie den Tönen des Durakkords angehören. Damit aber diese Mixturregister nicht unerträglich schreiend werden, ist es nötig, daß die tieferen Töne jeder Note noch durch andere Pfeifenreihen verstärkt werden; Denn in allen natürlichen und musikalisch brauchbaren Klängen nehmen die Teiltöne nach der Höhe hin an Stärke- ab. Dies muß bei ihrer Nachahmung mittels der Mixturen berücksichtigt werden. Die Mixturen waren der bisherigen musikalischen Theorie, welche nur von den Grundtönen der Klänge etwas weiß, ein Gräuel, doch zwang die Praxis der Orgelspieler und Orgelbauer sie beizubehalten, und zweckmäßig eingerichtet und richtig angewendet sind sie ein höchst wirksames musikalisches Hilfsmittel. Dabei ist ihre Anwendung durch die Natur der Sache vollkommen gerechtfertigt. Der Musiker muß sich alle Klänge aller musikalischen Instrumente ähnlich wie die eines Mixturregisters zusammengesetzt denken, und welche wesentliche Rolle diese Zusammensetzung auf die Konstruktion unserer Tonleitern und Akkorde hat, wird in den späteren Abteilungen dieses Buches klar werden.
Wir sind mit unserer Untersuchung hier zu einer Schätzung der Obertöne gelangt, welche von den bisherigen Ansichten der Musiker und auch wohl der Physiker ziemlich abweicht, und müssen deshalb widersprechenden Ansichten entgegentreten. Man hat die Obertöne wohl gekannt, aber fast nur in einzelnen Klangarten, namentlich denen der Saiten, wo die Gelegenheit günstig war, sie zu beobachten; sie erscheinen aber in den bisherigen physikalischen und musikalischen Werken als ein vereinzeltes, zufälliges Phänomen von geringer Intensität, eine Art von Kuriosem, welches man wohl gelegentlich anführte, um dadurch die Meinung einigermaßen zu stützen, daß die Natur schon die Konstruktion unseres Durakkords vorgebildet habe, welches im Ganzen aber doch ziemlich unbeachtet blieb. Dem gegenüber müssen wir behaupten, und werden es im nächsten Abschnitte nachweisen, daß die Obertöne ein allgemeiner Bestandteil fast aller Klange sind mit wenigen schon genannten Ausnahmen, und daß ein gewisser Reichtum derselben ein wesentliches Erfordernis einer guten musikalischen Klangfarbe ist. Endlich hat man sie fälschlich für schwach gehalten, weil sie schwer zu beobachten sind, während im Gegenteil in einigen der besten musikalischen Klangfarben die Stärke der unteren Obertöne der des Grundtons nicht viel nachgibt.
Von der letzteren Tatsache kann man sich wiederum an Saitenklängen leicht durch den Versuch überzeugen. Wenn man eine Saite eines Klaviers oder Monochords anschlägt, und unmittelbar nachher einen ihrer Knotenpunkte für einen Augenblick leicht mit dem Finger berührt, so bleibt der entsprechende Teilton, dessen Knotenpunkt berührt wurde, in unveränderter Stärke stehen, die übrigen Töne erlöschen. Man kann ebenso gut auch gleich während des Anschlages den Finger auf dem Knotenpunkte ruhen lassen, und erhält dann von vornherein nur den betreffenden Teilton statt des ganzen Klanges der Note. Auf beiderlei Wege kann man sich überzeugen, daß die ersten Obertöne, also namentlich die Oktave und Duodecime, keineswegs schwache und schwer zu hörende Töne sind, sondern eine sehr namhafte Stärke haben. In einigen Fällen lassen sich auch Zahlenwerte für die Stärke der Obertöne geben, wie der nächste Abschnitt zeigen wird. Für andere als Saitentöne ist der Nachweis nicht so leicht zu führen, weil man die Obertöne nicht isoliert ansprechen lassen kann; doch kann man dann immer noch mittels der Resonatoren erkennen, wie stark die Obertöne etwa sind, indem man die ihnen entsprechende Note auf demselben oder einem anderen Instrumente so stark angibt, daß sie dieselbe Stärke der Resonanz im Resonator hervorbringt.
Die Schwierigkeit, sie zu hören, ist kein Grund sie für schwach
zuhalten; denn diese Schwierigkeit hängt gar nicht von ihrer Stärke,
sondern von ganz anderen Umständen ab, welche erst durch die neueren
Fortschritte der Physiologie der Sinnesorgane in das rechte Licht gestellt
worden sind. An diese Schwierigkeit, die Obertöne wahrzunehmen, haben
sich Einwürfe geknüpft, welche A. Seebeck6)
gegen das von Ohm aufgestellte Gesetz der Klanganalyse vorgebracht
hat; und vielleicht möchten viele meiner Leser, die nicht mit der
Physiologie der anderen Sinnesorgane, namentlich des Auges, bekannt sind,
geneigt sein sich Seebeck's Meinungen anzuschließen. Ich muß
deshalb hier auf diesen Streit und die Eigentümlichkeiten unserer
sinnlichen Wahrnehmungen, von denen seine Entscheidung abhängt, näher
eingehen.
6) In Poggendorff's Annalen der Physik Bd. LX, S. 449, Bd. LXIII, S. 353 und 368. — Ohm, ebenda Bd. LIX, S. 513, Bd. LXII, S. l.
Seebeck, obgleich ein in akustischen Versuchen und Beobachtungen ausgezeichnet gewandter Forscher, war nicht immer im Stande gewesen, die Obertöne da zu erkennen, wo sie dem von Ohm aufgestellten Gesetze gemäß hätten vorhanden sein müssen. Aber, wie wir gleich hinzufügen müssen, er hat auch nicht die von uns vorher aufgeführten Methoden angewendet, um sein Ohr auf die fraglichen Obertöne hinzuleiten. Oder wenn er die Obertöne auch hörte, so erschienen sie ihm doch zu schwach, verglichen mit der Stärke, die sie theoretisch haben sollten. Er schloß daraus, daß die von Ohm aufgestellte Definition des einfachen Tones zu eng sei, daß nicht bloß pendelartige Schwingungen, sondern auch anders gestaltete, wenn ihre Form sich nur nicht allzuweit von der der pendelartigen Schwingungen unterscheide, im Stande seien im Ohre die Empfindung eines einzelnen Tones, aber von wechselnder Klangfarbe, hervorzurufen. Er behauptete deshalb, daß, wenn ein Klang aus mehreren einfachen Tönen zusammengesetzt sei, ein Teil der Tonstärke der Obertöne mit dem Grundtone verschmolzen werde und diesen verstärke, während höchstens ein kleiner Rest noch die Empfindung eines Obertons hervorbringe. Ein bestimmtes Gesetz darüber, welche Schwingungsformen den Eindruck eines einzelnen Tones, welche den eines zusammengesetzten geben müßten, hat er nicht aufgestellt. Die Versuche von Seebeck, auf welche er seine Behauptungen stützt, brauchen wir hier nicht näher zu beschreiben. Sie haben nur zum Zwecke Klänge herzustellen, in denen man die Stärke der einfachen Schwingungen, die den Obertönen entsprechen, entweder theoretisch berechnen kann, oder deren Obertöne man isoliert hörbar machen kann. Für den letzteren Zweck ist namentlich die Sirene benutzt worden; wir haben eben beschrieben, wie man dasselbe mittels der Saiten erreichen kann. Seebeck weist in den einzelnen Fällen nach, daß die einfachen Schwingungen, die den Obertönen entsprechen, eine namhafte Stärke haben, während doch die Obertöne in dem zusammengesetzten Klange gar nicht, oder schwer zu hören sein. Diese Tatsache haben wir selbst im Laufe dieses Abschnittes schon angeführt; sie kann für den einen Beobachter vollständig richtig sein, namentlich wenn er nicht die richtigen Mittel für die Beobachtung der Obertöne anwendet, während ein Anderer, oder auch jener Erste selbst bei besserer Unterstützung, die Obertöne vollkommen gut hört.
Es gibt nun mancherlei Hilfsmittel, durch welche wir unterstützt werden in dem Geschäfte, die Klänge verschiedener Tonquellen von einander zu sondern, dagegen die Partialtöne derselben Tonquelle zusammen zu halten. Wenn zu einem schon bestehenden Klange ein zweiter später hinzukommt, dann der zweite bestehen bleibt, während der erste aufhört, ist die Trennung schon durch die Zeitfolge erleichtert. Wir haben den ersten Klang einzeln kennen gelernt, und wissen deshalb gleich, was wir von dem eintretenden Zusammenklange auf Rechnung des ersten Klangs abzuziehen haben. Aber auch selbst, wenn in vielstimmiger Musik mehrere Stimmen sich in gleichem Rhythmus fortbewegen, ist die Ansatzweise der Klänge bei den verschiedenen Instrumenten und Stimmen, die Art ihrer Schwellung, die Sicherheit ihres Aushaltens, die Art, wie sie abklingen, meist ein wenig verschieden. Die Töne der Klaviere zum Beispiel setzen plötzlich mit einem Schlage ein, sind also im ersten Augenblicke am stärksten und nehmen dann schnell ab; die Töne der Blechinstrumente dagegen setzen schwerfällig ein, sie brauchen eine kleine merkliche Zeit um in voller Stärke sich zu entwickeln; die Klänge der Streichinstrumente zeichnen sich aus durch ihre außerordentlich große Beweglichkeit, aber wenn die Spielart oder das Instrument nicht sehr vollendet sind, so sind sie durch kleine, sehr kurze Pausen unterbrochen, die im Ohr das Gefühl des Kratzens hervorbringen, wie wir später bei der Analyse des Violinklanges noch näher beschreiben werden. Wenn dergleichen Instrumente also auch zusammengehen, so gibt es doch meist Zeiten, wo ein oder der andere Klang das Übergewicht hat, und deshalb vom Ohre leicht ausgesondert wird. Übrigens wird in guten vielstimmigen Kompositionen auch durchaus darauf Rücksicht genommen, dem Ohre die Trennung der Klänge zu erleichtern. In der eigentlich polyphonen Musik, wo jede einzelne Stimme ihre selbstständige Melodieführung hat, ist ein Hauptmittel, um den Gang der Stimmen klar zu erhalten, stets gewesen, daß man sie in verschiedenem Rhythmus und auf verschiedenen Taktteilen sich neben einander fortbewegen läßt; und wo dies gar nicht, oder nur in beschränkter Weise angeht, wie in den vierstimmig ausgesetzten Chorälen, ist es deshalb die alte Regel, wo möglich drei Stimmen sich nur um. eine Tonstufe fortbewegen zu lassen, während die vierte über mehrere wegspringt. Der geringe Wechsel in der Tonhöhe macht es dann dem Hörer leichter, die Identität der einzelnen Stimmen festzuhalten.
Bei der Zerlegung der Klänge in Teiltöne fällt dieses Hilfsmittel weg; wenn ein Klang einsetzt, setzen alle seine Teiltöne in gleicher Stärke ein, wenn er schwillt, schwellen sie meistens alle gleichmäßig, wenn er aufhört, hören alle zusammen auf. Es ist deshalb die Gelegenheit, diese Töne vereinzelt und selbstständig zu hören, meist abgeschnitten. Ganz ähnlich, wie die natürlich zusammengehörigen Partialtöne einer einzelnen Tonquelle, verschmelzen nun auch die Partialtöne in einem Mixturregister der Orgel, welche alle mit derselben Taste angeschlagen werden, und in gleicher Weise wie ihr Grundton sich in der Melodie fortbewegen.
Ferner sind die Klange der meisten Instrumente noch mit charakteristischen unregelmäßigen Geräuschen begleitet; ich erinnere an das Kratzen und Reiben des Violinbogens, das Sausen der Luft an Flöten und Orgelpfeifen, das Schnarren der Zungenwerke etc. Diese Geräusche erleichtern es ebenfalls sehr, die Klänge der einzelnen Instrumente, die wir als mit ihnen verbunden schon kennen, einzeln aus einer Klangmasse auszuscheiden. Den Teiltönen eines Klanges fehlt natürlich dieses Erkennungszeichen.
Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn die Auflösung der Klänge in Teiltöne für unser Ohr nicht ganz so leicht ist, als die Auflösung eines Zusammenklanges vieler Instrumente in seine nächsten Bestandteile, und daß selbst ein geübtes musikalisches Ohr einen ziemlich hohen Grad von Aufmerksamkeit anwenden muß, wenn es der erstgenannten Aufgabe sich unterzieht.
Auch ist leicht einzusehen, daß die genannten Unterstützungsmittel zu einer richtigen Trennung verschiedener Klange von einander nicht immer ausreichen werden, daß namentlich bei gleichmäßig anhaltenden Klängen, deren einer als ein Oberton des anderen betrachtet werden kann, das Urteil schwankend werden mag. Und in der Tat ist es so. Ein sehr belehrender Versuch ist darüber von G. S. Ohm angestellt worden, und zwar mit Klängen einer Violine. Viel zweckmäßiger ist es, diesen Versuch mit einfachen Tönen, z. B. denen einer gedackten Orgelpfeife, auszuführen. Am besten eignen sich dazu angeblasene Glasnaschen von der in Fig. 20 dargestellten Form, die man sich leicht herstellen und dem Versuche anpassen kann. An der Flasche ist mittelst des Stäbchens c ein Rohr a von Guttapercha in passender Lage befestigt. Die der Flasche zugekehrte Mündung des Rohres ist vorher in warmem Wasser erweicht, und platt gedrückt worden, so daß sie einen schmalen Spalt darstellt, aus welchem die Luft über die Mündung der Flasche hinströmt. Wird das Rohr durch einen Gummischlauch mit einem Blasebalge verbunden, und die Flasche angeblasen, so gibt sie einen dumpfen, dem Vokal U ähnlichen Ton, welcher noch freier von Obertönen als der Ton einer gedackten Pfeife ist, nur von wenig Luftgeräusch begleitet. Die Tonhöhe, finde ich, ist bei kleinen Änderungen der Windstärke leichter konstant zu halten, als bei den gedackten Pfeifen. Man macht solche Flaschen tiefer, wenn man ihre Mündung durch eine aufgelegte kleine Holzplatte zum Teil deckt, man macht sie höher, wenn man Öl oder geschmolzenes Wachs hineingießt, und kann dadurch leicht kleine Änderungen ihrer Stimmung, wie man sie wünscht, hervorbringen. Ich hatte eine größere auf b, eine kleinere auf b’ gestimmt, und verband sie beide mit demselben Blasebalge, so daß beim Gebrauch des Balges beide zugleich ansprachen. Beide in dieser Weise verbunden, gaben einen Klang von der Tonhöhe 6 der tieferen unter ihnen, aber von der Klangfarbe des Vokals O. Wenn ich dann bald den einen, bald den anderen Kautschukschlauch zudrückte, so daß ich nach einander die beiden Töne einzeln hörte, war ich im Stande, sie auch in ihrer Vereinigung wohl noch einzeln zu erkennen, aber nicht für lange Zeit; allmälig verschmolz wieder der höhere mit dem tieferen. Diese Verschmelzung tritt sogar ein, wenn der höhere Ton etwas stärker als der tiefere ist. Bei dieser allmälig eintretenden Verschmelzung ist nun die Änderung der Klangfarbe charakteristisch. Wenn man erst den hohen Ton angegeben hat, dann den tieferen hinzukommen läßt, hört man anfangs, wie ich finde, den höheren Ton noch in seiner ganzen Stärke weiter; daneben klingt der tiefe in seiner natürlichen Klangfarbe wie ein U. Allmälig aber, wie sich die Erinnerung des isoliert gehörten höheren Tones verliert, wird jener immer undeutlicher und dabei auch schwächer, während der tiefe Ton scheinbar stärker wird, und wie O lautet. Diese Schwächung des hohen und Verstärkung des tiefen Tones hat Ohm auch an der Violine beobachtet; sie tritt freilich, wie Seebeck bemerkt, nicht immer ein, wahrscheinlich je nachdem die Erinnerung an die einzeln gehörten Töne mehr oder weniger lebendig ist, und beide Töne mehr oder weniger gleichmäßig neben einander hinklingen. Wo der Versuch aber gelingt, gibt er den besten Beweis dafür ab, daß es sich hier ganz wesentlich um die verschiedene Tätigkeit der Aufmerksamkeit handelt. Bei den Flaschentönen ist außer der Verstärkung des unteren Tones auch die Änderung seiner Klangfarbe sehr deutlich und bezeichnend für das Wesen des Vorganges; bei den scharfen Violinklängen ist sie weniger auffallend.
Diesen Versuch nahmen sowohl Ohm wie Seebeck für ihre Meinung in Anspruch. Wenn Ohm es für eine Gehörtäuschung erklärt, daß das Ohr die Obertöne ganz oder zum Teil als Verstärkung des Grundtones (oder vielmehr des Klanges, dessen Höhe durch die des Grundtones bestimmt wird) auffaßt, so hat er hier freilich einen nicht ganz richtigen Ausdruck gebraucht, obgleich er Richtiges meinte, und Seebeck konnte ihm mit Recht erwidern, daß das Ohr der einzige Richter in Sachen der Gehörempfindungen sein müsse, und man die Art, wie das Ohr Töne auffasse, nicht als Täuschung bezeichnen dürfe. Indessen zeigen doch die von uns beschriebenen Versuche, daß das Ohr sich hier verschieden verhält, je nach der Lebhaftigkeit der Erinnerung an die einzelnen zum Ganzen verschmolzenen Gehöreindrücke und je nach der Spannung der Aufmerksamkeit. Wir können also allerdings von den Empfindungen des unbefangen auf die Außendinge gerichteten Ohres, dessen Interessen Seebeck vertritt, appellieren an das sich selbst aufmerksam beobachtende und in seinen Beobachtungen zweckmäßig unterstützte Ohr, welches in der Tat so verfährt, wie das von Ohm aufgestellte Gesetz es vorschreibt.
Auch ein anderer Versuch ist hier noch anzuführen. Wenn man den Dämpfer eines Klaviers hebt, so daß alle Saiten frei schwingen können, und nun gegen den Resonanzboden des Instrumentes den Vokal A auf irgend eine der Noten des Klaviers kräftig singt, so gibt die Resonanz der nachklingenden Saiten deutlich A, singt man O, so klingt O nach, singt man E, so klingt E nach; I weniger gut. Der Versuch gelingt nicht so gut, wenn man den Dämpfer nur von der Saite entfernt, deren Ton man singt. Der Vokal Charakter in dem Nachhall entsteht dadurch, daß dieselben Obertöne nachklingen, welche für die Vokale charakteristisch sind. Diese klingen aber besser und deutlicher nach, wenn die ihnen entsprechenden höheren Saiten frei sind und mitklingen können. Also auch hier wird schließlich der Klang der Resonanz zusammengesetzt aus den Tönen mehrerer Saiten, und viele einzelne Töne kombinieren sich zu einem Klange von besonderer Klangfarbe. Außer den Vokalen der menschlichen Stimme ahmt das Klavier auch den Klang einer Klarinette ganz deutlich nach, wenn man mit einer solchen stark hineinbläst.
Zu bemerken ist übrigens, daß, wenn auch die Höhe eines Klanges für seinen musikalischen Gebrauch nach dem Grundtone bestimmt wird, doch in Wirklichkeit der Einfluß der Obertöne dabei nicht verloren geht. Sie geben dem Klange immer etwas Helleres und Höheres. Einfache Töne klingen dumpf. Wenn man sie mit gleich hohen zusammengesetzten Klängen vergleicht, ist man geneigt letztere in eine höhere Oktave zu verlegen als erstere. Es ist ein Unterschied derselben Art, als wenn man den Vokal U und dann A auf dieselbe Note singt. Übrigens wird eben deshalb die Vergleichung der Tonhöhe von Klängen verschiedener Klangfarbe oft recht schwer; man irrt sich nämlich leicht um eine Oktave, und es sind den berühmtesten Musikern und Akustikern dergleichen Irrtümer zugestoßen. So ist bekannt, daß der als Violinist und theoretischer Musiker berühmte Tartini die Kombinationstöne alle um eine Oktave zu hoch angegeben hat, während andererseits Henrici7) die Obertöne der Stimmgabeln um eine Oktave zu tief angibt.
7) Poggd. Arm. Bd. XCIX, S. 506. — Dieselbe Schwierigkeit erwähnt Zamminer als bekannt unter den Musikern. (Die Musik und die musikalischen Instrumente, S. 111.)
Die dem Ohre bei der Unterscheidung der Obertöne zufallende Aufgabe ist eine solche, bei der es sich darum handelt, ein gegebenes Aggregat von Empfindungen in seine elementaren nicht weiter zerlegbaren Bestandteile aufzulösen. Wir sind daran gewöhnt in einer großen Anzahl von Fällen gleichzeitig bestehende Empfindungen verschiedener Art oder verschiedener Körperstellen unmittelbar bei der Wahrnehmung derselben als gesondert zu erkennen und unsere Aufmerksamkeit nach Willkür jeder einzelnen unter denselben gesondert zuwenden zu können. So können wir z. B. in jedem Augenblicke uns dessen gesondert bewußt werden, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, und dabei noch scheiden, was wir am Finger oder an der großen Zehe fühlen, ob Druck oder leise Berührung oder Wärme. Ebenso im Gesichtsfelde. Ja, wie ich im Folgenden zu zeigen mich bemühen werde, trennen wir gerade in allen denjenigen Fällen unsere Empfindungen leicht von einander, wo wir genau wissen, daß sie zusammengesetzt sind, wo wir nämlich durch häufig wiederholte, übereinstimmende Erfahrungen sicher geworden sind, daß die gegenwärtige Empfindung durch gleichzeitige Einwirkung mehrerer von einander unabhängiger Erregungsmittel, von denen jedes einzeln genommen eine ebenso wohlbekannte Empfindung hervorzurufen pflegt, entstehe. Daher bildet sich uns zunächst die Meinung, daß nichts leichter sei, als in einer Anzahl gleichzeitig erregter verschiedener Empfindungen die einzelnen von einander zu unterscheiden, und daß dies eine unmittelbar gegebene Fähigkeit unseres inneren Sinnes sei.
So finden wir es denn unter Anderem auch ganz selbstverständlich, daß wir verschiedene gleichzeitig vernommene Klänge einzeln hören, und erwarten, daß wir in jedem Falle, wo zwei solche zusammenkommen, dasselbe müßten tun können.
Anders stellt sich die Sache, wenn man sich daran macht auch die ungewöhnlicheren Fälle der Wahrnehmung zu untersuchen und die Bedingungen vollständiger kennen zu lernen, unter denen die besprochene Unterscheidung zu Stande kommt oder ausbleibt, wie dies in der Physiologie der Sinne geschieht. Dabei zeigt es sich denn, daß wir für das Bewußtwerden einer Empfindung zwei verschiedene Arten oder Grade unterscheiden müssen. Der niedere Grad des Bewußtwerdens ist derjenige, bei welchem der Einflüsse der betreffenden Empfindung sich nur in der von uns gebildeten Vorstellung von den äußeren Dingen und Vorgängen geltend macht und diese bestimmen hilft. Dies kann geschehen, ohne daß wir uns dabei zur Erkenntnis zu bringen brauchen oder vermögen, welchem besonderen Teile unserer Empfindungen wir die Anschauung dieses oder jenes Verhältnisses in unseren Wahrnehmungen verdanken. Wir wollen in diesem Falle mit Leibniz den Ausdruck brauchen, daß der betreffende Empfindungseindruck perzipiert sei. Der zweite, höhere Grad des Bewußtwerdens ist der, wo wir die betreffende Empfindung unmittelbar als einen vorhandenen Teil der zur Zeit in uns erregten Summe von Empfindungen unterscheiden. Eine solche Empfindung wollen wir als wahrgenommen (apperzipiert nach Leibniz) bezeichnen. Beides muß sorgfältig von einander geschieden werden.
Seebeck und Ohm sind mit einander darüber einig, daß die harmonischen Obertöne der Klänge perzipiert werden. Denn als perzipiert erkennt Seebeck sie an, indem er zugibt, daß ihre Einwirkung auf das Ohr die Stärke oder Klangfarbe des betreffenden Schalls verändere. Der Streit dreht sich darum, ob sie auch in allen Fallen in ihrer gesonderten Existenz wahrgenommen, apperzipiert werden können, ob also das Ohr auch ohne Unterstützung von Resonatoren oder anderen physikalischen Hilfsmitteln, welche die zu ihm gelangende Klangmasse selbst verändern, durch bloße passende Richtung und Spannung der Aufmerksamkeit unterscheiden könne, ob und wie stark in dem gegebenen Klange die Oktave oder Duodecime u. s. w. vorhanden sei.
Ich will zunächst eine Reihe von Beispielen anführen, aus denen hervorgeht, daß die für die Auflösung der Klänge stattfindende Schwierigkeit auch im Gebiete anderer Sinne besteht. Beginnen wir mit den verhältnismäßig einfachen Wahrnehmungen des Geschmacksinnes. Die Ingredienzien unserer Speisen und die Gewürze, mit denen wir sie zu versetzen pflegen, sind gar nicht so sehr mannigfaltig, daß nicht Jeder sie bald kennen lernen könnte. Und doch sind nur wenige Menschen, die nicht selbst die Kochkunst praktisch ausgeübt haben, im Stande, schnell und richtig die Bestandteile der vorgesetzten Speisen durch den Geschmack zu ermitteln. Wie viel Übung und vielleicht auch besonderes Talent zur Kunst des Weinschmeckens gehört, um fremde Einmischungen zu entdecken, ist in allen Weinländern bekannt. Für den Geruch gilt Ähnliches; ja selbst Geschmacks- und Geruchsempfindungen können sich zu einem Ganzen verbinden. Wir machen uns beim alltäglichen Gebrauche unserer Zunge durchaus nicht klar, daß das Eigentümliche von vielen Speisen und Getränken, z. B. Essig oder Wein auch auf Geruchsempfindungen beruht, indem deren Dämpfe vom Schlund in den hinteren Teil der Nase eintreten. Erst Personen, denen der Geruchssinn fehlt, zeigen uns, eine wie wesentliche Rolle er auch beim Schmecken spielt, indem bei solchen auch die Beurteilung der Speisen vielfältig mangelhaft ist, wie es übrigens Jeder an sich erfahren kann, während er einen starken Schnupfen bei reiner Zunge hat.
Wenn unsere Hand unversehens an einem kalten und glatten Metallstück entlang streift, glauben wir leicht, uns naß gemacht zu haben. Dies zeigt, daß die Tastempfindung des Nassen zusammengesetzt ist aus der des widerstandlosen Gleitens und der Kälte, welche in dem einen Falle das Metall wegen seiner guten Wärmeleitung, im andern Falle das Wasser wegen seiner Verdunstungskälte und großen Wärmekapazität hervorbringt. Daß wir Beides am Nassen wahrnehmen, können wir, wenn wir uns besinnen, wohl erkennen, daß aber das eigentümliche Gefühl des Nassen in der Tat ganz aufgeht in diese beiden Empfindungen, lehrt uns erst die genannte Täuschung.
Die Erfindung des Stereoskops hat gelehrt, daß die Anschauung der Tiefendimension des Gesichtsfeldes, das heißt der verschiedenen Entfernung, in der die Objekte und ihre Teile sich vom Auge des Beschauers befinden, wesentlich beruht auf der gleichzeitigen Perzeption zweier etwas verschiedener perspektivischer Bilder derselben in den beiden Augen des Beobachters. Bei hinreichend großer Verschiedenheit der genannten beiden Bilder ist es auch nicht schwer beide als getrennt wahrzunehmen. Wenn wir z. B. einen fernen Gegenstand fixieren und einen unserer Finger vorschieben, so sehen wir zwei Bilder des Fingers vor dem Hintergrunde erscheinen, deren eines fortfallt, wenn wir das rechte Auge schließen, während das andere dem linken angehört. Wenn aber die Unterschiede nach der Tiefe verhältnismäßig klein sind, und daher auch die Unterschiede der beiden perspektivischen Bilder auf unseren Netzhäuten gering ausfallen, so gehört große Übung und Sicherheit in der Beobachtung von Doppelbildern dazu, diese von einander zu scheiden, während doch die Perzeption ihrer Unterschiede noch da ist, und sich in der Anschauung des Reliefs der betrachteten Körperfläche zu erkennen gibt. Auch in diesem Falle bleibt, wie bei den Obertönen, die Leichtigkeit und Genauigkeit der Apperzeption hinter der der Perzeption weit zurück.
Zu unserer Vorstellung von der Richtung, in der die gesehenen Gegenstände liegen, müssen noch diejenigen meist den Muskeln angehörigen Empfindungen mitwirken, welche uns die Stellung unseres Körpers, des Kopfes zum Körper, des Auges zum Kopfe erkennen lassen. Wird eine von diesen geändert, z. B. die Empfindung der richtigen Stellung des Auges durch Fingerdruck gegen die Seite des Augapfels oder durch Lähmung eines der Augenmuskeln, so wird dadurch die Anschauung der Lage des Gesehenen geändert. Aber erst durch solche gelegentlich eintretenden Täuschungen erfahren wir, daß zu dem Aggregat von Empfindungen, die der Vorstellung vom Orte eines gesehenen Objekts zu Grande liegen, auch Muskelempfindungen gehören.
Mancherlei Analogie mit den zusammengesetzten Klängen bieten auch
die Erscheinungen der Mischfarben, nur daß bei diesen die Zahl der
Grundempfindungen sich auf drei reduziert, und die Trennung der zusammengesetzten
Empfindungen in ihre einfachen Elemente noch schwieriger und unvollkommener
ist, als im Gebiete der Töne. Daß man alle Farben als Verbindungen
von drei Grundfarben ansehen könne, erwähnt als eine damals schon
bekannte Sache Waller in den Philosophical Transactions vom Jahre
1686. Diese Ansicht konnte sich in älterer Zeit nur auf die Vergleichung
der Empfindungen und die Erfahrungen, welche bei Mischung der Malerfarben
gemacht waren, stützen. Die neuere Zeit hat bessere Methoden, verschiedenfarbiges
Licht zu mischen, kennen gelehrt und durch genaue Messungen die Richtigkeit
jener Hypothese bestätigt, aber auch gleichzeitig gelehrt, daß
diese Bestätigungen immer nur bis zu einer gewissen Grenze hin gelingen.
Das letztere ist dadurch bedingt, daß keine Art farbigen Lichtes
existiert, welche uns ausschließlich und rein eine einzige der Grundfarben
zur Empfindung brächte. Selbst die gesättigtsten und reinsten
Farben, welche die Außenwelt uns im prismatischen Spektrum darbietet,
können durch Entwickelung von Nachbildern der Komplementärfarbe
im Auge8) noch wie von einem weißen Schleier befreit werden,
und sind also noch nicht als absolut rein zu betrachten. Eben deshalb können
wir die absolut reinen Grundfarben, aus denen alle anderen Farben ohne
Ausnahme zu mischen sein würden, objektiv nicht herstellen. Wir wissen
nur, daß sich unter den Spektralfarben Scharlachrot, Spangrün
und Blauviolett ihnen von allen objektiven Farben am meisten nähern.
Wir können deshalb ans diesen drei objektiven Farben bei weitem die
meisten gewöhnlich vorkommenden Farben der verschiedenen Naturkörper
zusammensetzen, aber spektrales Gelb und Blau nicht in dem vollkommenen
Grade der Sättigung, welchen sie im Zustande größter Reinheit
im Spektrum darbieten. Unsere Mischungen sind immer ein wenig weißlicher,
als die entsprechenden einfachen Farben des Spektrum. Daraus folgt, daß
wir die einfachen Elemente aller unserer Farbenempfindungen im absolut
reinen Zustande nie, oder wenigstens nur auf kurze Zeit bei einzelnen besonders
dazu angestellten Versuchen zur Anschauung bringen, und also auch kein
genaues und sicheres Erinnerungsbild derselben in unserem Gedächtnis
tragen können, wie wir es haben müßten, um jede Farbenempfindung
nach der Anschauung sicher in ihre Elementarempfindungen rein aufzulösen.
Dazu kommt, daß wir verhältnismäßig selten Gelegenheit
haben, den Vorgang einer Zusammensetzung von Farben und deren schließliches
Resultat zu beobachten und dadurch zu lernen, in dem Zusammengesetzten
die Bestandteile wieder zu erkennen. Ja es scheint mir besonders charakteristisch
für diesen Vorgang zu sein, daß man gestützt auf die "Mischung
von Malerfarben, anderthalb Jahrhunderte lang, von Waller bis auf
Goethe, im Grün eine Mischung von Blau und Gelb zu sehen glaubte,
wahrend in Wahrheit das Blau des Himmels und Schwefelgelb, als farbige
Lichter und nicht als Pigmente mit einander gemischt, Weiß geben.
Eben dahin gehört die heftige Opposition Goethe's, der auch
nur die Mischung der Pigmentfarben kannte, gegen den Satz, daß Weiß
eine Mischung verschiedenfarbigen Lichtes sein könne. Wir dürfen
hiernach kaum daran zweifeln, daß dem Gesichtssinne von vorn herein
die Fähigkeit, die verschiedenen elementaren Bestandteile der Empfindung
zu scheiden, fehlt, und daß das Wenige, was beim ausgebildeten Beobachter
davon vorhanden ist, durch die gelegentlich gemachten Erfahrungen erlangt
worden ist, wobei denn namentlich auch falsch ausgelegte Erfahrungen zu
Irrtümern verleiten können.
8) Näheres hierüber siehe v. Helmholtz,
Handbuch der physiologischen Optik, l. Auflage, 8. 370; Vorträge und
Reden, 3. Auflage I, S. 284.
Für das Ohr dagegen liegen einem jeden Individuum Erfahrungen über die Zusammensetzung zweier oder mehrerer Klänge oder Geräusche in ausgedehntestem Maße vor, und die Fähigkeit, selbst sehr verwickelte musikalische Zusammenklänge in die einzelnen Stimmen der einzelnen sie hervorbringenden Instrumente zu zerlegen, kann von Jedem, der seine Aufmerksamkeit darauf wendet, bald erworben werden. Aber die letzten einfachen Elemente der Tonempfindung, die einfachen Töne, werden selten gehört. Selbst diejenigen Tonwerkzeuge, welche sie geben können, wie die Stimmgabeln vor Resonanzröhren, bringen bei stärkerer Erregung teils in teils außerhalb des Ohres noch schwache harmonische Obertöne hervor, wie wir im fünften und siebenten Abschnitte seilen werden. Also auch hier ist die Gelegenheit, ein genaues und sicheres Erinnerungsbild dieser einfachen Tonelemente unserem Gedächtnisse einzuverleiben, eine sehr beschränkte. Wenn aber von den Summanden nur eine einigermaßen verwaschene und schwankende Kenntnis da ist, so wird auch die Zerlegungsweise der Summe in entsprechendem Maße unsicher werden müssen. Wenn wir nicht ganz sicher wissen, was dem als Grundton zu betrachtenden Teile des Klanges zuzurechnen ist, so wird auch unsicher, was den Obertönen angehört. Deshalb müssen wir wenigstens im Anfang uns die einzelnen Elemente, die unterschieden werden sollen, vorher einzeln hörbar machen, um eine ganz frische Erinnerung an die Empfindung zu haben, die ihnen entspricht, und das ganze Geschäft erfordert ruhige und gesammelte Aufmerksamkeit. Es fehlt eben die Leichtigkeit dabei, welche wir durch oft wiederholte Erfahrung gewinnen können, während bei der Scheidung musikalischer Akkorde in ihre einzelnen Stimmen uns eine solche zu Hilfe kommt. Bei diesen hören wir die einzelnen Klänge genügend oft einzeln, und beobachten, wie sie sich zum Zusammenklange vereinigen, während wir die einfachen Töne selten vernehmen und den Aufbau zusammengesetzter Klänge aus ihnen fast nie vor unseren Ohren zu Stande kommen hören.
So ergibt sich dann schließlich als Resultat dieser Diskussion:
1) Daß die Obertöne, welche den einfachen Schwingungen einer zusammengesetzten Luftbewegung entsprechen, empfunden? (perzipiert) werden, wenn sie auch nicht immer zur bewußten Wahrnehmung kommen (nicht apperzipiert werden).
2) Daß sie ohne andere Hilfe, als eine zweckmäßige Leitung der Aufmerksamkeit, auch zur bewußten Wahrnehmung gebracht, oder apperzipiert werden können.
3) Daß sie aber auch in dem Falle, wo sie nicht isoliert wahrgenommen werden, sondern in die ganze Klangmasse verschmelzen, doch ihre Existenz in der Empfindung erweisen durch die Veränderung der Klangfarbe, wobei sich namentlich auch der Eindruck ihrer größeren Tonhöhe in charakteristischerweise dadurch äußert, daß die Klangfarbe heller und höher erscheint.
Genaueren Aufschluß über die Beziehungen der Obertöne zur Klangfarbe wird der nächste Abschnitt geben,